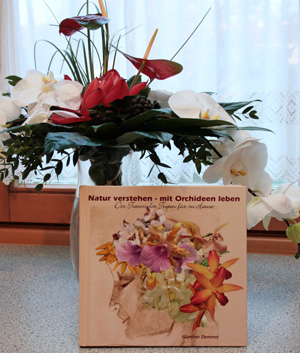| Ende des Torfabbaus in der Nicklheimer Filzen | Büchsenmacher im Visier Peter Fortner und Thomas Daurer
|
| "Wunderheiler" Bruno Gröning |
| Beach-Club am Hochstrasser See? |
| Charolais-Kühe - Ein seltenes Bild im Raum Rosenheim |
| Firmenportraits |
| Postler wirft Briefe ins Altpapier |
| Berichte aus der Region Rosenheim |
| Berichte aus der Stadt Rosenheim |
| Berichte aus Raubling |
| Berichte aus Aschau |
| Berichte aus Rohrdorf |
| Berichte aus Thansau |
| Berichte aus Achenmühle |
| Berichte aus Lauterbach |
| Berichte aus Höhenmoos |
| Aus dem Schulleben |
| Fotos |
| Ich über mich |
| Impressum |
| Kontakt |
| Marisa Pilger online freie Journalistin im Raum Rosenheim |
Wenn die Jugend die Wände hochgeht
Zweiter Montagne SOBY-Cup in der Kletterhalle Rosenheim Rosenheim (pil) - Nach der gelungenen Premiere vom vergangenen Jahr lädt das Rock&Bloc-Team der DAV-Sektion Rosenheim zum zweiten Mal zum Montagne SOBY-Cup in die Boulderhalle Rosenheim ein. Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit sind gefragt, wenn dort am Samstag, 5. Juli, Kinder und Jugendliche aus dem südostbayerischen Raum (Jahrgänge 1999 bis 2006) buchstäblich die Wände hochgehen. |
von Marisa Pilger
Rosenheim – Die Häufigkeit der Ablehnung der Pflegestufe, der stetig wachsende bürokratische Aufwand für die Dokumentation, Probleme beim Umgang mit ärztlichen Verordnungsscheinen – es sind immer wieder die gleichen Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste in ihrem beruflichen Alltag stellen müssen und die den reibungslosen Arbeitsablauf oftmals stark beeinträchtigen. Um diese zeit- und kräfteraubende Situation für alle Betroffenen zu verbessern, hat sich vor einem Jahr der Arbeitskreis (AK) Pflege als vierter und jüngster unter dem Dach des Vereins „Pro Senioren Rosenheim“ zusammengeschlossen.
 |
| Setzen sich für die Verbesserung der Lebenssituation alter Menschen ein: Thomas Waldvogel, Leiter des Arbeitskreises „Pflege“, mit Dagmar Pawelka und der „Pro Senioren“-Vorsitzenden Inge Ilgenfritz (von links). Foto: pil |
Von den Zusammenkünften erhofft sich Waldvogel, selbst examinierter Krankenpfleger und früher lange Zeit im ambulanten Dienst tätig, neue Impulse für die Pflegekräfte sowie insbesondere mehr Verständnis für die Arbeit und die Entscheidungen der „Gegenseite“. Dabei setzt er auf ein einfaches Rezept: „Miteinander statt Gegeneinander“. So könnte beispielsweise eine Diskussion mit Vertretern von Krankenkassen dazu beitragen, eines der großen Spannungsfelder in der ambulanten Pflege zu entschärfen, ist er überzeugt.
Und auch an Visionen fehlt es Waldvogel, der in der Anfangszeit tatkräftig von Werner Faltlhauser unterstützt wurde, nicht. Zunächst schwebt ihm – in Anlehnung an den Demenzwegweiser – ein Pflegeführer mit sämtlichen Anlaufstellen rund ums Thema ambulante Pflege vor. Bislang sei das Projekt allerdings ein reines Gedankenspiel, rät Dagmar Pawelka vor verfrühten Anfragen ab. Sie koordiniert im Auftrag der Stadt Rosenheim die Belange des Vereins „Pro Senioren“ und steht zugleich als Ansprechpartnerin sowohl für Seniorinnen und Senioren als auch für Institutionen und Verbände zur Verfügung.
Mit dem „Arbeitskreis Pflege“ als fachliche und inhaltliche Ergänzung zu den drei Arbeitsgruppen „Alternative Wohnformen“, „Netzwerk Demenz“ und „Mehrgenerationenpark“ schließt sich derweil auch für die „Pro Senioren“-Vorsitzende Inge Ilgenfritz ein Kreis: „Nun kann der Verein noch mehr Gewicht in die Waagschale werfen, wenn es darum geht, bestmögliche Bedingungen für alte Menschen zu schaffen.“
Weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.pro-senioren-rosenheim.de oder unter Telefon 08031/365-1636.
Juni 2014
Sprache - der Generalschlüssel für Integration
Junge Asylbewerber besuchen BIJ-Vorklasse an der Berufsschule Wasserburg, eine von zwölf in Oberbayern, und erhalten dort sozialpädagogische Unterstützung durch den Verein "Pro Arbeit"
von Marisa Pilger
Wasserburg – „Wörterbuch“ – dieser Begriff ist den meisten Schülern der BIJ/V-Klasse an der Staatlichen Berufsschule Wasserburg zwar bereits geläufig. Dennoch sind die Nachschlagewerke ebenso wie die Turnschuhe, die Martin Schwegler und Markus Götz von der „Aktion Aufwind“ bei ihrem Besuch im Gepäck hatten, für die 20 Asylbewerber und Flüchtlinge aus Bürgerkriegs- und Krisengebieten unverzichtbar.
 |
| Die Sprache ist das A und O - entsprechend groß war die Freude der Schüler der BIJ/V-Klasse über die Wörterbücher, die dank der "Aktion Aufwind" angeschafft werden konnten. Claudia Georgii und Harald Neu vom Verein "Pro Arbeit" halfen bei der Verteilung. Fotos: Pilger |
Darüber hinaus erhalten die jungen Menschen sozialpädagogische Unterstützung. In Wasserburg kümmert sich darum der Verein „Pro Arbeit Rosenheim“, der für den Sprachunterricht die dortige Volkshochschule als Kooperationspartner ins Boot geholt hat.
Der Großteil der Wasserburger BIJ/V-Schüler stammt aus Afghanistan, Syrien oder Pakistan, einer aus dem Senegal, ein anderer aus Nigeria. Entsprechend bunt ist die Palette der Muttersprachen, die im Unterricht von DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Lehrer A'kos Dombai zusammentreffen; sie reicht von Englisch und Französisch über Persisch und Arabisch bis hin zu Urdu und Paschto. Jede Woche stehen nun 15 Unterrichtseinheiten Deutsch in Wort und Schrift auf dem Stundenplan. Hinzu kommen allgemeinbildende und berufsvorbereitende Inhalte, wobei die 17- bis 21jährigen auch in verschiedene Berufsfelder wie etwa die Kunststoff- und Metallbearbeitung schnuppern können. Und sie sind sich durchaus im Klaren darüber, dass die Sprache der Generalschlüssel ist für Integration - und für einen Job im neuen, noch fremden Land.
So stehen alle jeden Tag pünktlich und hochmotiviert auf der Matte, wie Schulleiter Gerhard Heindl und seine Stellvertreterin Claudia Romer immer wieder erfreut beobachten können; wenngleich die Unterkünfte von Amerang über Söchtenau, Bruckmühl, Bad Abiling und Kolbermoor bis Neubeuern und Kiefersfelden quer über den ganzen Landkreis verstreut sind. Einziges Zugeständnis an den zum Teil sehr langen und umständlichen Schulweg: Der Unterricht beginnt anstatt um 7.45 Uhr erst um 8.30 Uhr.
 |
| Mit Wörterbüchern und Turnschuhen unterstützt die "Aktion Aufwind" die jungen Asylbewerber und Flüchtlinge an der Berufsschule Wasserburg. |
Unterdessen hat die „Aktion Aufwind“, ein Gemeinschaftsprojekt der Sparkassenstiftungen Zukunft für die Stadt und den Landkreis Rosenheim und den hiesigen Wohlfahrtsverbänden, die BIJ/V-Schüler nicht nur mit Lernhilfen versorgt; dank der Turnschuhe – sie wurden mitgesponsert vom Wasserburger Gewandhaus Gruber - sind diese nun auch für den Sportunterricht gerüstet. Die Hilfsaktion wurde vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen. Sie will zum einen akute Not bei bedürftigen Kindern und Jugendlichen in der Region lindern. Zum anderen will sie diesen jungen Menschen die Chance geben, trotz finanzieller Not am gesellschaftlichen Leben in all seinen Facetten, von der Kultur bis hin zum Sport, teilzuhaben - will eben Hindernisse aus dem Weg räumen. „Das ist ein Riesenschritt für Sie und für uns als Gesellschaft.“, verdeutlichte Martin Schwegler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftungen, in seiner kurzen Ansprache. Denn wer kein oder nur wenig Geld habe, gerate nur zu leicht auch gesellschaftlich ins Abseits.
Entsprechend groß ist die Bedeutung, die Schulleiter Gerhard Heindl der neuen Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr und vor allem auch der Unterstützung der jungen Flüchtlinge und Asylbewerber durch die „Aktion Aufwind“ beimisst, wie er gegenüber Schwegler und dem „Pro Arbeit“-Vorsitzenden Harald Neu betonte: „Wir sind darauf angewiesen, dass diese Art der Beschulung sichergestellt wird.“
Februar 2014
Ein etwas anderer Streifzug durch die Welt der Orchideen
Günther Demmels Tropenschönheiten, in Worte gefasst von Marisa Pilger Es ist ein etwas anderer Streifzug durch die Welt der Tropengewächse, zu dem Günther Demmel seine Leser in seinem Erstlingswerk „Natur verstehen – mit Orchideen leben“ mitnimmt. Denn der Autor will vor allem eines: Seine langjährige Zucht- und Kulturerfahrung festhalten, Verständnis wecken für das faszinierende Individuum Orchidee und seine Leser mit wertvollen Tipps versorgen, damit ihre tropischen Schönheiten auch im Wohnbereich prächtig gedeihen. |
Seltener Gendefekt mit schwerwiegenden Folgen
Angelman-Syndrom: Regionaltreffen in Bad Aibling bot Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch
Bad Aibling (pil) - Die Krankheit ist selten; nach Angaben der Selbsthilfeinitiative „Angelman e.V.“ trägt im Schnitt eines von 30.000 Neugeborenen den folgenschweren Gendefekt auf dem 15. Chromosom. Entsprechend fühlen sich viele Eltern von Angelman-Kindern oftmals allein gelassen mit ihren Fragen, Sorgen und Nöten. Umso wichtiger sind für diese Familien regelmäßige Zusammenkünfte mit anderen Betroffenen, wie das jüngste Treffen der Regionalgruppe Süd in der Raphael-Schule in Bad Aibling bewies. Rund 50 Besucher aus ganz Bayern, darunter die Angehörigen von zwölf Angelman-Kindern im Alter zwischen zwei und 29 Jahren, nutzten bei der Veranstaltung in der Heilpädagogischen Waldorfschule die Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch.
Im Jahr 1965 beschrieb der britische Kinderneurologe Harry Angelman erstmals das später nach ihm benannte Syndrom, an dem bundesweit schätzungsweise 3000 Menschen leiden; wobei der Verein von einer Dunkelziffer in ähnlicher Höhe ausgeht. Charakteristisch für das Krankheitsbild sind – bei normaler Lebenserwartung - nicht nur eine ausgeprägte Verzögerung der körperlichen und geistigen Entwicklung (sie erreicht bei den meisten Betroffenen in etwa den Stand eines Kleinkindes), abgehackte, marionettenartige Bewegungsabläufe, häufiges, oft unmotiviertes Lachen und epileptische Anfälle. Ebenso ist die Sprachentwicklung stark beeinträchtigt; in vielen Fällen fehlt sie völlig.
Andere Wege der Kommunikation zeigte deshalb die Sprachgestalterin Claudia Klaus auf. Bei praktischen Übungen ermutigte sie die Eltern, sich mithilfe verschiedener Rhythmen oder von Tönen in unterschiedlicher Lautstärke mit ihren Kindern zu verständigen.
Ergänzend erläuterte Michael Erdösi das Pädagogische Konzept des privaten Förderzentrums, welches bei besonderen Kindern die Selbsterziehung in den Vordergrund stellt. Zugleich rief er seine Zuhörer dazu auf, innerlich aufeinander zuzugehen und forderte, die Kinder in ihrer Wahrheit und Unvollkommenheit ernst zu nehmen. An den Schluss seines Vortrags hatte der Lehrer ein Zitat von Rudolf Steiner, des Begründers der Waldorfpädagogik, gesetzt. „Die Erziehung heilt den normalen Menschen. Heilen ist Erziehung für den abnormen Menschen.“
Bei einem Rundgang mit Schulleiterin Ulrike Nebel konnten sich die Teilnehmer ein Bild von der im Jahr 2006 von Eltern gegründeten Einrichtung machen, in die zudem eine heilpädagogische Tagesstätte sowie eine Vorschultagesstätte integriert sind. Die Kinder wurden in der Zwischenzeit im Schulgarten von engagierten Lehrern betreut.
Weitere Informationen über das Angelman-Syndrom und über die nächsten Treffen gibt’s im Internet unter www.angelman.de.
Oktober 2013
|
Niederaudorf (pil) – Bereits Monate vor der Eröffnung wird sie allenthalben als „Schule der Zukunft“ bezeichnet, die Private Grundschule Inntal, die im Herbst in Niederaudorf ihre Pforten öffnen wird. Nach derzeitigem Stand der Dinge lernen in der neuartigen inklusiven Einrichtung dann 28 Kinder mit und ohne Behinderung in zwei jahrgangsgemischten Klassen (1. bis 4. Jahrgangsstufe) miteinander - und voneinander. Restplätze fürs kommende Schuljahr sind noch frei.
Zunächst allerdings muss der Brandschutz in den beiden unteren Stockwerken des Gebäudes aus den 1960er Jahren, in dem früher die Teilhauptschule untergebracht war, auf Vordermann gebracht werden: Neue Fluchtwege sind erforderlich; zusätzliche Türen werden eingebaut; zudem steht eine Reihe von Renovierungsarbeiten an.
Erst vor kurzem haben Bettina Brühl, die Geschäftsführerin des Schulträgers, der „Petö und Inklusion gemeinnützige GmbH“, einer hundertprozentigen Tochter des Vereins „Fortschritt Rosenheim e.V.“, und Oberaudorfs Bürgermeister Hubert Wildgruber den Mietvertrag für das Schulhaus am nördlichen Ortsrand unterzeichnet. Die ersten zwei Jahre darf die Private Grundschule das Erdgeschoss mit drei jeweils gut 70 Quadratmeter großen Räumen sowie das Souterrain mit Küche für den Hort (alles in allem etwa 800 Quadratmeter) samt Gartenbereich und der großen Turnhalle mietfrei nutzen – gewissermaßen als Starthilfe von Seiten der Gemeinde.
Schließlich soll sich an der Rosenheimer Straße nicht nur eine bundesweit bislang wohl einzigartige Grundschule mit einem inklusiven Konzept etablieren, dessen zentralen Bestandteil die ganzheitliche Petö-Pädagogik in Verbindung mit Konduktiver Förderung bildet. Parallel dazu werden dort ein integrativer Hort sowie eine heilpädagogische Tagesstätte entstehen. Die enge Verzahnung zwischen Schule und Hort mit fließenden Grenzen zwischen Lernblöcken und Freizeit will das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) als Modellprojekt wissenschaftlich begleiten. Die Trägerschaft der Tagesstätte mit konduktiver Förderung übernimmt unterdessen die Phoenix GmbH, Konduktives Förderzentrum der Stiftung Pfennigparade in München.
Bis aus Tuntenhausen, Großkarolinenfeld und dem Traunsteiner Raum kommen die Schüler „angereist“, erzählt Bettina Bühl; wobei die Übernahme der Fahrtkosten durch den Bezirk für viele der betroffenen Familien noch nicht in trockenen Tüchern sei. Geplant ist, Fahrgemeinschaften zu gründen. Darüber hinaus wird sich die Schule einen Kleinbus zulegen; ein entsprechender Antrag wurde bereits bei der "Aktion Mensch" eingereicht.
Die Finanzierung des Schulbetriebs beurteilt Brühl als soweit gesichert, dass sie als Vertreterin des Trägers eine entsprechende Erklärung an staatlicher Stelle abgeben konnte. Dafür haben nicht nur Zuwendungen wie eine 20.000-Euro-Spende der Familie Micaela und Klaus Werndl, ein Scheck in gleicher Höhe von der Ursula-und-Walter-Schatt-Stiftung sowie ein namhafter Betrag der Emmy-Schuster-Holzammer-Stiftung gesorgt. Auch hätten andere regionale Stiftungen bereits Zuschüsse in Aussicht gestellt.
Allerdings fließe die Förderung durch die Regierung von Oberbayern erst im dritten Jahr in voller Höhe. Und abgesehen von den Umbauarbeiten, in die man viel Eigenleistung stecken wolle, werden die Erstausstattung der Schule mit Möbeln, Sportgeräten, Therapiegeräten und Lernmaterial sowie die Personalkosten eine erhebliche Summe verschlingen. Brühl: „Wir sind also nach wie vor dringend auf Spenden angewiesen.“
April 2013
Neubeuern (pil) – Geteilter Meinung ist man im Neubeuerer Gemeinderat, ob an der Viehweide als möglichem Standort für ein Gewerbegebiet festgehalten werden soll. Mit einer knappen Mehrheit von 8:7 Stimmen sprach sich das Gremium dafür aus, die Planung für das Areal an der Gemeindegrenze zu Rohrdorf weiter zu verfolgen und eine Standortalternativenprüfung auf Flächennutzungsplan-Ebene vorzunehmen. Wie die Chancen für die Genehmigung eines Gewerbegebiets an dieser Stelle stehen, lasse sich im Hinblick auf die derzeitige Reform des Landesentwicklungsprogramms (LEP) im Moment allerdings kaum einschätzen, so die allgemeine Auffassung.
Während Christina zur Hörst (Freie Wähler) in Erwägung zog, die Angelegenheit dem nächsten Gemeinderat zu überlassen, plädierte Konrad Stuffer (CSU) für Weitermachen; auch solle man diese Entscheidung „nicht an der Wahl aufhängen“. Ebenso wollen Franz Steinkirchner (CSU) und Johann Schmid (Freie Wähler) das Vorhaben weiterverfolgen; zumal, wie Schmid ergänzte, der Grundstückseigentümer grünes Licht signalisiert habe.
Dagegen lehnt es Thomas Schwitteck (CSU) mit allem Nachdruck ab, ein Gewerbegebiet in den von der Autobahn bis zum Dandlberg reichenden Grüngürtel zu setzen, weil die Bürger die Lösung am Ortseingang von Neubeuern abgelehnt haben. Für ihn komme als Alternative stattdessen der Bereich Am Birbet/ Rauwöhrstraße in Betracht.
Als Überflutungswiese hält derweil Johann Fritz (Freie Wähler) die Viehweide als Standort für ein Gewerbegebiet für ungeeignet.
Weil eine Teilfläche der Viehweide im Landschaftsschutzgebiet Inntal-Süd liegt, strebt der Gemeinderat bei 10:5 Stimmen hier außerdem eine Befreiung an; ein entsprechender Passus wurde in die Stellungnahme zur Änderung der Schutzgebietsverordnung aufgenommen.
März 2013
Zum Thema Gewerbegebiet auf der Viehweide hat sich zwischenzeitlich auch der Bürgerblock Rohrdorf zu Wort gemeldet. In einem Flugblatt, das bei der Sitzung in Neubeuern kurz zur Sprache kam, warnt die Gruppierung aus der Nachbargemeinde vor den negativen Auswirkungen auf die Natur und die Wohnqualität in Rohrdorf. |
Neubeuern/ Rohrdorf (pil) – Beim Thema Gewerbegebiet lässt Neubeuerns Bürgermeister Josef Trost noch nicht locker. Jetzt will er einen neuen Vorstoß für die sogenannte „Viehweide“ an der Gemeindegrenze zu Rohrdorf unternehmen. Er hofft, auf dem rund fünf Hektar großen Areal direkt gegenüber der Einmündung der Kreisstraße RO 26 vom Zementwerk her in die Staatsstraße 2359 doch noch Platz für Gewerbebetriebe schaffen zu können.
Denn tatsächlich könne die Marktgemeinde abgesehen vom Bereich Angerl/ Langweid – ein neues Gewerbegebiet an dieser Stelle hatten die Neubeuerer im vergangenen Juli per Bürgerentscheid abgelehnt - auf keine andere Fläche zurückgreifen. Allein 40 Prozent des 15,3 Quadratkilometer großen Gemeindegebiets lägen in Schutzzonen, verdeutlicht Trost die Lage. „Wir können uns nicht weiterentwickeln.“
Mangels Erweiterungsmöglichkeit seien in der jüngeren Vergangenheit bereits vier Betriebe in andere Gemeinden abgewandert. Und nach wie vor lägen Anfragen von Interessenten für neue Gewerbeflächen vor.
Die Regierung von Oberbayern hat sich allerdings bereits vor geraumer Zeit gegen ein Gewerbegebiet auf dem Gelände nahe des Turner Hölzl ausgesprochen, da dies zu einer Zersiedelung führen würde und damit den Zielen des Landesentwicklungsprogramms (LEP) zuwiderlaufe (wir berichteten). Und sie bleibt bei dieser Auffassung. „Es besteht weder eine Anbindung zu Siedlungsbereichen in Neubeuern noch in Rohrdorf.“, teilte Pressesprecher Stefan Frey jetzt auf erneute Anfrage hin mit. Auch lägen aus Sicht der Regierung die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anbindungsgebot nicht vor.
Unterdessen sieht Trost eine gewisse „Rechtsunsicherheit“ und will nun „jede Chance wahrnehmen“, bevor die Fortschreibung des LEP rechtskräftig werde. Vorab hat er deshalb die Nachbargemeinde Rohrdorf um eine Stellungnahme gebeten.
Januar 2013
Rosenheim (pil) – Der Name allein spricht schon für sich: „Pro Ausbildung - Hotline gegen Ausbildungsabbruch“ heißt der neue Baustein, um den der Verein „Pro Arbeit Rosenheim e.V.“ jetzt seinen Katalog an Hilfsangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene erweitert hat. Denn die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zwar merklich entspannt; das erklärte Ziel der Betriebe jedoch, der Abschluss der Berufsausbildung, bleibt noch allzu oft auf der Strecke: Etwa jeder vierte Auszubildende steigt einer Erhebung der IHK zufolge vorzeitig aus der Lehre aus. Die neue, kostenlose Anlaufstelle für Lehrlinge und Betriebe aller Branchen in Stadt und Landkreis Rosenheim will dem künftig vorbeugen und damit zugleich dem Fachkräftemangel in der Region gegensteuern.
 |
| Aufbruchstimmung beim Startschuss für die „Hotline gegen Ausbildungsabbruch“: Sozialdezernent Michael Keneder, „Pro Arbeit“-Geschäftsführerin Claudia Georgii, Reinhold Frey, Vorsitzender des Wirtschaftlichen Verbandes und Beiratsmitglied, und Martin Schwegler von der Sparkassenstiftung mit „Pro Arbeit“-Vize Kaspar Öttl, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und der Vereinsvorsitzenden Inge Ilgenfritz (von links). Foto: pil |
Einen wesentlichen Anteil an der Finanzierung der Hotline hat – neben einer Spende der BTG in Höhe von 75.000 Euro – die Sparkassenstiftung „Zukunft für die Stadt Rosenheim“. Drei Jahre lang werden von dort bis zu 25.000 Euro jährlich in das Modellprojekt fließen, dessen Bedeutung für den Wirtschaftsraum Rosenheim Martin Schwegler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung, sehr hoch einschätzt: „Es ist das Sahnehäubchen auf dem Angebot von Pro Arbeit, das immer die Jugendlichen im Fokus hat.“, betonte er beim offiziellen Projektstart im Büro von Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer. Mit diesem neuen Service spanne sich der Bogen an Hilfsangeboten nunmehr von der Grundschulzeit (Sozialarbeit an Schulen) über den Einstieg ins Berufsleben (Qualipatenprojekt, Ausbildungsstellenvermittlung) bis hin zur Abschlussprüfung im Lehrberuf. Und von dieser Nachhaltigkeit wiederum, ist Schwegler überzeugt, profitierten nicht nur die Jugendlichen sondern auch die Unternehmen in großem Maße.
Weitere Informationen zur Hotline gegen Ausbildungsabbruch gibt es bei Alexander Halle-Krahl vom Verein „Pro Arbeit“, Telefon 08031/80696-31.
Januar 2013
von Marisa Pilger
Niederaudorf – Bildung, Bewegung, Begegnung – mit diesen drei „B“ will die Private Grundschule Inntal ab Herbst einen neuen Akzent in der Schullandschaft setzen. Die Vorbereitungen für die neue Einrichtung laufen auf Hochtouren.
Noch ist das Personal nicht vollzählig, es gibt noch freie Plätze für Schüler, das Gebäude muss noch renoviert werden, und auch die Finanzierung steht noch nicht komplett. Doch die erste, entscheidende Hürde für die staatliche Genehmigung sei bereits genommen, freut sich Vorsitzende Bettina Brühl: Die ganzheitliche Petö-Pädagogik, die dem 50-seitigen, dem bayerischen Lehrplan angepassten Schulkonzept zugrunde liegt, sei bei der Regierung von Oberbayern auf Zustimmung gestoßen. Und so könnte am 12. September 2013 in Niederaudorf erstmals eine allgemeine Schule für Kinder mit und ohne Behinderung an den Start gehen, in der die Konduktive Förderung den zentralen Bestandteil des pädagogischen Konzepts bildet.
 |
| Mit Bewegung geht vieles leichter – auch das Buchstaben Lernen. Foto: GS Inntal |
Bei den Kindern die „lebenslange Freude am Lernen“ zu wecken und zu erhalten, ist mit eines der Hauptanliegen der Schule, in deren Ganztageskonzept sich Unterricht und Programme mit verschiedenen Schwerpunkten (Motorik, Kognition, Freizeitgestaltung) im Tagesablauf abwechseln sollen. In der Forscherwerkstatt können die Kinder ganz selbstständig in die Welt der Naturwissenschaften eintauchen. Und auch beim Rechnen, Schreiben oder Lesen werde individuelles Lernen großgeschrieben. „Spezielle Interessen und Begabungen können vertieft werden, auch wenn sie über die Lehrplaninhalte hinaus gehen.“, verspricht die Homepage www.private-grundschule-inntal.de. Einzelne Anfragen von Eltern hochbegabter Kinder lägen bereits vor.
Einen besonderen Schwerpunkt legt das Schul-Team auf Bewegung. So sind auf dem Stundenplan nicht nur täglich zwei Stunden inklusiver Sportunterricht mit ausgebildeten Konduktoren und einem Sportwissenschaftler vorgesehen; auch sollen möglichst alle Lernsituationen mit Eigenaktivität verknüpft werden. Darüber hinaus wird Thomas Münch, er trainiert seit 2006 das deutsche Paralympic-Skiteam (alpin), unter anderem Ski- und Ski-Bob-Projekte betreuen.
„Wir verstehen uns als Teil der Dorfgemeinschaft.“, verdeutlicht Brühl außerdem, wie sehr der Schule die Einbindung ins Ortsgeschehen am Herzen liegt - und rennt damit bei Bürgermeister Hubert Wildgruber offene Türen ein. Er begrüßt das „Pilotprojekt im bayerischen Schulsystem“ ausdrücklich als Chance. Und als „Starthilfe“ habe man ins Auge gefasst, das Schulgebäude die ersten beiden Jahre mietfrei zur Verfügung zu stellen.
Indes steht und fällt das ehrgeizige Projekt mit dem Geld. Rund 350.000 Euro muss der Träger, die von „FortSchritt Rosenheim“ jüngst gegründete „Petö und Inklusion gGmbH“, aufbringen, um den Umbau sowie die Sach- und Personalkosten, die der Staat während der ersten beiden Jahre nur zum Teil trägt, finanzieren zu können. Entsprechend muss Brühl als Geschäftsführerin nicht nur Schüler und Personal akquirieren sondern auch Sponsoren. Dabei kommt ihr insbesondere ihre Erfahrung mit integrativem Schulbetrieb zugute: Ihre 14jährige Tochter Ronja besuchte die Außenklasse an der Rohrdorfer Schule und drückt derzeit die Schulbank in Bad Feilnbach. Zudem gewann der Verein „FortSchritt Rosenheim“ 2010 mit dem Konzept einer Petö-Inklusions-Schule den zweiten Preis im Rosenheimer Businessplanwettbewerb "Gipfelstürmer".
Januar 2013
Startschuss fiel vor zehn Jahren
Die "Konduktive Förderung nach Petö" hat der Kindergarten „Sonnenschein“ in Rosenheim/ Oberwöhr vor zehn Jahren in die Region gebracht. Er wurde auf Initiative von Eltern mit Kindern mit Körperbehinderung eröffnet. Drei Jahre später gründeten diese Eltern den Verein "FortSchritt Rosenheim", um die ganzheitliche Fördermethode des ungarischen Neurologen Professor András Petö zu verbreiten, die den Betroffenen zu mehr Eigenaktivität und Selbstständigkeit verhilft. |
 |
| Hoch erfreut nahm Reiner Schulz (links), der Vorstandsvorsitzende der Schattdecor AG, die Goldene Rampe aus den Händen der Rosenheimer Behindertenbeauftragten Christine Mayer entgegen, sowie die Glückwünsche von Hans Loy (rechts) und Laudator Franz Hartl. Der Festabend wurde stimmungsvoll umrahmt von der „Grieser Hausmusik“. Foto: Pilger |
von Marisa Pilger
Thansau – Sie besteht zwar nur dem Namen nach aus Edelmetall, dennoch ist die Symbolkraft der kleinen weißen Gipsplastik Gold wert: Denn mit der Verleihung der Goldenen Rampe des Arbeitskreises „Inklusion – Menschen mit Behinderung mittendrin!“ werde ein „Ausrufezeichen“ gesetzt für diejenigen, die aktiv die Inklusion von Menschen mit Handicap unterstützen, begleiten und fördern, wie es Franz Hartl, Vorstand der Stiftung Attl, in seiner Laudatio auf die Firma Schattdecor, den 13. Träger dieser ideellen Auszeichnung, formulierte.
Vor fast genau drei Jahren hat das Dekordruckunternehmen in Thansau für die Inntal-Werkstätten zwei Außenarbeitsplätze geschaffen. Im Rahmen einer Werbekampagne galt es damals, 500.000 Musterfolien anzufertigen; eine Arbeit, die zuvor immer außer Haus erledigt worden war. Seither gehören Christine und Simon zur Belegschaft – und fühlen sich hier spürbar wohl. Die 34jährige, für die demnächst der Umzug in eine Wohngemeinschaft der Offenen Behindertenarbeit Rosenheim ansteht, stellt inzwischen Kataloge und Mustermappen für Kunden und Messen zusammen; ihr Kollege (33), er wohnt in einer Außenwohngruppe der Stiftung Attl, ist fürs Verpacken und Verschicken zuständig.
Soziale Barrieren aus dem Weg räumen, Berührungsängste überwinden, zwei ganz unterschiedliche Arbeitswelten einander näher bringen - „Wie einfach Inklusion funktionieren kann“, zeigte Hartl auch mit dem zweiten preiswürdigen Projekt auf: Beim Azubi-Austausch zwischen Schattdecor und den Inntal-Werkstätten tauchen regelmäßig Behinderte und Nicht-Behinderte für einen Tag in die Arbeitswelt des anderen ein.
Seit dem Jahr 2000 verleiht der Arbeitskreis „Inklusion – Menschen mit Behinderung mittendrin!“ unter dem Vorsitz von Hans Loy, Jakob Brummer und Hannes Bachmeier die Goldene Rampe an Personen und Institutionen in Stadt und Landkreis Rosenheim. Das Kunstwerk in Form einer Empore, auf die sowohl eine Rollstuhlrampe als auch eine Treppe führen, haben sieben behinderte Mädchen unter Anleitung eines Kunsttherapeuten gestaltet.
Die wichtige Signalwirkung der Auszeichnung rückte auch Landrat Josef Neiderhell in den Vordergrund. Denn wie groß der Handlungsbedarf in Sachen Inklusion in der Region sei, habe nicht zuletzt die Auftaktveranstaltung für den Teilhabeplan im September gezeigt. Um Inklusion, die ganz selbstverständliche gesellschaftliche, soziale und berufliche Teilhabe behinderter Menschen am Alltag also, aber überhaupt leben zu können, müssten zunächst die Rahmenbedingungen verbessert werden, konstatierte der Landrat unter kräftigem Beifall der Festgäste.
Dabei hatte eigentlich alles mit einer Espressomaschine begonnen, erinnerte Stiftungsvorstand Hartl an die Anfänge der Kooperation zwischen der Stiftung Attl und dem weltweit tätigen Unternehmen; lange, bevor die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist. Vor rund zehn Jahren hatte Walter Schatt dort bei seinem ersten Besuch spontan eine solche Maschine gestiftet. Diesem Startschuss folgte Hilfestellung für eine ganze Reihe von Projekten, etwa für den Umbau einer Wohngruppe, den Kauf eines Kleinbusses für die Jugendwohngruppe in Edling oder für die CD-Produktion des ABM-Orchesters. Immer wieder, so auch als Sponsor der Adria-Alpen-Attl-Tour, an der sich drei Mitarbeiter des Unternehmens beteiligt hatten, schaffe Schattdecor Raum für Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung und ermögliche ein inklusives Miteinander. Für Hartl ein klarer Beweis dafür, „dass sich wirtschaftlicher Erfolg und die Übernahme sozialer Verantwortung durchaus miteinander vereinbaren lassen“. All dies sei bei Schattdecor selbstverständlich, was wiederum außergewöhnlich sei.
Von eben diesem Engagement würden regelmäßig auch die Rohrdorfer Vereine profitieren, ergänzte Marianne Keuschnig, Behindertenbeauftragte der Gemeinde und Kreisvorsitzende des VdK, die das Grußwort der Gemeinde überbrachte. Den Anteil derer zu steigern, die keine Berührungsängste haben, liegt dem Vorstandsvorsitzenden Reiner Schulz umso mehr am Herzen, als der Anteil der Menschen mit Handicap – in Deutschland ist dies etwa jeder Achte - trotz medizinischer und technischer Fortschritte nicht sinken werde. „Und das geht am besten, wenn wir mit den Jüngsten anfangen.“
Denn Berührungsängste habe es zweifelsohne gegeben, bestätigte Firmengründer Walter Schatt unumwunden. Eindringlich appellierte er deshalb an die Festgäste, sei es mit oder ohne Behinderung: „Trauen müssen wir uns!“, und meinte damit den Mut, um Hilfe zu bitten, ebenso wie den, den Begriff Inklusion mit Leben zu erfüllen.
Zugleich aber erinnerte er an das schreckliche Kapitel deutscher Geschichte, als viele behinderte Menschen – auch aus Attl - spurlos verschwanden; und er hofft inständig, „dass diese Zeiten nie mehr wiederkommen.“
Dezember 2012
Neubeuern (pil) – Der Termin für den nächsten Bürgerentscheid steht: Am Sonntag, 3. Februar 2013, sind die Neubeurer aufgerufen, ihre Stimme zur Umgestaltung des Oberen Marktplatzes abzugeben. Bei drei Gegenstimmen hatte der Gemeinderat am Dienstag abend das Bürgerbegehren für zulässig erklärt, in dem der Erhalt des Hofwirtsbichl sowie die Nachpflanzung zweier wenigstens zwölf Jahre alter Kastanien gefordert wird. Insgesamt 610 gültige Unterschriften waren hierfür im Rathaus eingegangen, wie Bürgermeister Josef Trost (CSU) vor vollbesetzten Zuhörerreihen bekanntgab.
Dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenzustellen, lehnte das Gremium indes geschlossen ab. Die mögliche Fragestellung im Beschlussvorschlag hatte darauf abgezielt, die aktuelle Planung fortzuführen und dabei die Option für eine eventuelle Nachpflanzung von Bäumen offenzuhalten.
„Wir brauchen eigentlich kein Ratsbegehren.“, brachte es Johann Fritz (Freie Wähler) auf den Punkt. Dennoch entflammte eine Debatte um den Denkmal- beziehungsweise Ensembleschutz, unter dem der Obere Hofwirtsbichl nach Auffassung von Franz Steinkirchner (CSU) stehe. Dr. Michael Gierlinger (SPD) etwa warnte vor einem Ratsbegehren, das eventuell auf falschen Annahmen fuße und gegen Vorschriften verstoße; er riet, zunächst die Hintergründe abzuklären. Konrad Stuffer (CSU) erinnerte unterdessen an die Feinuntersuchung vom Landesamt für Denkmalpflege; darin sei keine Rede davon gewesen, dass sich ein etwaiger Ensembleschutz auf den Bichl erstrecke.
Bereits beim vorangehenden Tagesordnungspunkt, bei der „Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens“, hatte Alois Holzmeier von den Freien Wählern die Notwendigkeit dieses Bürgerbegehrens stark angezweifelt, das die Gemeinde zudem Geld koste; er hält es angesichts der geringen Unterschiede in der Sache – letztlich gehe es mehr oder weniger nur um zwei Bäume sowie um eine Grünfläche, die etwas flacher und größer werden soll oder auch nicht – schlicht für „überzogen“. Eine Auffassung, die sein Fraktionskollege Albert Bauer angesichts der „sehr wohl gravierenden Unterschiede“ gar nicht teilt.
Für Zündstoff sorgte auch die Kostenschätzung, welche die Bürgerinitiative vorgelegt hatte, und derzufolge sich der Umbau bei einem Erhalt des Hofwirtsbichl mit 90.000 Euro bewerkstelligen lasse. In dieser Aufstellung fehlten einige wichtige Posten, monierte Johann Schmid (Freie Wähler) mit Nachdruck: „Das ist nur eine grobe Schätzung, die man so nicht stehen lassen kann!“. Auch die Berechnung von Städteplaner Klaus Immich sei nur eine Schätzung, hielt Franz Steinkirchner dagegen. Für großen Unmut am Ratstisch sorgten dabei die Beifallsbekundungen aus dem Zuhörerraum; der Bürgermeister drohte sogar damit, den Saal räumen zu lassen, sollten diese nicht unterbleiben.
Derweil wolle die Bürgerinitiative eine mindestens zwölf Jahre alte Kastanie stiften, sollte der Hofwirtsbichl erhalten bleiben, wie Trost mitteilte. Von einem klärenden Gespräch am Runden Tisch mit einem Mediator im Vorfeld der Sitzung hatten die Initiatoren der Unterschriftensammlung jedoch abgesehen. „Gespräche und Verhandlungen waren von unserer Seite vor dem Bürgerbegehren gewünscht, während eines laufenden Bürgerbegehrens ist dies nicht möglich.“, schreiben Claus Hähle, Alois Heibl und Georg Scherer dazu auf der neu eingerichteten Homepage www.buergernaehe-neubeuern.de.
E ndgültig zurückgezogen hat Klaus Spatzier seinen Antrag auf Erhalt des Hofwirtsbichl mit sofortiger Neuanpflanzung von ortsüblichen Bäumen. Zuvor war der Grüne mit einem Antrag zur Geschäftsordnung gescheitert, mit dem er seinen erneut eingebrachten Antrag (vorgesehen als TOP 6) noch vor den Beschluss zum Bürgerbegehren (TOP 2) ziehen wollte. Dies hatte das Gremium mit 5:12 abgelehnt.Spatzier hatte beabsichtigt, seinen Antrag zum Bichl abzuändern und auf die Forderungen der Bürgerinitiative abzustellen. Würde dieser in der neuen Form angenommen, erübrige sich das Bürgerbegehren, begründete er sein Ansinnen. Zu seinem Bedauern sei dieser Brückenschlag zwischen den Fronten nicht zustande gekommen, nahm er abschließend unter Tagesordnungspunkt 6 Stellung. pil |
von Marisa Pilger
Neubeuern – Eine objektiv unmögliche Maßnahme in einem Bürgerbegehren zu fordern, darf nicht sein. Diese Auffassung vertreten sowohl die Rechtsaufsicht im Landratsamt Rosenheim als auch der Bayerische Gemeindetag. Entsprechend fiel am Dienstag der Beschluss im Marktgemeinderat Neubeuern aus: Mit 11 zu 6 Stimmen wurde das Bürgerbegehren zum Erhalt der beiden, am 24. Oktober gefällten, Kastanien sowie des Hofwirtsbichl für rechtlich nicht zulässig erklärt.
Einmal mehr drängten sich die Zuhörer im übervollen Sitzungssaal, wo die Diskussion immer wieder vom eigentlichen Tagesordnungspunkt „Beschluss über die Zulässigkeit“ abschweifte. Mehrfach wurde dabei am Ratstisch aber auch festgestellt, dass beide Seiten in punkto Oberer Marktplatz gar nicht mehr so weit auseinander lägen.
Mit der Fällung der Kastanien, so der Tenor der Schreiben von Rechtsaufsicht und Gemeindetag, erfülle ein Teil der Formulierung – nämlich die Forderung nach dem Erhalt der beiden Bäume – nicht mehr die materiellen Anforderungen eines Bürgerbegehrens. Auch sei es ausgeschlossen, die Fragestellung nachträglich abzuändern, da sich diese im Wesentlichen auf die Bäume beziehe. Zudem sei fraglich, ob diese dann noch das für ein Bürgerbegehren erforderliche Quorum von zehn Prozent erreiche.
Als „wohl einmaligen Sonderfall“ und zugleich als ein „gewaltiges Problem“ bezeichnete Franz Steinkirchner (CSU), Befürworter des Bürgerbegehrens, die Lage, in der sich die Gemeinde nun befinde. Denn mit den Bäumen wurde auch die Grundlage für das Bürgerbegehren beseitigt. „Das hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.“ Gleichwohl liegt nicht nur ihm viel daran, dass wieder Ruhe in der Gemeinde einkehrt.
In chronologischer Abfolge hatte Bürgermeister Josef Trost (CSU) eingangs die Vorgeschichte von der Übergabe der 629 Unterschriften im Rathaus bis zum Eingang der Schreiben aus dem Landratsamt und des Bayerischen Gemeindetags aufgelistet. Über das Ergebnis der rechtlichen Prüfung seien die Vertreter der Bürgerinitiative umgehend informiert worden. Darüber hinaus hatten die Initiatoren des Bürgerbegehrens am 29. Oktober einen Antrag auf Einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht München gestellt, um zu verhindern, dass die Gemeinde am Marktplatz weitere Tatsachen schafft; alle erforderlichen Unterlagen seien daraufhin auch nach München geschickt worden.
Sollte das Bürgerbegehren für nicht zulässig erklärt werden, sei es doch nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Vorstoß – dann mit geänderter Fragestellung für den Erhalt des Hofwirtsbichl, warnte Dr. Michael Gierlinger (SPD). Und dass dieser ebenfalls die notwendigen Unterschriften erhalte, steht auch für Johann Fritz (Freie Wähler) außer Zweifel. Vielmehr, forderte Gierlinger, müssten nun beide Seiten aufeinander zugehen.
Für seinen Vorschlag, Bürgermeister Trost solle sich für sein Vorgehen entschuldigen, erhielt er zwar kräftigen Beifall aus den Zuschauerreihen. Der Rathaus-Chef indes sieht hierfür keinen Anlass und verwies auf den Gemeinderatsbeschluss vom Juli mit dem Auftrag zur Fällung der Bäume.
Trost hatte, wie er später noch anmerkte, die Gemeinderäte, mit einer Ausnahme, von der für den Morgen des 24. Oktober geplanten Aktion bewusst nicht informiert. Diese hatten sich am Vorabend mehrheitlich gegen die Resolution des Initiativkreises „Oberer Marktplatz“ ausgesprochen. „Dann war es für mich klar. Ich wollte ein Ende setzen.“ An der Rechtmäßigkeit der Fällaktion zweifelt indes Albert Bauer (Freie Wähler) nach wie vor.
Wäre es nach Konrad Stuffer (CSU) gegangen, wären die Kastanien am Marktplatz nicht während der Unterschriftensammlung umgeschnitten worden. Was allerdings die Frage nach der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens anbelangt, müsse er sich als juristischer Laie trotz der 629 Unterschriften an den Aussagen der Fachleute orientieren, „auch wenn's moralisch schwer fällt.“
November 2012
Claus Hähle: Der einzige Weg ist ein Bürgerentscheid
Trotz oder gerade wegen der Entscheidung des Gemeinderats gibt Claus Hähle nicht auf. Denn der Mitinitiator des gescheiterten Bürgerbegehrens sieht „keinen anderen Weg als einen Bürgerentscheid.“ Sein Ziel sei es, den Marktplatz so zu erhalten, „wie ihn die Bürger lieben“. Der Vorstoß für ein neues Bürgerbegehren sei deshalb bereits in Arbeit: „Wir bleiben bei unserer Forderung: Der Bürger soll entscheiden dürfen.“ |
Neubeuern (pil) – Die geplante Umgestaltung des Oberen Marktplatzes steht grundsätzlich zwar außer Frage. Jedoch scheiden sich die Geister an den beiden Kastanien, die im Zuge des Umbaus fallen sollen, wie die Beifallsbekundungen bei der Bürgerversammlung gezeigt haben. Angesichts der von 44 Neubeurern unterzeichneten Resolution, die der „Initiativkreis Oberer Marktplatz“ vorgelegt hatte, wird das Thema nun erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt, möglicherweise bereits für die nächste Sitzung am Dienstag, 23. Oktober. Die einstündige Rederunde im vollbesetzten Bürgersaal verlief dabei trotz des thematischen Zündstoffs insgesamt in recht geregelten Bahnen.
Mit drei Forderungen war Alois Heibl, der Sprecher des kürzlich gegründeten Initiativkreises, ans Mikrofon getreten: Eine 3-D-Darstellung auf Grundlage der Detailplanung von Städteplaner Klaus Immich, die Anfang Oktober im Gemeinderat vorgestellt worden ist (Heibl: „eine dürre Skizze“), samt Aufstellung der Umbaukosten; Erhalt der beiden gesunden Kastanienbäume am Hofwirtsbichl, die zu fällen eine sündteure Geldverschwendung bedeute; Erhalt der Parkplätze im Bereich der Bäckerei, des Geschäfts „Inn-Schrift“ und des Reisebüros als Kurzparkzone. Eindringlich ersuchte er die Kommunalpolitiker, die Bäume „auf alle Fälle stehen zu lassen“. Ihm lägen zudem Berechnungen von Fachfirmen vor, denen zufolge sich der Umbau – bei Erhalt des Hofwirtsbichl – mit rund 90.000 Euro bewerkstelligen ließe. Die Gemeindeverwaltung schätzt den Gesamtaufwand derzeit auf rund 250.000 Euro; aus dem Topf der Städtebauförderung hofft man auf einen Zuschuss von etwa 90.000 Euro.
Vehement prangerte Heibl außerdem die „verheerende Informationspolitik“ von Bürgermeister Josef Trost an, sowie den Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 11. September, die trotz des riesigen Besucherandrangs nicht in den Bürgersaal verlegt worden war. Immerhin sei der Marktplatz das „Herzstück“ des Dorfes und entsprechend groß das Interesse der Bürger. Heibl: „Hier wäre eine Informationsveranstaltung angesagt gewesen.“
Ein Vorwurf, den der Gemeindechef mit Nachdruck zurückwies: „Die Öffentlichkeit wurde immer eingeschaltet.“, hatte er bereits in seinem Rechenschaftsbericht betont und dabei auch die Notwendigkeit unterstrichen, die beiden Kastanien zu fällen. Auch wisse er die 550 Unterschriften für den Erhalt der Kastanien durchaus zu werten. Einblick in einen Marktplatz ohne die beiden Bäume hatte derweil ein retuschiertes Foto in der Beamer-Präsentation gegeben; wobei, wie Trost betonte, durchaus neue Bäume nachgepflanzt werden könnten. Auch blieben die Parkplätze im Bereich Bäckerei/ Schreibstube bestehen.
Die Art und Weise der allgemeinen Diskussion um den Umbau des Marktplatzes allerdings - „Eine Diskussion, die ich mir anders vorgestellt habe.“ - stößt dem Bürgermeister sehr sauer auf. „Das gefällt mir nicht.“, rief er seine Mitbürger zu einer sachlichen Auseinandersetzung auf. Zumal die schlechte Stimmung dem Image der Gemeinde schade.
Ganz energisch verwahrte er sich außerdem gegen Beschuldigungen, er spräche Drohungen gegen Bürger aus oder setze diese unter Druck. So habe er im Telefonat mit einer jungen Frau - anders als von deren Großvater bei der Versammlung geschildert – dieser nicht gedroht. Die Frau hatte Trosts Ausführungen zufolge in Facebook gepostet, die Kastanien müssten Parkplätzen weichen; er habe auf einer Entfernung dieser Falschmeldung bestanden und dabei auch rechtliche Schritte nicht ausgeschlossen, für den Fall, dass dies nicht geschehe.
Waren die Redner fast durchwegs um eine sachliche Atmosphäre bemüht, erntete doch Dr. Rainer Pawelke, „Arzt für das Leben und Retter für die Natur“, Buhruhe und Kopfschütteln, als er Josef Trost, einem leidenschaftlichen Laien-Theaterspieler, vielsagend „schauspielerische Talente“ bescheinigte. Und sollte man sich „für die Macht des Geldes, gegen die Natur“ entscheiden, stellte er Neubeuern in Aussicht, ein „weiteres Bürgerbegehren erleben zu dürfen“. Wohingegen sich Dr. Josef Mager, als Replik auf seinen Vorredner nach eigenen Worten „bloß Dorfdoktor“ und als solcher seit 1985 in Neubeuern ansässig, klar für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Ortes aussprach. Auf dem „Marktplatz der Eitelkeiten“ gehe es für manche doch gar nicht mehr um die zwei Bäume, sondern um Stimmungsmache gegen den Bürgermeister. Die Umgestaltung ohne Bäume hält er für „logisch und richtig“ und wünscht sich deshalb, „dass der Gemeinderat zu seinem Beschluss steht“.
Ebenso hat Dr. Hermann Hiemer wenig Verständnis für die teils durch die Berichterstattung in den Medien geförderte „künstliche Aufgeregtheit“. Stattdessen forderte er mehr Besonnenheit, mehr Vertrauen und mehr Respekt den gewählten Gemeinderäten gegenüber. „Die große Mehrheit steht hinter dem Gemeinderat.“, ist er überzeugt.
Für Alois Heibl unterdessen ist das Thema noch nicht beendet, wie er auf Anfrage erklärte. Bevor er aber weitere Schritte unternimmt, wolle er auf jeden Fall das Ergebnis der kommenden Sitzung abwarten.
Oktober 2012
zum Bericht
von Marisa Pilger
Wurmsdorf/ Riedering - „Einsetzen, einsetzen, einsetzen.“ Der Arbeitsauftrag ist klar umrissen: Heute wird auf dem Acker in Wurmsdorf (Gemeinde Riedering) Weißkraut, Blaukraut und Sellerie gepflanzt. Wenigstens 40 Hände packen voller Elan mit an, heben Kisten vom Bulldog-Anhänger, graben Pflanzlöcher und stecken im strömenden Regen Setzling um Setzling in die Erde. Das Miteinander wird hier, auf dem „Lebenfeld Jaksch“ großgeschrieben, wo Erzeuger und Verbraucher eins sind. Denn alles Gemüse und alle Früchte, die der Boden hergibt, werden nach der Ernte unter den „Produzenten“ aufgeteilt.
 |
| An die 70 Seminar-Teilnehmer begleitet Hubert Jaksch (vorne rechts) in diesem Jahr beim Anbauen und Ernten auf seinem „Lebensfeld“ in Wurmsdorf. Auf seinem Acker kommen dabei ausschließlich samenfeste Pflanzen in den Boden, die sich vermehren lassen und auch in den folgenden Jahren Erträge bringen. Foto: Pilger |
Zunächst waren es zwei Familien, die die Gelegenheit nutzten, eigenverantwortlich aber unter fachkundiger Anleitung ihr eigenes Gemüse anzubauen; im Jahr drauf kamen schon 32 Teilnehmer. In diesem Jahr zählt das Seminar (Kostenpunkt: 210 Euro, plus 80 Euro für die Ernte) an die 70 Interessierte, die auf dem „Lebensfeld“ zusammen kommen, um gemeinsam zu graben und zu hacken, und nicht zuletzt um zu lernen.
Es war der „sinnlose Konkurrenzkampf in der Lebensmittelproduktion“ und der daraus resultierende Einsatz von leistungsfähigen Hybridpflanzen, welche aber nur im ersten Jahr prächtige Erträge liefern, die Jaksch nach 25 Jahren als Biobauer mit einem sechs Hektar großen Hof an einen Scheidepunkt brachten; und zum Wunsch, nach alternativen, zukunftsgerichteten Lebensformen zu suchen, um drohenden Engpässen bei der Lebensmittelversorgung Paroli bieten zu können. „Im jetzigen Kontroll- und Konkurrenzsystem hat die Leistungskapazität der Landwirte ihre Belastungsgrenze erreicht. Der Verbraucher ist also auf die Sicherheit eines Kontrollsystems angewiesen, das schon längst an seine Grenzen stößt. Weitere Produktionssteigerungen und zusätzliche Kontrollen bieten keine Lösungen.“, warnt der Gemüsebauer auf seiner Homepage www.hubertjaksch.de. Und Patente auf Gemüsesorten und Saatgut hält er schlichtweg für „ein Unding“.
Mit dem „Lebensfeld“ und dem Umstieg auf samenfeste regionale Pflanzen - von Radieserl über Broccoli, Salat, Mangold und Gelbe Rüben bis hin zu Rahnen, Kartoffeln und Zwiebeln - brachte Jaksch schließlich sein „Projekt“ für ein gemeinschaftliches Kreislaufwirtschaften auf den Weg, bei dem er altes und neues Wissen mit bewährten Systemen verknüpft. Seine Erfahrungen – nicht nur was den Ackerbau anbelangt - weiterzugeben ist dem 60jährigen, der selbst ständig dazu lernt, ein großes Anliegen; wobei Bodenständigkeit im besten Wortsinn einen zentralen Punkt seiner Lebensphilosophie darstellt. So widmet er sich in seinen Vorträgen der Herstellung von Sauerkraut ebenso wie der Milchverarbeitung zur Selbstversorgung und energieunabhängigen Lagermöglichkeiten für Lebensmittel. Außerdem will er im Rahmen eines weiteren Seminars den Bau eines Holzbackofens in Angriff nehmen.
Mit der Einführung von Terra preta (portugiesisch für „Schwarze Erde“) hat Jaksch nach der Abkehr zunächst vom konventionellen und dann vom intensiven biologischen Landbau samt Selbstvermarktung vor drei Jahren eine weitere Neuerung auf seinem Hof vorgenommen. Für den fruchtbaren Boden – mit der Mischung aus Holzkohle, Dung und Kompost trieben beispielsweise frühe Indianervölker im Amazonasbecken Ackerbau - seien weder Pflug noch Egge nötig, erklärt Jaksch; der Anbau auf den äußerst nährstoffhaltigen Terra-Preta-Hügeln sei sehr ertragreich und die Früchte zudem sehr gesund.
Auch für die „Neu-Bauern“ ist das „Lebensfeld“ wesentlich mehr als nur eine Produktionsstätte. „In schöner Atmosphäre gemeinsam etwas produzieren.“, steht hier im Vordergrund – für den Banker wie für den Elektroingenieur, für den Maschinenbauer wie für die Hausfrau, für den Arzt wie für den Vertriebsmitarbeiter. Wenngleich der Hagelschlag im vergangenen Jahr große Teile der Ernte vernichtet hatte. Mit wenigen Worten bringt etwa der selbstständige Handelsvertreter, der auf der Suche nach der „Grünen Kiste“ in Wurmsdorf hängengeblieben ist, die Wirkung des gemeinschaftlichen Arbeitens mit wenigen Worten auf den Punkt: „Das macht nicht nur Spaß, das macht Freude.“
Juni 2012
Rosenheim (pil) – Der eklatante Fachkräftemangel in der Region stellt Betriebe wie Hochschulen vor neue Herausforderungen. So rückt der Doppelpack Studium/ Praxis als Bildungskonzept mehr und mehr in den Vordergrund, wenn es darum geht, frühzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte zu rekrutieren und auch für künftige Führungspositionen an das Unternehmen zu binden. Mit einer neuen Kooperationsvereinbarung haben deshalb die Hochschule Rosenheim und die IHK für München und Oberbayern ihre Zusammenarbeit beim sogenannten Verbundstudium – parallel zum regulären Hochschulstudium umfasst es eine komplette Berufsausbildung inklusive Vergütung - bekräftigt.
 |
| „Historisches Ereignis“ an der Hochschule Rosenheim: Präsident Professor Heinrich Köster (links) und Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, bei der Unterzeichnung des neuen Kooperationsvertrages zum Verbundstudium. Foto: Pilger |
„Der Wettbewerb um die klugen Köpfe verschärft sich kontinuierlich.“, mahnte Driessen eindringlich. Bereits jetzt habe einer Umfrage der Bayerischen Industrie- und Handelskammern zufolge jedes zweite Unternehmen Probleme bei der Besetzung offener Stellen; und der IHK-Fachkräftemonitor prognostiziere eine weitere Verschärfung der Situation bis zum Jahr 2020.
In Rosenheim ist derzeit die Kombination Ausbildung/ Studium in zehn verschiedenen Bachelor-Studiengängen der Fakultäten Betriebswirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Informatik sowie Holztechnik und Bau möglich. Die neue Vereinbarung – entsprechende Verträge bestehen bereits mit den Hochschulen in München und Ingolstadt – stellt das Verbundstudienmodell für IHK-Ausbildungsberufe nun auch hier auf einheitliche Füße; das Aushandeln von Einzelkooperationen ist damit passé. Nach einer zwölfmonatigen Ausbildungsphase im Betrieb setzt am 1. Oktober des Folgejahres das Studium ein, skizzierte Vizepräsident Professor Dr. Eckhard Lachmann die Grundzüge des Verbundstudiums, von dem sich Hochschule wie IHK kräftige Impulse für die Region versprechen. Ausbildungsphasen im Betrieb und Studienzeiten wechseln sich bis zum Ende der Ausbildung ab; ebenso steht nach der IHK-Abschlussprüfung eine weitere praktische Tätigkeit im Betrieb bis zum Abschluss des Studiums an.
Klare Regelungen reduzieren nicht nur den Verwaltungsaufwand sondern erleichtern auch die Akquise dual Studierender erheblich, sind sich die Vertreter von Hochschule und IHK einig. Dadurch könnten nun auch kleinere und mittlere Unternehmen ganz einfach in die Kooperation einsteigen und zugleich den Wissenstransfer mit der Hochschule ausbauen. Über die Einhaltung der Qualitätsstandards wacht die Dachorganisation „hochschule dual“, ein Zusammenschluss der bayerischen Hochschulen und Bildungspartner der bayerischen Wirtschaft.
Eine geeignete und anspruchsvolle Aufgabe für die studierenden Auszubildenden zu finden, hält beispielsweise Anton Kufer für eine der großen Herausforderungen an die Betriebe. Der Diplom-Informatiker und Geschäftsführer der Kubus Software GmbH in Mühldorf spricht dabei aus Erfahrung; er beschäftigt neben mehreren Auszubildenden seit dem Wintersemester 2008/ 2009 auch zwei Dual-Studenten für Informatik und weiß daher, dass deren Praxisphasen genau geplant sein wollen. Auch habe man anfangs die Anforderungen seitens der Berufsschule unterschätzt, was in seinem Betrieb schließlich durch den Einsatz von Tutoren abgefedert wurde. Hier wären bessere Unterlagen von der IHK hilfreich gewesen.
„Das ist kein Studium light.“, warnt Kufer vor falschen Vorstellungen. Die Anforderungen im Verbundstudium, an dessen Ende zwei vollwertige Abschlüsse stehen, seien deutlich höher als „nur“ bei Lehre oder Studium. Entsprechend setzt er bei seinen Bewerbern eine Eins vor dem Komma im Abiturzeugnis voraus.
Ohne Frage erfordere der straffe Zeitplan ein hohes Maß an Disziplin und Leistungsbereitschaft, bestätigt Nicole Stanek. Parallel zum Informatikstudium (momentan im 6. Semester) hat die junge Frau bereits ihre Ausbildung zur Fachinformatikerin bei der Firma Hexal in Holzkirchen abgeschlossen. Der Berufsschulstoff wurde in wöchentlichen Präsentationen im Betrieb aufbereitet. Und an ihren vorlesungsfreien Tagen stand regelmäßig Büffeln statt Badesee auf dem Programm. „Das war kein Spaziergang.“, meint sie rückblickend, zumal manche Prüfungstermine nicht aufeinander abgestimmt gewesen seien. Doch die Belastung hat sich ausgezahlt. Einen festen Arbeitsvertrag hat sie jedenfalls bereits in der Tasche.
Mai 2012
von Marisa Pilger
 |
| Mit Metall wollte Kushtrim Isufi eigentlich schon immer arbeiten. Seine Ausbildung zum Industriemechaniker, Fachrichtung Dreh- und Frästechnik, hat er bei der Firma Ano-Pro in Ostermünchen gemeistert. Fotos: Pilger |
Nach seiner Lehre im Hotel zur Post in Rohrdorf will der 20jährige Jonathan Lacroix nun eine Saison im Ausland arbeiten und dann den Meistertitel in Angriff nehmen. Nicht weniger erfolgreich hat Kushtrim Isufi (25) den Start ins Berufsleben gemeistert: Der Hauptschulabsolvent holte zunächst an der Volkshochschule den Quali nach. Inzwischen leitet der Industriemechaniker die Produktionsabteilung bei Ano-Pro in Ostermünchen, einem Betrieb für anodische Prozessoptimierung, und will später vielleicht den Industriemeister draufsatteln.
Ganz leicht sei der Weg allerdings nicht gewesen, räumt der gebürtige Kosovo-Albaner unumwunden ein, der schon seit seiner Kindheit in Deutschland lebt. Zwischenzeitlich ließ er die Arbeit schleifen und fiel zum Schluss einmal durch die theoretische Prüfung. Dass Kushtrim Isufi dennoch der richtige Mann am richtigen Platz ist, davon ist nicht nur Manfred Ingelsberger angesichts dessen Leistungen im Betrieb fest überzeugt.
Dem Inhaber der früheren Firma Ti-Tech ist es ohnehin ein wahres Herzensanliegen, jungen Leuten mit schwierigem sozialen Hintergrund eine Chance zu geben. „Doch mit jedem geht’s nicht“, weiß er nur zu gut aus seiner sechsjährigen Erfahrung als Ausbilder. Um so größer ist die Freude bei Alexander Halle-Krahl, dass sein „Schützling“ dank der intensiven Unterstützung im Betrieb seinen Weg gemacht hat.
Ingelsberger hatte den jungen Mann nach einem einwöchigen Probelauf im Juli 2007 als Azubi in seine damalige Firma Ti-Tech aufgenommen, die inzwischen im Unternehmen Ano-Pro unter der Leitung seines Sohnes Alexander aufgegangen ist. Ein ums andere Mal hatte Kushtrim mit seinem Chef Freitag nachmittags den Berufsschulstoff wiederholt. Die Ingelsbergers wiederum standen laufend in engem Kontakt mit der Berufsschule und mit Alexander Halle-Krahl, der auch für die Lehrlinge eine wichtige Anlaufstelle ist.
 |
| Jonathan Lacroix war für Hotelchefin Theresa Albrecht-Stocker (zweite von rechts) ein wahrer Glücksgriff. Zum Gesellenbrief gratulierten auch Alexander Halle-Krahl und „Pro Arbeit“-Geschäftsführerin Claudia Georgii. |
Wie in dem Rohrdorfer Traditionsbetrieb ist man auch in Ostermünchen dringend auf qualifizierte Nachwuchskräfte angewiesen. So sucht Manfred Ingelsberger neue Lehrlinge im Bereich Industriemechaniker – und rät angehenden Schulabgängern im Vorfeld der Berufswahl vor allem eines: „Praktika in möglichst vielen Bereich machen“. Ohnehin würde er sich wünschen, dass die Praxis während der Ausbildung stärker gewichtet werde.„Learning by doing – auch durch Fehler“, lautet seine Devise.
Das Engagement von „Pro Arbeit“, frisch zertifizierter Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung, schätzt auch Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer: Anstelle von Geschenken wünschte sie sich zu ihrem 60. Geburtstag ausschließlich Spenden für den Verein, der sich seit nunmehr 15 Jahren für benachteiligte junge Menschen einsetzt.
Mai 2012
von Marisa Pilger
Samerberg – Bei den ersten Buchstaben sind die meisten noch mit Feuereifer dabei; und Mi-mi und An-na sind anfangs gern gesehene Begleiter. Doch schon bald, nämlich wenn es daran geht, halbseitige Texte zu lesen, deren Inhalt zu erfassen und wiederzugeben, fühlen sich immer mehr Abc-Schützen überfordert; sie verlieren den Anschluss und den Spaß an der Freude und steigen demotiviert aus.
„Lesen braucht Übung, und Übung braucht Zeit“, bringt Birgit Schreiber das Hauptproblem auf den Punkt, mit dem ihrer Ansicht nach Lehrer wie Schüler zu kämpfen haben. Mit ihren selbst entwickelten Lesetrainern will die frühere Lehrerin deshalb Leseneulingen Trainingsmaterial an die Hand geben, damit Gedrucktes nicht zu einem Buch mit sieben Siegeln gerät. Vier Jahrzehnte lang hat sie unter anderem in München, Neubeuern und Raubling Grund- und Hauptschüler unterrichtet und weiß daher, dass man den Schwächen möglichst früh zu Leibe rücken muss, sollen wertvolle Ressourcen nicht unwiederbringlich verloren gehen.
 |
| Sieben Teile umfasst der Lesetrainer von Birgit Schreiber mittlerweile. Darüber hinaus hat die pensionierte Lehrerin einen Mathetrainer für Vorschulkinder aufgelegt und gemeinsam mit ihren Kolleginnen Cornelia Schöllhammer und Ortrud Essling Tests für die Klassen eins bis sechs entwickelt, um etwaige Lücken in Deutsch und Mathe aufzudecken. Foto: Pilger |
Vom Ordnen von Purzelwörtern über das orthografisch korrekte Schreiben mit dem Bilderalphabet und Nachschriftübungen bis hin zur Textanalyse auf Viertklassniveau reicht die Palette an Aufgabenstellungen. Was jeweils zu tun ist, muss dabei buchstäblich erlesen werden; denn gilt es das eine Mal, das gesuchte Wort rot zu umfahren, muss es das andere Mal blau unterstrichen werden oder grün angekreuzt. Schreiber: „Eine kontrollierbare Lesehausaufgabe also“.
Vier auf einander aufbauende Übungsbände sowie einen Rechtschreibtrainer inklusive Lösungsteil zur Lernkontrolle hatte die Pädagogin und leidenschaftliche Leseratte zunächst mit Unterstützung ihrer Kollegin Lilo Fegg-Czermin zusammengestellt und auch im Unterricht, sowohl im Förder- als auch im Forderbereich, eingesetzt. „Mit Erfolg“, wie sie erfreut betont. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lernhilfen verzichtet der „Lesetrainer“ dabei ganz bewusst auf bunte Abbildungen und farbige Illustrationen. „Das lenkt nur ab.“
Dass diese Hefte allein aber nicht ausreichen, hat Schreiber ihre fünfjährige Tätigkeit als mobile Bereichslehrerin für Zirkus- und Schaustellerkinder gelehrt. An insgesamt 85 Schulen zwischen Miesbach und Altötting war sie während dieser Zeit im Einsatz und stieß selbst bei größeren Kindern immer wieder auf massive Schwierigkeiten beim Umgang mit den Buchstaben. Also hat Schreiber in ihrem Arbeitszimmer am Samerberg zwei zusätzliche Arbeitshefte für den allerersten Einstieg in die Welt der Buchstaben konzipiert, die ebenfalls über die Buchhandlung Bensegger in Rosenheim oder übers Internet bezogen werden können.
Auch Analphabeten könnten von diesen fibel- und altersunabhängigen Hilfestellungen profitieren, merkt Schreiber auf ihrer Homepage www.der-lesetrainer.de ergänzend an. Denn der Ausspruch des mehrfach preisgekrönten Schriftstellers und examinierten Volksschullehrers James Krüss (1926-1997), aus dessen Feder unter anderem „Timm Thaler“ und „Der wohltemperierte Leierkasten“ stammen, hat durchaus auch für die Älteren seine Gültigkeit: „Das Lesen, Kinder, macht Vergnügen, vorausgesetzt, dass man es kann..“.
April 2012
von Marisa Pilger
Rosenheim – Er lauert immer und überall, greift gerne tief in die Trickkiste, und am liebsten futtert er gute Vorsätze. Des Menschen treuesten Wegbegleiter, den eigenen inneren Schweinehund, nun aber mit Stumpf und Stil ausrotten zu wollen, hätte fatale Folgen, meint Dr. Marco Freiherr von Münchhausen. „Schließlich ist er ein Teil Ihrer Persönlichkeit.“ Gleichwohl gehöre er an die lange Leine genommen, damit der Speicher tatsächlich am Wochenende entrümpelt wird, die geplante Diät nicht schon am zweiten Tag wieder vom Tisch ist und die Steuererklärung fristgerecht beim Finanzamt eingeht.
 |
| In einem unterhaltsamen Vortrag brachte Dr. Marco Freiherr von Münchhausen seinen Zuhörern beim Unternehmertag der Wirtschaftsjunioren Rosenheim „Strategien effektiver Selbstmotivation“ näher. Foto: pil |
Endlich abnehmen, das Rauchen aufgeben, ein unangenehmes Telefonat erledigen, mal wieder einen Tanzkurs machen oder mit dem Rad anstatt mit dem Auto ins Büro fahren – wo gute Vorsätze sprießen, ist auch der innere Schweinehund nicht weit. Vor allem, wenn es darum geht, mit alten Gewohnheiten aufzuräumen, trete der „tierische“ Saboteur flugs in Aktion und serviere verlockende Ausreden, führte der promovierte Jurist (Jahrgang 1956) auf Einladung der Wirtschaftsjunioren, der IHK-Geschäftsstelle und der Hochschule seinen Zuhörern im vollbesetzten Audimax vor Augen. „Je intelligenter der Mensch, umso raffinierter die Ausreden seines Schweinehundes.“, warnte er.
Und schon würden wichtige Entscheidung endlos aufgeschoben oder Veränderungen gar nicht erst in Angriff genommen – kurz, der gute Vorsatz über Bord geworfen.
Um jedoch seinem Gegenspieler erfolgreich Paroli bieten zu können, müsse man sich zunächst seine eigenen Schwachstellen bewusst machen und dürfe dabei auch seine Stärken nicht vergessen, konstatierte der Träger des Conga Award 2007 und 2010. Er riet den rund 300 Unternehmern und Führungskräften, immer nur eine neue Sache anzugehen und sich das selbst gesteckte Ziel möglichst präzise und bildhaft vor Augen zu führen. Ebenso gab er dem Auditorium drei an sich simple Wettkampf-Regeln mit auf den Weg. Erstens: „Schweinehunde-Angelegenheiten haben Vorfahrt“; nicht die Mails, die angeblich erst noch abgearbeitet werden müssen, oder die Telefonate, oder... Zweitens: „Den Anfang so leicht wie möglich machen“; also nicht als Dauerlauf-Neuling mit der Zehn-Kilometer-Distanz beginnen. Und drittens: „Keine Ausnahmen in der Anfangsphase“; denn auch der Widersacher liege nicht auf der faulen Haut und ziehe nur zu gerne seinen Trumpf, den Schweinehund-Dreisatz, aus dem Ärmel, der da lautet: „Ausfallen lassen. Schleifen lassen. Sein lassen.“ Erst nach sechs bis acht Wochen sei eine neue, täglich wiederkehrende Aktivität fest im Tagesgeschehen verankert; bei einer sich wöchentlich wiederholenden Tätigkeit dauere dies etwa ein halbes Jahr. Die Kunst sei, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen persönlichen Fähigkeiten und Herausforderung zu finden. So werde man sich weder über- noch unterfordern; „und wenn's gut tut, macht auch der innere Schweinehund mit“.
Und der habe durchaus auch seine guten Seiten, gab von Münchhausen außerdem zu Bedenken. Schließlich bewahre er sein „Herrchen“ davor, sich kontinuierlich zu überarbeiten. Nur einlassen müsse man sich auf diese „inneren Boxenstopps“, auf das „Chillen“, wie es von Münchhausens Teenager-Tochter so gerne bezeichne. „Sich immer wieder neu fordern, ohne sich dabei zu überfordern“, lautet denn auch sein Credo für ein friedliches Miteinander von Mensch und „Tier“.
März 2012
|
Kinder klöpfeln für Kinder
Samerberger Mädchen und Buben spenden 400 Euro an Björn-Schulz-Stiftung
 Sogar bei Wind und Wetter waren sie losgezogen, die Mädchen und Buben vom Kinderchor des Trachtenvereins Samerberg. An drei Donnerstagen im Advent hatten sie den alten Brauch des Klöpfelns nach Törwang und Grainbach gebracht – und konnten jetzt der Björn-Schulz-Stiftung stolze 400 Euro vorab ins Osternest legen. Traudi (vorne rechts) und Peter Vordermaier aus Hetzenbichl stocken den Betrag noch um 225 Euro aus den Erlösen ihrer Weihnachtslesungen auf.
Sogar bei Wind und Wetter waren sie losgezogen, die Mädchen und Buben vom Kinderchor des Trachtenvereins Samerberg. An drei Donnerstagen im Advent hatten sie den alten Brauch des Klöpfelns nach Törwang und Grainbach gebracht – und konnten jetzt der Björn-Schulz-Stiftung stolze 400 Euro vorab ins Osternest legen. Traudi (vorne rechts) und Peter Vordermaier aus Hetzenbichl stocken den Betrag noch um 225 Euro aus den Erlösen ihrer Weihnachtslesungen auf.Hoch erfreut nahm Angelika Lorenz (hinten rechts) auch die kleinen Präsente entgegen, die die Samerberger Kinder außerdem zusammengetragen hatten. Als kleines Dankeschön sprach sie schon jetzt eine Einladung zum nächsten Familienfest auf dem Irmengard-Hof in Gstadt am Chiemsee aus. Text/ Foto: Pilger März 2012 |
Rosenheim - Le bois, das Holz - das ist ihr Element. Und dank eines Tips in ihrem Holzpraktikum verschlug es die Bauingenieurin Marie-Laure Divoux dann nach Rosenheim. Denn seit 2008 verbindet die Innstadt mit der Berner Fachhochschule für Architektur, Holz und Bau in Biel eine Kooperation für den internationalen Masterstudiengang Holztechnik. Insgesamt 20 Studenten aus zehn Ländern – neben Frankreich, Deutschland und der Schweiz sind dies der Iran, Italien, Kroatien, Österreich, Portugal, Slowenien und Zypern - konnte Studiendekan Professor Frieder Scholz im Oktober zu dem Studiengang begrüßen, der seit dem Wintersemester auch auf Englisch angeboten wird. Zwanzig Studenten, die „fit gemacht werden für die Holzbranche in einer globalisierten Arbeitswelt“, wie es Dr. Heiko Thömen, Leiter des Masterstudiengangs an der Berner Fachhochschule, in einer Pressemitteilung formuliert hat.
Mittlerweile sind die Prüfungen des ersten Semesters geschrieben. Und für die Französin und die Hälfte ihrer Studiengruppe steht der Umzug nach Biel im Schweizer Kanton Bern an.
 |
| Holz ist ihr Element: Marie-Laure Divoux hat sich auf dem Campus der Hochschule Rosenheim sehr wohlgefühlt. Jetzt steht der Umzug nach Biel an. Foto: Pilger |
Vor zwei Jahren dann fasste sie den Entschluss, noch einmal auf einem anderen Gebiet durchzustarten. Nach einem „bilan de compétences“, einer persönlichen und beruflichen Standortbestimmung, ähnlich einer Weiterbildungsberatung, fiel schließlich die Entscheidung, sich in Grenoble zu immatrikulieren. Bereits seit Juli hat die Mutter eines 17jährigen Sohnes den Master für Bauingenieurwesen in der Tasche, und fürs Frühjahr 2013 hat sie den Abschluss in Holztechnik im Visier.
Die sprachliche Herausforderung sieht Marie-Laure Divoux weniger in der Unterrichtssprache Englisch. Vielmehr sei von dem Deutsch, das sie als Schülerin gelernt hat, nicht viel übrig geblieben. Eine große Motivation, sich trotzdem für einige Monate „en Allemagne“ niederzulassen, seien vor allem ihre beiden Neffen gewesen, die zweisprachig aufwachsen. Und der Mut hat sich ausgezahlt. Wenn sie aber von ihren Plänen und Visionen erzählt, verfällt die ehrgeizige Französin unweigerlich in ihre Muttersprache. Etwa wenn sie von den Niedrigenergiebauten im öffentlichen Raum mit nachhaltigen Rohstoffen spricht, die sie während ihres Holzpraktikums bei der in Frankreich renommierten Kooperative Gaujard Technologies hautnah erlebt hat.
Ihr Alter – mit ihren 44 Jahren führt sie gemeinsam mit einem Kommilitonen in ihrem Studienjahrgang das Feld an - empfindet die Studentin dabei keineswegs als hinderlich; eher im Gegenteil. So hat sie schon in ihren früheren Studien gelernt, methodisch zu arbeiten und exakt zu formulieren. „Hier sind die Jungen noch gefordert.“ Und in Deutschland, muss sie zu ihrer Verwunderung immer wieder feststellen, „haben viele Angst vor Mathe“. Auch hier sieht sie den Vorteil ihrer naturwissenschaftlichen Bildung. Und dass sie sich mit drei anderen Frauen in einer Männerdomäne bewegt, ist sie von Frankreich her schon gewohnt.
Ebenso bereitet der angehenden Doppel-Masterabsolventin die bevorstehende Jobsuche als etwas älteres Semester kein allzu großes Kopfzerbrechen. „45 ist okay.“, meint sie; mit 50 wäre es sicher schwieriger.
Die Entscheidung nochmals zu studieren hat ihr Leben zwar komplett umgekrempelt; bereut hat sie Marie-Laure Divoux dennoch nicht. Und ihr Sohn scheint mächtig stolz auf seine Mutter zu sein, die nochmal im Hörsaal sitzt – und ihm zeigt, wie interessant ein Studium sein kann.
Februar 2012
|
Oberwöhrer Landfrauen spenden Erlös aus Törggelen-Fest
|
Raubling (pil) – „Ich hab' ein echtes Reh gesehen!“ Die blondgelockte Annemarie (4) ist ganz außer Atem vor Aufregung. Auch die neunjährige Hannah und ihre vier Jahre jüngeren Kameraden Paula, Kilian und Sean freuen sich riesig über den scheuen Besucher im Waldcamp Sonnenholz – und sind schon wieder verschwunden zum Versteck spielen. Hier, auf dem Pferdehof zwischen Reischenhart und Brannenburg, hat die Soziale Verhaltenswissenschaftlerin Alexandra Gschwendtner vor drei Jahren ein Ferienprogramm gestartet, dessen Konzept im Grunde genommen ebenso einfach wie selbstverständlich erscheint: Kinder einfach in der freien Natur spielen lassen – was diese wiederum sichtlich auskosten.
 |
| Einfach draußen spielen: Das fehlt nach Ansicht von Familienwissenschaftlerin Alexandra Gschwendtner (Zweite von links) heutzutage den Kindern am meisten. Im Waldcamp und im Rahmen von Einzelprojekten können Mädchen und Buben im Sonnenholz die Schönheit der Natur spielerisch und mit allen Sinnen erleben. Foto: pil |
Hinter dem ganzheitlich angelegten Projekt verbirgt sich jedoch mehr als „nur“ spielen und mittags Nudeln mit Tomatensauce verdrücken. Vielmehr liegt Alexandra Gschwendtner am Herzen, dass ihre Schützlinge die Schönheit der Natur mit möglichst allen Sinnen erleben; damit will sie Phantasie und Forschergeist anregen und zugleich Sozialverhalten, Motorik und Konzentrationsfähigkeit der Kinder verbessern: Aus Naturmaterialien entstehen kunstvolle Collagen; glitzernde Tautropfen auf Farnblättern erweisen sich als faszinierende Beobachtungsobjekte; und der Waldboden bietet reichlich „Geruchs-Stoffe“.
Ausgebildete Erzieherinnen begleiten die Waldcamp-Kinder auf ihren Streifzügen, ohne sie ständig in die Schranken zu weisen. Gschwendtner: „Dadurch gewinnen die Kinder Selbstvertrauen und übernehmen ganz automatisch auch Verantwortung.“ So nehmen die Älteren in der Gruppe die Kleineren unter ihre Fittiche und geben beispielsweise Hilfestellung beim Balancieren und Klettern. Besorgten Eltern nimmt derweil die dreifache Mutter die Angst: „Abgesehen von ein paar Schrammen ist hier noch nie etwas passiert.“
Mehr Infos gibt’s unter www.sonnenholz-waldcamp.de.
August 2011
Thansau/ Rosenheim (pil) – Eine Teilzeitlehre für eine schwangere Auszubildende; flexible Arbeitszeiten, die vor allem die Belange von Müttern berücksichtigen; ein zusätzliches monatliches Kindergeld - Momentaufnahmen aus familienfreundlichen Unternehmen, die die CSU-Kreisverbände Rosenheim Stadt und Land nun mit der erstmaligen Verleihung des Familienlöwen ins Rampenlicht gerückt haben. Insgesamt vier Betriebe aus der Region erhielten bei einer Feierstunde im Foyer der Firma Schattdecor aus der Hand der Bayerischen Familienministerin Christine Haderthauer den neugeschaffenen Preis, der das besondere Engagement um familienfreundliche Arbeitsbedingungen würdigt. Neben dem Café Vivarium in Höslwang und der Metzgerei Maier in Rosenheim/Aising wurde die Salus Haus GmbH mit Sitz in Bruckmühl prämiert; der Sonderpreis Innovation ging an die Steelcase Werndl AG (Kolbermoor), die in ihrem „Elder Care“-Projekt das Thema Pflege aufgreift.
Der demographische Wandel verändert die Arbeitswelt tiefgreifend, Fachkräfte sind rar, immer mehr junge Menschen wandern in Großstädte ab, viele Firmen auf dem Land suchen bereits händeringend nach qualifiziertem Personal; so umrissen die beiden Kreisvorsitzenden, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und der Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner, eingangs die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wobei die Entscheidung von Berufseinsteigern für einen Arbeitgeber zahlreichen Studien zufolge längst nicht mehr allein vom Gehalt abhänge sondern vorrangig von einer familienfreundlichen Personalpolitik.
Diesen Herausforderungen trügen zwar bereits eine ganze Reihe von Betrieben im Raum Rosenheim Rechnung, doch liefen diese Bemühungen meist ohne Beachtung der Öffentlichkeit ab. Mit dem Familienlöwen für kleine (bis zehn Mitarbeiter) und mittelgroße Unternehmen (zehn bis 100 Mitarbeiter) sowie für große Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern wollen die CSU-Verbände Rosenheim Stadt und Land deshalb ganz gezielt auf besonders gelungene Projekte und kreative Programme in Sachen Familienfreundlichkeit aufmerksam machen, die letztlich zur wirtschaftlichen Stärkung der mittelständisch geprägten Region beitrügen.
Aus insgesamt 16 Vorschlägen aus Reihen der Parteimitglieder hatte eine 14köpfige Jury – besetzt mit sieben CSU-Mitgliedern und ebenso vielen externen Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft - die Preisträger ermittelt. Dabei erfülle der Quader aus Acrylglas, hinterlegt mit der Zeichnung eines Löwen und dem farbigen Abdruck einer Kinderhand, gleich drei Funktionen: Er demonstriere, dass Familienfreundlichkeit keine Frage der Betriebsgröße sei, zeige unterschiedlichste Umsetzungsmöglichkeiten auf und wolle nicht zuletzt Mut machen, „es täglich neu zu versuchen“, so Stöttner.
Ein klares Bekenntnis zu Rahmenbedingungen, die es ermöglichen „den Lebensentwurf Familie mit Freude zu leben“, formulierte auch Staatsministerin Haderthauer in ihrer Rede. „Der Standortfaktor der Zukunft ist die Familienfreundlichkeit.“, warb sie vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft für ein Umdenken und für neue Arbeitsmodelle, die insbesondere jungen Eltern echte Perspektiven böten. Beispielsweise dürfe die Entscheidung für eine Elternzeit nicht wie ein Damoklesschwert über dem beruflichen Fortkommen schweben. Zumal Mitarbeiter erfahrungsgemäß deutlich gestärkt aus der Erziehungszeit zurückkehrten, was etwa Krisen-, Zeit- und Selfmanagement anbelangt.
Die CSU habe sich den Notwendigkeiten des gesellschaftlichen Wandels angepasst und richte sich an den geänderten Bedürfnissen der Bürger in punkto außerfamiliärer Kinderbetreuung aus. „Doch mit Krippen allein ist es nicht getan.“, mahnte die Landespolitikerin die Verantwortung der Institution Familie an und warnte davor, die Bedürfnisse der Kleinen, der künftigen Fachkräfte, zu vernachlässigen. „Kinder sind kein Störfaktor, der wegorganisiert werden muss.“
Zwischen Unternehmern und Politikern entspann sich im Anschluss an die Preisverleihung zu den Klängen des Blechbläserquintetts Esbrassivo ein reger Gedankenaustausch.
Juli 2011
Die Preisträger
pil |
Rosenheim (pil) – Sie sind allesamt Rentner; jeder einzelne von ihnen blickt auf eine jahrzehntelange Tätigkeit in Führungsetagen namhafter Unternehmen zurück und hat eigentlich längst den vielzitierten wohlverdienten Ruhestand angetreten. Gleichwohl stehen die 14 „Aktiven Wirtschaftssenioren“ (AWS) nach wie vor, oder auch wieder, voll im Berufsleben und greifen angehenden Unternehmern ebenso wie alteingesessenen Betrieben, Behörden und anderen Dienstleistern in der Region zum Nulltarif beratend unter die Arme.
Allein über die monatlichen Sprechstunden im Landratsamt seien bereits an die 1000 Kontakte zustande gekommen, fasst die Vorsitzende Edeltraut Hinkel den Bedarf an professioneller Unterstützung beispielsweise bei Firmengründungen, bei der Nachfolgeplanung oder bei drohender Insolvenz in Zahlen.
Entsprechend würdigt Landrat Josef Neiderhell den Verein anlässlich dessen fünfjährigen Bestehens als einen „unverzichtbaren Teil im weiten Beratungsnetzwerk im Raum Rosenheim“, der fraglos zum Wohle des Wirtschaftsraums Rosenheim beitrage.
Rund 250 Beratungen und Betreuungen verbucht das „Unternehmen“ Aktive Wirtschaftssenioren im Jahr; lediglich für die Verwaltung des Vereins und die notwendigen Versicherungen ist eine Gebühr zu zahlen, sowie die Auslagen der Berater für Fahrt- oder Telefonkosten.
In der Geschäftsstelle in Hinkels Haus in Großkarolinenfeld klingelt oft schon frühmorgens das Telefon. Von dort aus koordiniert die ehemalige Führungskraft in einem japanischen Konzern, die einzige Frau in der AWS-Runde, die Aufgabenverteilung.
 |
| „Aktiven Wirtschaftssenioren“ wie die Vorsitzende Edeltraut Hinkel und Vize Josef Kugler geben ihr Wissen unabhängig und ehrenamtlich an Geschäftsleute weiter. Neben zehn Beratern in und um Rosenheim sind zudem vier Ruheständler im Raum Ebersberg im Einsatz. Foto: pil |
Die Ratsuchenden – Ärzte ebenso wie Handwerker oder Einzelhändler – profitieren von den Netzwerken, welche die „alten Hasen“ im Laufe ihrer Berufstätigkeit geknüpft haben; etwa zur Wirtschaftsförderung im Landratsamt, zur Agentur für Arbeit, zu Handwerks- und Industrie- und Handelskammer sowie zu Banken, Juristen und Steuerberatern. Hinzu kommt jahrzehntelange Erfahrung mal 14, was unterm Strich ein enormes Wissen um Abläufe, Risiken und Chancen in den verschiedensten Bereichen des wirtschaftlichen Lebens ergibt.
„Unser Name steht für Qualität.“, unterstreicht Josef Kugler seinen Anspruch und den all seiner Kollegen, nur Vorhaben mit Hand und Fuß und mit einer realistischen Aussicht auf Erfolg zu unterstützen. Dass sich die Projekte der AWS nicht auf die freie Wirtschaft beschränken, zeige das Beispiel des Bauhofs in Großkarolinenfeld: Im Auftrag der Gemeinde wurden dort sämtliche Arbeitsabläufe unter die Lupe genommen und optimiert.
Durchschnittlich sechsmal in der Woche ist Kugler, früher Leiter eines Einkaufszentrums, in seiner Eigenschaft als Wirtschaftssenior im Einsatz, wobei die Zahl der Insolvenzberatungen und -begleitungen im Zuge der Wirtschaftskrise deutlich angestiegen sei. Doch könne ein dickes Minus auf dem Geschäftskonto auch ganz andere Gründe haben. „Oft sind diese Betriebe gar nicht pleite, sondern haben sehr viele Außenstände.“ Denn nach wie vor fristeten Fakturierung und Mahnwesen in so manchem Handwerksbetrieb ein stiefmütterliches Dasein. Rechnungen an die Kunden würden oftmals erst nach Wochen oder Monaten geschrieben, während die Lieferanten ihr Geld rasch einforderten.
Mit Beratung allein ist es für die rührigen Senioren indes nicht getan. Denn sie müssen ihrerseits stets auf dem neuesten Stand sein, was beispielsweise Verordnungen oder Förderrichtlinien anbelangt.
Zwei bis drei „Neue“ würden Hinkel und Kugler gerne noch in den Beraterkreis aufnehmen. „Aber das ist nichts zum Geld verdienen.“, beugen sie von vorne herein falschen Vorstellungen vor. Denn der Gewinn der ehrenamtlichen Berater misst sich allein am Nutzen für den Auftraggeber.
Juli 2011
Sprechstunden der AWS
Jeden ersten Donnerstag im Monat bieten die Aktiven Wirtschaftssenioren eine kostenlose, vertrauliche Sprechstunde im Landratsamt Rosenheim an, bei der sie ihr Wissen allen Unternehmern aus sämtlichen Branchen honorarfrei zur Verfügung stellen. Eine Voranmeldung ist notwendig im Landratsamt unter Telefon 08031/392-3203. |
 |
| Abstoßend realistisch: Als Highlight der Präventionswoche hatte die Sicherheitsgemeinschaft Inntal den Kabarettisten Eisi Gulp mit seinem Programm „Hackedicht oder was?“ engagiert |
 |
| Slalomfahrt mit gefühlten 1,5 Promille: Insgesamt sieben Stationen mussten die Schüler mit der Rauschbrille auf dem Parcours der Kreisjugendarbeit bewältigen, was nicht immer ein einfaches Unterfangen war. Fotos: Pilger |
Eines legte der durchtrainierte 55jährige den Schülern im Verlauf der zweistündigen Veranstaltung immer wieder eindringlich ans Herz, ganz gleich ob es ums Saufen, Rauchen, Kiffen oder Koksen geht: „Die Birne einschalten“, anstatt dem Gruppendruck nachzugeben und gedankenlos in der Masse mitzuschwimmen.
Bei seinem erbarmungslosen Rundumschlag nahm der Wahl-Rosenheimer insbesondere die gesellschaftlich anerkannte und allgemein praktizierte Doppelmoral in Sachen legale/illegale Drogen ins Visier, die auch fürs bayerische Grundnahrungsmittel gilt. Mit ausdrucksvoller Pantomime demonstrierte er knallhart und abstoßend realistisch die Folgen eines Exzesses mit der legalen (!) Droge Alkohol, torkelte mit stierem Blick und aus dem Hosenlatz lugendem Hemdzipfel über die Bühne, lallte unverständliche Satzfetzen in die Luft und kotzte sich zu guter Letzt, über dem „weißen Porzellanaltar“ hängend, die Seele aus dem Leib.
Von Verboten hält Eisi Gulp - nach eigenem Bekunden in Sachen Drogen früher selbst kein unbeschriebenes Blatt - allerdings wenig und gab den Zuhörern seine Devise mit auf den Weg: „Mach alles, trink alles, iss alles, was du willst. Aber immer nur die Hälfte davon.“

|
| Schulterschluss in Sachen Suchtprävention: Die Schulsozialarbeiterinnen der Inntal-Hauptschulen mit Vertretern der Sicherheitsgemeinschaft Inntal unter dem Vorsitz von Olaf Kalsperger (Vierter von links). |
Wo hört der Genuss auf, und wo beginnt die Abhängigkeit? Ist der, der nicht mittrinkt, zwangsläufig ein Außenseiter? Und geht Spaß haben ohne Alkohol überhaupt? Fragen, mit der sich beispielsweise die achten Klassen in Neubeuern auseinandersetzten, wo mit Neon „Voll die Party“ abging: Statt Bier, Wodka und Limes gab's beim Würfelspiel an der Theke kleine rote Kunststoffchips für fast alle; wer Pech hatte, musste einige Zeit im Krankenhaus aussetzen und verpasste die Happy Hour, und wer offiziell nicht „mitzechen“ durfte, suchte Wege, um das „Barpersonal“ auszutricksen und trotzdem an die Plastikplättchen zu kommen – sprich Spaß zu haben - oder langweilte sich. Wie nahe an der bisweilen traurigen Realität das lustige Rollenspiel letztlich war, wurde so manchem in der anschließenden Gesprächsrunde klar.
Vom „Mc Healthy Frühstücksmenü“ bis zur Aktion „Rauchzeichen“, von der Internetrallye bis zum Rauschparcours reichte das Spektrum der zahlreichen Aktionen. In Bad Feilnbach etwa erarbeitete eine siebte Klasse Verbesserungsvorschläge für Plakate der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); darüber hinaus wurden überall Stellwände für eine Wanderausstellung gestaltet, die in jeder der fünf Schulen Station machen wird.
Mit der Drogenpräventionswoche konnte die Sicherheitsgemeinschaft Inntal, ein Zusammenschluss von Bürgern, Institutionen, Polizeibeamten und Gemeinden, zur Freude des Vorsitzenden, Raublings Bürgermeister Olaf Kalsperger, einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Jugendschutzes leisten. Und geht es nach den Schulsozialarbeitern, wird es – auch im Hinblick auf die künftigen Schulverbünde – wohl nicht die letzte Gemeinschaftsaktion gewesen sein.
Mai 2011
|
Neubeuern (pil) – Mit seiner Halbzeitbilanz als Landrat ist Josef Neiderhell (CSU) eigentlich ganz zufrieden; denn es hat sich einiges getan seit seinem Amtsantritt im Jahr 2008, als die Konjunktur noch gut lief, die bayerische Staatsregierung unter Ministerpräsident Günther Beckstein „leichte Schwächen zeigte“ und das desaströse Ergebnis bei den Landtagswahlen im September den Christsozialen eine Koalition mit den Liberalen abverlangte: Der Ausbau des schnellen Internet läuft landkreisweit auf Hochtouren; die Sanierung der in die Jahre gekommenen Berufsschulen I in Rosenheim und in Bad Aibling wurde in Angriff genommen; und dank der Umstrukturierungen auf dem Klinik-Sektor im Schulterschluss mit der Stadt Rosenheim wandern die Patienten nicht mehr in andere Regionen ab.
Was den Landkreis-Chef allerdings ganz gewaltig wurmt, ist die Haltung des Bundesverkehrsministeriums im Hinblick auf die Zulaufstrecke für den Brenner-Basistunnel. In den 18 Jahren, seit denen das Thema auf dem Tisch liege, „ist nichts vorwärtsgegangen“, ärgert sich Neiderhell, der zwölf Jahre lang der Inntalgemeinde Raubling als Bürgermeister vorgestanden hatte. Von einer Planung sei man noch meilenweit entfernt – während in Tirol die Bauarbeiten bereits in vollem Gange sind.
 |
| „Bei uns geht es um die Sache, nicht um Parteizugehörigkeit.“ Neubeuerns CSU-Bürgermeister Josef Trost (links) zog ebenfalls eine kurze Zwischenbilanz. Im Fokus standen und stehen hier die Themen Kinder, Jugend und Senioren; aber auch die Dorfentwicklung mit der Einführung der Marke „Kulturdorf Neubeuern“ hat die gemeindliche Arbeit stark geprägt. Ortsvorsitzender Martin Fritz (rechts) gab Landrat Josef Neiderhell noch einen Korb voller Spezialitäten aus dem Ort mit auf den Weg. Foto: pil |
„Man sollte sich freuen, wenn sich ein Betrieb ansiedeln will.“, formulierte er das Interesse des Kreises an neuen Gewerbeansiedlungen; schließlich „muss der Landrat schauen, dass etwas vorwärtsgeht“. Doch sinnvoll müsse die Ansiedlung schon sein, ergänzte Neiderhell - ein Attribut, das dem umstrittenen Aventura-Projekt in Kiefersfelden spätestens seit dem Ausstieg der insolventen Firma Kneissl fehle. „Was haben wir davon, wenn wir ein Outlet in die Landschaft klatschen?“; zumal dieses Vorhaben etablierte Einzelhändler in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährde.
Große Bedeutung misst der Landrat dem Tourismusverband Chiemsee-Alpenland bei, für den zu seiner Freude neben sämtlichen 46 Landkreisgemeinden auch die Stadt Rosenheim ins Boot geholt werden konnte. Schließlich mache das Tourismusgeschäft einen großen Brocken an den insgesamt 64.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Landkreis aus. Derzeit arbeite man daran, dass die Unterkünfte in der Region künftig von Kfz-Navigationsgeräten angezeigt werden.
Auch Zahlen zur Haushaltslage (Gesamtvolumen rund 240 Millionen Euro; derzeitiger Schuldenstand etwa 100 Millionen Euro, wofür jährlich 11,5 Millionen an Zins und Tilgung fällig sind) sowie zum Arbeitsmarkt (drei Prozent Arbeitslosenquote) lieferte der Referent, verwies auf die Erfolge des Patenprojekts „Jugend in Arbeit“ und berichtete von teils recht derben Reaktionen seitens verschiedener Bürgerinitiativen auf den Planungsdialog zum Autobahn-Ausbau.
Angesichts des Ansturms auf die Realschulen brach der gelernte Hauptschullehrer eine Lanze für „seine“ Schulart. „Ein Drittel sollte schon auf der Hauptschule bleiben.“, unterstrich er den Stellenwert einer fundierten praxisorientierten Ausbildung in den künftigen Mittelschulverbünden für die heimische Wirtschaft und erntete spontanen Applaus von seinen rund 70 Zuhörern beim Dorfwirt Vornberger. Nicht umsonst ziehe es immer mehr Unternehmen, die vor Jahren ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagert hatten, wieder in die Region mit ihren hochqualifizierten Facharbeitern zurück. Entsprechend stelle sich der Landkreis mit der 60-Millionen-Euro-Investition für die Modernisierung der Berufsschulen auch auf diesem Sektor neu auf. „Da schaffen wir etwas für die Zukunft.“
Ebenso habe man für die Erneuerung von schadhaften Abschnitten der insgesamt 360 Kilometer Kreisstraßen und damit für die Verbesserung der Verkehrssicherheit in den vergangenen Jahren erhebliche Finanzmittel bereitgestellt.
Mai 2011
von Marisa Pilger
Samerberg – Es ist diese grenzenlose Freiheit ohne vorgegebene Wege und Abzweigungen, die sie immer und immer wieder in die Luft gehen lässt. Ewa Wisnierska, eine der besten Gleitschirmfliegerinnen der Welt, packt die Faszination, die dieser Sport zwischen Himmel und Erde auf sie ausübt, sehr anschaulich in nur wenige Worte. Für die zierliche blonde Frau mit dem sympathischen Lachen ist das „die einfachste Art, ohne fremde Hilfe, nur mit einem Stück Stoff, in Dimensionen vorzudringen, die nur wenigen vorbehalten sind.“
 |
| Eine Siegprämie um jeden Preis - Das ist für Ewa Wisnierska Vergangenheit. Nach Jahren der Wettkämpfe entdeckt die Weltklassefliegerin für sich die Faszination des Fliegens neu. |
Knapp 23 war die gebürtige Polin, als sie das erste Mal Gleitschirmflieger sah; gebannt bestaunte sie die Piloten mit ihren bunten Schirmen, die mithilfe einer Schleppwinde in die Luft stiegen, sich mit der Thermik weiter in die Höhe schraubten – und dann einfach wegflogen. Bis zu Wisnierskas Jungfernflug von der Emberger Alm in Kärnten sollten allerdings – vor allem des Geldes wegen - noch einige Jahre vergehen; denn eigentlich wollte die in Polen ausgebildete Veterinärmedizinerin, die unter anderem einige Zeit ein Kulturcafé in Hamburg betrieb, ja studieren, erst Photographie, später Psychologie. Dann aber kam ein Gespräch mit ihrem Bruder dazwischen, der ihr von seinem Gleitschirmkurs erzählte und damit ihr bisheriges Leben vollkommen umkrempelte....
Wenig später, im September 2000, hat Ewa den A-Schein in der Tasche mit dem festen Ziel: „Ich will Fluglehrerin werden.“ Was folgt, ist ein nahezu kometenhafter Steilflug, der sie binnen kürzester Zeit an die Weltspitze katapultiert. Über jedem Kontinent auf dem Erdball fliegt sie in den kommenden Jahren der Konkurrenz – oft auch den Männern – davon. Um Geld zu sparen, campiert sie sogar drei Jahre lang in einem Auto.
Längst ist die Fliegerei zum alleinigen Lebensinhalt geworden; doch gleichzeitig wächst der Druck, um jeden Preis den überlebenswichtigen Siegprämien nachzujagen - und den Erwartungen gerecht zu werden, die andere aber vor allem Ewa selbst an sich stellt: Die Ausnahmesportlerin verliert gewissermaßen die Bodenhaftung. Die Entscheidung über Starten oder am Boden bleiben, über Abbrechen oder Weiterfliegen überlässt sie nur zu gerne den Wettkampfleitern; selbst wenn diese trotz widriger Wetterbedingungen das Rennen freigeben. Zweifel und Bedenken schiebt sie mit aller Macht in den Hintergrund.
 |
| Heute genießt sie die Ruhe in ihrer neuen Heimat am Samerberg und betreibt eine Flugschule. Fotos: privat |
Sehr offen erzählt Ewa Wisnierska vom harten Weg, sich die eigenen Schwächen einzugestehen, das Nein-Sagen zu lernen, selbst die Verantwortung fürs eigene Handeln zu übernehmen - und die Vorsätze auch konsequent in die Tat umzusetzen. Nur wenige Wochen nach ihrem letzten schweren Unfall zieht Ewa zum ersten Mal die Reißleine, sagt wegen schlechter Witterung einen Flug ab und ist darauf noch heute stolz: „Dieses Gefühl war überwältigend, besser als ein erster Platz.“
Statt der Logos von Sponsoren trägt sie nun einen Sinnspruch von Mahatma Gandhi in die Lüfte: „Be the change you wish to see in the world“. Und nicht selten ist sie jetzt bei Wettkämpfen die erste, die wegen einer gefährlichen Wetterlage „die Ohren anlegt“ und damit indirekt auch für die Konkurrenz – zu deren Erleichterung - den Startschuss zur vorzeitigen Landung gibt. Für Ewa alias „Birdy“, für die sich mit dem EM-Titel 2008 und dem Ausstieg aus der WM 2009 das Kapitel Wettkampffliegen schließt, hat Sicherheit inzwischen uneingeschränkt Vorfahrt.
Am Samerberg - die Hochries mit dem Startplatz im Rücken, die Landewiese gleich hinterm Haus – entdeckt sie nun für sich die Faszination des Fliegens neu, nimmt den Wechsel der Jahreszeiten wieder bewusst wahr und schätzt die Vögel als ihre liebsten Begleiter. Auch ist es dem ehemaligen Mitglied der Nationalmannschaft ein Anliegen, ihren Erfahrungsschatz in Gruppenseminaren und Einzel-Coachings an andere weiterzugeben. Wobei vieles, was beim Fliegen zählt, etwa was Selbstvertrauen und -motivation, den Umgang mit heiklen Situationen oder taktisches Handeln angeht, auch in anderen Lebensbereichen seine Gültigkeit habe. Mit ihrer Flugschule organisiert Ewa Wisnierska außerdem Kulturreisen nach Nepal, bei denen sich längst nicht alles ums Gleitschirmfliegen dreht.
Zugleich hat ihr „neues“ Leben eine starke soziale Komponente: Unter anderem eröffnet sie in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation „Karuna“ mit Gleitschirm-Schnuppertagen Berliner Straßenkindern neue Horizonte.
Mai 2011
Kolbermoor/München (pil) – Seine Schullaufbahn hat Christopher Gack im Schnelldurchlauf absolviert. Bereits in der Grundschule sparte er zwei Jahre, kam als Achtjähriger aufs Gymnasium, rückte von der siebten direkt in die neunte Klasse auf und legte ein Abitur mit Notendurchschnitt 1,4 hin. Dabei hat der 16jährige, der jüngste Abiturient, den das Karolinen-Gymnasium in Rosenheim je hatte, „noch nie ernstzunehmend gelernt“; höchstens mal einen halben Tag vor den Abschlussprüfungen.
„Doch da werde ich mich wohl umstellen müssen.“, glaubt er. Denn seit voriger Woche studiert der Kolbermoorer Physik an der Technischen Universität München (TUM) und will dort im Rahmen des Projekts „Two in One“ bis zum Herbst die ersten beiden Semester durchziehen, um im Winterhalbjahr gleich ins dritte Fachsemester einzusteigen.
Schon im Kindergarten konnte der Sohn eines selbständigen Kaufmanns und einer Diplom-Betriebswirtin lesen und schreiben. Dementsprechend langweilte sich der Bub in der ersten Klasse recht schnell und wechselte zum Halbjahr in die Zweite. Das gleiche Spiel wiederholte sich in der dritten Klasse; und noch heute ist Christopher dem damaligen Schulleiter der Kolbermoorer Grundschule, Joachim Laxy, dankbar, der den Sprung in die Übertrittsklasse ermöglicht hatte.
Eineinhalb Jahre pendelte Gack dann nach München ans Asam-Gymnasium, wo damals eine Pilotklasse fürs G8 eingerichtet worden war. Mit der landesweiten Einführung des achtjährigen Gymnasium wechselte er schließlich ans Karolinen-Gymnasium – und landete wegen des Sprungs in die neunte Klasse doch wieder im G9.
Anders als in der Grundschule spielte der Altersunterschied im Gymnasium zu seinen mehrere Jahre älteren Klassenkameraden kaum ein Rolle. Manche hätten sich anfangs zwar gewundert, aber „irgendwann war das ganz normal.“
Für seine Steilkarriere hat der stets freundliche, eher schüchtern wirkende junge Mann eine ganz einfache Erklärung: „Ich kann mir sehr viel sehr gut merken.“ Und wenngleich ihm eigentlich alle Fächer gefallen haben, war sein Favorit von jeher die Mathematik. Doch schien ihm ein Physik-Studium sinnvoller; wobei er diesem möglicherweise den Master in einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach hinterherschicken will.
Pünktlich zum Semesterbeginn hat der frischgebackene Student auch eine eigene Bude in Giesing bezogen - in einem Alter, in dem viele nicht einmal ein Spiegelei zu braten oder eine Kaffeemaschine zu bedienen wissen. Indes stellt der eigene Hausstand für den ungewöhnlich begabten Jugendlichen, der wie viele seiner Altersgenossen mit Vorliebe in Fantasy-Romanen und Thrillern schmökert und sich am Computer durchaus auch mit „sinnlosen Dingen“ beschäftigt, kein Problem dar: "Die Selbstverwaltung werde ich schon hinbekommen. Außerdem koche ich ganz gerne." Dass er an der Uni mit Abstand der Jüngste ist, macht ihm ebenfalls nichts aus: "Es ist schon ein bisschen komisch, aber ich lerne hier ja ständig neue Leute kennen."
Doch auch seiner Schwächen ist sich der 16jährige durchaus bewusst: „Ich bin manchmal vielleicht etwas zu pedantisch.“
Mai 2011
Rosenheim (pil) - „Leuchtet's oder leuchtet's nicht?“ Das war die Gretchenfrage beim „girls go tech“-Tag an der Hochschule Rosenheim, die im Rahmen des Berufsorientierungsprojekts „Girls' Day“ neun Workshops aus verschiedenen technischen Fachbereichen auf die Beine gestellt hatte. Entsprechend waren die 14 Teilnehmerinnen in der „Kleinen Elektronik-Werkstatt“ mit Feuereifer dabei, anhand eines Schaltplans mit Leuchtdioden, Widerständen und einem Schalter eine kleine Ampelanlage zu bauen. Und wenngleich die allermeisten dabei Neuland betraten - von Berührungsängsten in der Arbeit mit Lötkolben und Multimeter war keine Spur.
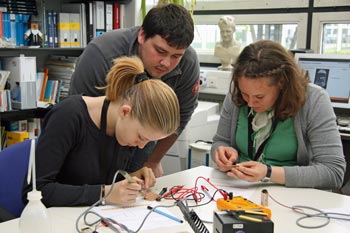 |
| Frauen und Technik – Wie gut das zusammenpassen kann, bewiesen nicht nur Anna-Marie (links) und Katharina beim gestrigen „Girls' Day“ in der Elektronik-Werkstatt der Hochschule Rosenheim. Und wenn's anfangs noch hakte, stand ein Student mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Pilger |
Insgesamt tauchten rund 120 Mädchen aus Rosenheim und der weiteren Umgebung – auch Schulen aus Mühldorf und Traunstein waren auf dem Campus vertreten – in das breite Spektrum technischer Ausbildungsmöglichkeiten ein, versuchten sich im Fräsen, ließen kleine Roboter tanzen, stellten weißes Licht her oder erlebten, was Luft bewegen kann.
Trotz guter Schulbildung entschieden sich Mädchen noch immer häufig für "typisch weibliche" Berufsfelder oder Studienfächer; in Studiengängen wie den Ingenieurwissenschaften oder Informatik seien Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, beschreibt das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. in Bielefeld als Koordinierungsstelle des bundesweiten Projekts die aktuelle Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Den Betrieben aber fehle gerade in den technischen und techniknahen Bereichen zunehmend qualifizierter Nachwuchs. Der „Girls' Day“, an dem seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 insgesamt mehr als eine Million Mädchen teilgenommen haben, will daher gerade diese Berufsfelder verstärkt ins Blickfeld der Schülerinnen rücken und Berührungsängste abbauen.
Ein Weg, den auch die Hochschule Rosenheim bereits seit einigen Jahren mit der Aktion „girls go tech“ beschreitet - und dabei nicht nur in der Elektronik-Werkstatt aufräumt mit dem alten Klischee von wegen „Frauen und Technik“.
April 2011
Rosenheim (pil) – Längst ist das Thema Ausbildung fest in der Unternehmensstrategie der Krones AG verankert. Dass der Weltmarktführer in der Getränkeabfüll- und Verpackungstechnik aber beileibe nicht nur auf graue Theorie setzt, beweist das neue Ausbildungszentrum in der Rosenheimer Niederlassung, das bei der offiziellen Eröffnung von allen Seiten freudig begrüßt wurde.
 |
| Seit 2008 bildet Krones in Rosenheim auch Industriemechaniker aus. Die bislang einzige Frau unter diesen derzeit elf Lehrlingen ist Tanja Mair, hier an der neuen Drehbank im Ausbildungszentrum. Foto: Pilger |
Mit der neuen Abteilung stelle der spezialisierte Maschinen- und Anlagenbauer auch für die Zukunft das hohe Ausbildungsniveau in dem börsennotierten Unternehmen sicher, betonte Werkleiter Dr. Helmut Schwarz vor Mitgliedern der Konzernleitung, zahlreichen Gästen aus dem wirtschaftlichen, politischen und schulischen Leben sowie vor den Eltern der Auszubildenden. Nur so könne der Konzern mit Hauptsitz in Neutraubling (Oberpfalz) und 80 Vertriebs- und Servicestützpunkten rund um den Erdball seine Marktstellung behaupten. Krones - das Unternehmen wurde 1951 gegründet und im Jahr 1980 in die Krones AG Aktiengesellschaft umgewandelt - mit inzwischen weltweit 10.500 Mitarbeitern (mehr als 8000 davon in Deutschland plus 500 Auszubildende) hatte im Krisenjahr 2009 knapp 1,9 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet; die Exportquote lag bei etwa 90 Prozent. Jedes Jahr fließen fünf Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Der Standort Rosenheim, im Jahr 1955 von Kettner gegründet, gehört seit 1997 zur Krones-Familie.
Einblick in die Arbeit am Standort Rosenheim (inklusive der Produktionsstätte in Raubling) mit knapp 1000 Mitarbeitern und 45 Lehrlingen gab Geschäftsbereichsleiter Bruno Schmidt. Bei Krones, einem der größten Arbeitgeber in Rosenheim, werden nach dem Baukastenprinzip aus wenigen Modulen Pack- und Palettiermaschinen für unterschiedlichste Anforderungen gefertigt. Umso mehr freut sich Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer über das „unglaublich starke Signal“, das von der Umgestaltung des Ausbildungszentrums ausgehe.
Auf diese Weise steure das Unternehmen ganz gezielt dem drohenden Fachkräftemangel gegen, unterstrich zudem Gesamtbetriebsratschef und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Werner Schrödl: „Das ist eine Investition in die Zukunft des Konzerns.“ Zumal Krones seinen Nachwuchs bevorzugt aus den eigenen Reihen rekrutiere.
März 2011
 |
| Lachen, gerne auch über sich selbst, ist für Christiane Schmutz die beste Medizin und zugleich ein Stück Lebensphilosophie. Foto: Pilger |
Rohrdorf (pil) – So viel zu lachen wie diesmal gab's wohl noch selten beim Tag der jungen Bäuerinnen und Landfrauen – und das mit gutem Grund: Bestritt doch die Lachtrainerin Christiane Schmutz den Nachmittag des Treffens, zu dem Kreisbäuerin Rosalinde Riepertinger ins Gasthaus zur Post nach Rohrdorf eingeladen hatte. Dabei ist Lachen nicht nur hochgradig ansteckend und trotzdem überaus gesund. Ihre Kurse versteht die Peitingerin zugleich als Beitrag zum Weltfrieden; denn wer lacht, streitet nicht.
Ganz gleich ob echt oder aufgesetzt, Lachen befreit, senkt den Blutdruck, stärkt die Muskeln, reinigt die Bronchien, lindert Schmerzen, nimmt die Angst und macht schön. Es hilft sogar bei niedrigen Milchpreisen und ADHS, merkte Schmutz mit Blick auf den vorangegangenen Vortrag von Anton Flunger an. Der Priener Kinder- und Jugendpsychotherapeut hatte am Vormittag über das Thema „Vom Zappelphilipp zum Tunichtgut, von der Träumerliese zum Hans-guck-in-die-Luft“ referiert. Umso bedauerlicher findet es Schmutz, dass Erwachsene im Schnitt nur noch 20 Mal am Tag lachten, und nicht wie Kinder einige hundert Male.
Mit viel Humor führte die gelernte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin ihr Publikum an eine Reihe von praktischen Übungen, die buchstäblich zum Lachen waren – und fernab von Klamauk. Dass Schmutz mit ihren Auftritten eine Mission in Sachen Lebensfreude erfüllen will, war deutlich spürbar. Einfühlsam ermunterte sie - Mutter eines schwerkranken Kindes - die Frauen im Saal, den Stress über Bord zu werfen, positiv zu denken und die Erfüllung langgehegter Wünsche nicht auf die lange Bank zu schieben. Denn so wenig man über ein mögliches Leben nach dem Tode wisse; soviel stehe bereits fest: Es gibt nur ein einziges davor. Nicht zuletzt aber wachse ein positives Lebensgefühl aus der Wertschätzung der eigenen Person. „Wir haben es in der Hand, wie unser Leben läuft.“
Gut gelaunt und sichtlich entspannt nahmen die Teilnehmerinnen nach gut eineinhalb Stunden Lachseminar schließlich nicht nur viele Denkanstöße und Anregungen mit auf den Heimweg. Auch den Lachvirus, den Schmutz der Runde zum Abschied eingepflanzt hat, will sie auf diese Weise in die Welt tragen lassen. Und spätestens zum Weltlachtag am ersten Sonntag im Mai wird sich dieser an vielen Orten wieder Bahn brechen.
März 2011
Nußdorf – Mit großem Einsatz und vor allem dank des starken Zusammenhalts, den Vorstand Hans Dettendorfer beim 187. Jahrtag eigens lobend erwähnte, haben die Nußdorfer Schiffleut auch im vergangenen Jahr Beachtliches geleistet, um die enge Verbundenheit der Gemeinde mit der Innschifffahrt lebendig zu halten. Insbesondere die Landesgartenschau hatte die Aktivitäten des Traditionsvereins geprägt. So haben die Schiffleut nicht nur ihren Einakter „Wallfahrt ins Elend“ aufgeführt und mit ihrer Sängergruppe Führungen durchs Innmuseum musikalisch umrahmt. Ein bleibendes Zeugnis des Engagements legt seit den Sommermonaten die 200 Meter lange Stahlblech-Silhouette aus dem Atelier von Rudl Endriss ab, die zwischen Innspitz und Innbrücke die Dimension eines Original-Schiffzuges mit Hohenau, Zille, Rössern und Reitern veranschaulicht.
 |
| Seit elf Jahren sind bei den Nußdorfer Schiffleut auch Frauen mit im Boot. Vorne Hanni Dettendorfer, die Frau von Vorstand Hans Dettendorfer. Foto: Pilger |
Entsprechend legte Kassier Leo Dettendorfer den bislang längsten, umsatzstärksten und erfreulichsten Kassenbericht des Vereins vor. Diesem war im vergangenen Jahr die Gemeinnützigkeit zuerkannt worden, was vor allem dem Schatzmeister viel zusätzliche Arbeit beschert hatte. Satzungsgemäß fällt nun der Gemeinde das Vermögen des Vereins zu, sollte dieser aufgelöst werden – was angesichts der zahlreichen Aktivitäten und der Mitgliederzahl von 366 im Moment als recht unwahrscheinlich gilt. Der neue Status verlangte außerdem die Wahl zweier Kassenprüfer; dieses Amt üben Marianne Lengenfeld und Bürgermeister Sepp Oberauer aus.
Doch auch abseits der Landesgartenschau waren im Terminkalender des ältesten der Ortsvereine zahlreiche Veranstaltungen vermerkt, wie der Bericht von Schriftführer Bernhard Oberauer zeigte: die Fronleichnamsprozession, bei der angesichts des starken Windes vor allem die Fahnenträger Hans Straßburger, Josef Dräxl junior und Werner Maurer senior gefordert waren; die Einweihung des Schiffleut-Wanderwegs in Neubeuern; das 333. Patrozinium der Heilig-Kreuz-Kirche in Windshausen; die Beteiligung am Stand „Tradition erleben“ auf der Neuen Messe, der Leonahrdi-Ritt sowie der Ausflug nach Burghausen mit Plättenfahrt auf der Salzach. Erstmals hatten die Schiffleut außerdem im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms eine Kinderfreizeit im und um das Rosenheimer Innmuseum organisiert, die in diesem Jahr wieder aufgelegt wird.
Ohnehin haben sich die Schiffleut für 2011 bereits einiges vorgenommen: Im Gedenken an den 1862 im Inn ertrunkenen Ökonomen und Schiffmeister Josef Dettendorfer soll nahe der Unglücksstelle in Windshausen wieder ein Marterl aufgestellt werden. Und auch beim Jubiläumszug der Rosenheimer Wiesn wollen die Nußdorfer mit ihrem charakteristischen Gwand mit Kniebundhose, Joppe und dem großkrempigen Hut nicht fehlen.
Bei aller Geselligkeit aber fühlt sich der Verein (zum Jahrtag spielten die "4 Hinterberger Musikanten" auf), der 1635 als Sozialkasse der Innschiffer gegründet worden ist, nach wie vor seinem sozialen Auftrag verpflichtet. Nicht nur Hans Dettendorfer ist es ein Anliegen, mit einem Teil des Erlöses aus Festen und anderen Veranstaltungen soziale Einrichtungen zu unterstützen. Zuletzt wurden die örtliche Nachbarschaftshilfe und das Sozialwerk mit je 1000 Euro bedacht; 500 Euro flossen an die Brannenburger Tafel.
Die Bedeutung der Innschifffahrt in vergangenen Jahrhunderten hat indes auch in einem Büchlein mit dem Titel „Handelsweg Inn“aus der Euregio Inntal Schriftenreihe Niederschlag gefunden. Dort zitiert Kreisheimatpfleger Ferdinand Steffan in einem Beitrag den Agrarpolitiker Joseph Ritter von Hazzi mit einigen Sätzen aus dem Jahr 1801, als fast ausschließlich Kalk und Gips auf dem Inn transportiert wurden und die Nußdorfer geradezu eine Monopolstellung innehatten. „Im Sommer gehen die Nußdorfer Männer, wohlerfahrene Schiffleute, auf das Wasser, kehren im Spätherbst mit viel Geld heim, das sie im Winter vertrinken und verspielen.“
Januar 2011
Aus der Not geboren - Die "4 Hinterberger" werden 30
 Kurz vor neun Uhr war es, als Hans Obermeyer der telefonische Hilferuf von Vorstand Hans Dettendorfer erreichte: Die Musikergruppe für den Schiffleut-Jahrtag war kurzfristig ausgefallen. In Windeseile wurde also vor 30 Jahren eine Ersatztruppe zusammengetrommelt – die Geburtsstunde für die „4 Hinterberger Musikanten“ hatte geschlagen. In seiner Not griff Obermeyer seinerzeit für die Erste Stimme zur Basstrompete; und bis heute ist diese damals einmalige Besetzung in Kombination mit Flügelhorn, Tuba und Akkordeon das Markenzeichen der Gruppe, die längst weit über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannt ist. Kurz vor neun Uhr war es, als Hans Obermeyer der telefonische Hilferuf von Vorstand Hans Dettendorfer erreichte: Die Musikergruppe für den Schiffleut-Jahrtag war kurzfristig ausgefallen. In Windeseile wurde also vor 30 Jahren eine Ersatztruppe zusammengetrommelt – die Geburtsstunde für die „4 Hinterberger Musikanten“ hatte geschlagen. In seiner Not griff Obermeyer seinerzeit für die Erste Stimme zur Basstrompete; und bis heute ist diese damals einmalige Besetzung in Kombination mit Flügelhorn, Tuba und Akkordeon das Markenzeichen der Gruppe, die längst weit über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannt ist.Egal ob auf der Chinesischen Mauer, vor dem Weißen Haus, vor der Oper in Sydney, auf dem Roten Platz oder in einem Grünwalder Biergarten – die Hinterberger haben schon in beinahe jedem Eck der Welt aufgespielt. Auf 120 Reisen waren die heimatverbundenen Musiker aus dem Inntal außerdem als Botschafter Bayerns auf den fünf Kontinenten unterwegs – selbstredend in Lederhosen. Den Ton gibt zwar ganz klar die Volksmusik an; doch auch Swing, Schlager und Klassisches haben die „4 Hinterberger“ im Repertoire. Von der Originalbesetzung ist heute neben Hans Obermeyer nur mehr sein Bruder Paul mit von der Partie. Josef Lang und Thomas Oberleitner machen jetzt das Quartett komplett. Zum Jubiläum haben die „Geburtstagskinder“ eine Doppel-CD mit 30 Titeln zusammengestellt, auf der auch der eigens kreierte „Nußdorfer Schiffleitmarsch“ nicht fehlt. Und als Dank an den Geburtshelfer fließen von jeder verkauften Scheibe fünf Euro in die Vereinskasse der Schiffleut, die ihrerseits herzlich zum Runden gratulierten. Text/Foto: pil |
Samerberg (pil)– Jetzt weiß Spätaufsteher Günther Sigl, Frontmann der Spider Murphy Gang, wieder, was Berufsverkehr ist. Und das hat er allein Werner Schmidbauer zu verdanken. Denn fürs BR-„Gipfeltreffen“ auf dem Nußlberg im Inntal musste der Rock'n'Roller in aller Herrgottsfrüh aus den Federn. Anekdoten wie diese rund um die TV-Bergwanderungen mit Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens hatte Moderator Schmidbauer – zusätzlich zu seiner Gitarre - zuhauf im Gepäck, als er in Grainbach sein jüngstes Buch zur „Walk-Show“ präsentierte. Und so ging das Konzept des 49jährigen, bei seiner Lesung „gar nix“ aus seinem „Gipfeltreffen 4“ zu lesen, voll auf.
 |
| Zur Vorstellung von „Gipfeltreffen 4 – Ein Buch zum Nachlesen und Nachgehen“ hatte Werner Schmidbauer neben Anekdoten und Geschichten auch Lieder aus seinem neuen Album „Momentnsammler“ mitgebracht. Foto: Pilger |
Sie würden wohl mehr als einen Abend füllen, die Geschichten vor und abseits der Filmkamera: Als etwa Erzbischof Reinhard Marx mit nagelneuen feuerroten Turnschuhen und blauem Baseball-Cappy zur Tour auf den Herzogstand anrückte und damit am Parkplatz seinen Mitmenschen richtiggehend ins Auge stach. Eigens für den Westfalen wurde sogar ein „öffentlich-rechtlicher Bierbankträger“ engagiert, um dem Kirchenmann bei der Gipfelbrotzeit das Sitzen auf dem Boden zu ersparen.
Oder die ehemalige Skirennläuferin Rosi Mittermaier. Sie musste, TV-Dreh hin oder her, erst einmal dem Seppi, der gerade von einer morgendlichen Mountainbike-Runde angebraust kam, ein Geburtstagsbussi verpassen und legte danach ein wahrhaft atemberaubendes Tempo Richtung Schachen vor.
Nicht zu vergessen die Wanderung mit Schauspieler und Musiker Michael Fitz aufs Feichteck. Um dort frischen Espresso kredenzen zu können, hatte Schmidbauer kurzerhand seinen alten Camping- Gaskocher rausgekramt, Tassen und Zucker in seinen Rucksack gepackt – und auf dem Berg festgestellt, dass kein Mensch Zündhölzer dabei hatte. Dank der Fähigkeiten eines Teamkollegen gab's später aber doch noch Kaffee.
Seit 2003 lädt Schmidbauer, der mit „Live aus dem Alabama“ seine Moderatoren-Karriere begann und sich eigentlich „vom Boa weg“ als Musiker fühlt, nun schon zum „Gipfeltreffen“ im Bayerischen Fernsehen ein. Vor der malerischen Bergkulisse der Voralpen ergäben sich dann oft Gespräche „von erstaunlicher Offenheit und Tiefe“; und längst ist die Sendung für ihn „weit mehr als nur Arbeit“. Die Gesprächsreihe in den Bergen lockt regelmäßig eine halbe Million Zuschauer vor den Bildschirm.
Tiefen Eindruck hat bei Schmidbauer nicht zuletzt die Tour mit Sepp Daxenberger hinterlassen, der mit seiner Krankheit durchaus auch humorvoll ins Gericht gegangen sei. Am 18. August 2010 starb der Grünen-Politiker, dem das jüngste Begleitbuch aus der „Gipfeltreffen“-Reihe gewidmet ist. Es enthält neben Schmidbauers Erlebnissen und Wegbeschreibungen zahlreiche Fotografien und amüsante Details.
In den vergangenen beiden Jahren war Schmidbauer außerdem mit Schlagersängerin Claudia Jung, dem bislang einzigen „Wiederholungstäter“ Anselm Bilgri (der ehemalige Prior von Kloster Andechs marschierte diesmal in Jeans und Karohemd mit), Unternehmer Claus Hipp sowie mit der Kabarettistin Martina Schwarzmann unterwegs. Mit Bergsteiger Reinhold Messner unternahm er in Südtirol einen Ausflug in dessen Kindheit. Und Kabarettistin Monika Gruber erlebte hautnah, dass sie bei den Zuschauern nach wie vor als die „Gruaberin“ geführt wird.
Indes ist für den Moderator die Tradition der Gipfelbrotzeit nicht ohne Folgen geblieben: Nicht von ungefähr wurde Schmidbauer andernorts bereits freudig als der „Fleischpflanzlbrater“ tituliert.
Januar 2011
|
 |
| Zum 50jährigen Bestehen öffnete das Innkraftwerk Rosenheim einen Tag lang seine Pforten für die Öffentlichkeit. Die Einnahmen und Speisen und Getränken flossen an die beteiligten Hilfseinrichtungen. |
Thansau (pil) – Seit nunmehr einem halben Jahrhundert treibt die „Weiße Kohle“, als welche die Wasserkraft einst oft bezeichnet wurde, die drei Kaplanturbinen in der Inn-Staustufe Rosenheim an. Anlässlich seines 50jährigen Bestehens öffnete die Anlage des „Verbund“ im Rohrdorfer Ortsteil Thansau seine Pforten für die Öffentlichkeit; und trotz des anfangs recht durchwachsenen Herbstwetters ließen sich weit mehr als 1000 Interessierte die Gelegenheit nicht entgehen, einen Blick hinter die Kulissen des Kraftwerks zu werfen, das jährlich rund 180 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt – etwa soviel wie 50.000 Haushalte verbrauchen.
 |
| Blick auf die Baustelle: Im März 1957 fiel der Startschuss für die Errichtung der Staustufe. |
Zusätzlich hatte der Gastgeber für ein buntes Rahmenprogramm mit Spielstationen, der Rettungshundestaffel Jettenbach, der Wasserwacht und einem Gewinnspiel gesorgt. Und trotz des recht kühlen, regnerischen Wetters standen auch die Plättenfahrt im Oberwasser der Staustufe hoch im Kurs.
Die Zeit der großen „Korrektionsmaßnahmen“ war für den Inn bereits im 19. Jahrhundert gekommen. Sie dienten neben dem Hochwasserschutz der Schiffbarmachung des Gebirgsflusses, erläuterte Klaus Schöler, Werksgruppenleiter der Verbund Innkraftwerke GmbH, bei seinem Streifzug durch die Geschichte der Inn-Regulierung. Zwischen 1854 und 1858 verkehrten hier sogar Dampfschiffe, wobei die Fahrt von Passau nach Rosenheim immerhin zwei Tage dauerte und flussabwärts lediglich neun Stunden.
 |
| Viel Mechanik ist im Spiel bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft: Hier ein 50 Jahre alter Wehrantrieb. Fotos: Pilger |
Der Startschuss für den Bau des Buchtenkraftwerks mit drei Wehrfeldern und drei Maschinensätzen (35,1 Megawatt Ausbauleistung) fiel schließlich im März 1957; wobei die Staustufe mit einer Fallhöhe von rund neun Metern in zwei Gruben, ohne Umleitung des Inns, errichtet wurde. Zwei Einbrüche von Spundwänden sind während der Bauphase verzeichnet. Das Stauziel – die Wasserspiegelhöhe von 451,30 Meter über Normalnull - war am 6. September 1960 erreicht, und gut zwei Monate später waren alle drei Maschinensätze im Einsatz.
Seither ist das Kraftwerk durch mehrere Unternehmenshände gegangen – von Innwerk über Bayernwerk und Eon bis nunmehr zum Verbund mit Sitz in Österreich. Technischer Fortschritt und Strukturwandel haben dabei auch am Standort Thansau ihre Spuren hinterlassen: Die Fernsteuerung von Töging aus machte in den 90er Jahren den Schichtbetrieb überflüssig. Der Stellenabbau im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes ließ später die Belegschaft auf weniger als die Hälfte schrumpfen.
Die Bedeutung der Staustufe für die Fluss-Regulierung hob auch Bürgermeister Christian Praxl in seinem Grußwort hervor; immerhin ziehe sich der Inn, laut Gemeindechronik einst als „sehr verheerender Fluss“ gefürchtet, auf einer Länge von eineinhalb Kilometern an Thansau entlang. Die Investition von 61 Millionen Mark - der Freistaat Bayern bezuschusste die Hochwasserfreilegung seinerzeit mit zwei Millionen – habe sich seiner Überzeugung nach längst ausgezahlt.
September 2010
von Marisa Pilger
Teurer, unmoderner, unfreundlicher - die Klagen kommen nicht von ungefähr. In Sachen Tourismus hinkt Bayern dem Nachbarn Tirol weit hinterher. Zu einem großen Teil liegt dies an den politischen Rahmenbedingungen und an bürokratischen Hürden. Doch auch die Kultur des Dienens genießt jenseits der Grenze mehr Ansehen.
Was den Erholungswert - mithin die touristische Hardware - angeht, braucht sich das „Produkt“ Bayern vor Tirol wahrlich nicht zu verstecken. Dank Seen, Berge, Königsschlösser und der sprichwörtlichen Gemütlichkeit hat sich der Tourismus im Freistaat – insbesondere im Alpenraum – längst zu einem gewaltigen Wirtschaftszweig entwickelt, der einer Statistik des bayerischen Wirtschaftsministeriums zufolge weit mehr als eine halbe Million Beschäftigte zählt und jährlich gut 24 Milliarden Euro Ausgaben von Urlaubern verbucht.
Doch immer noch mangelt es, anders als im nur einen Steinwurf entfernten Österreich, gewaltig an der Wertschätzung für diese Wachstumsbranche. Deutlich weniger bürokratische Hürden ebenso wie die Förderstrukturen verschaffen den Nachbarn deutliche Wettbewerbsvorteile. Auf deutscher Seite, egal ob zu Füßen des Kaisergebirges, im Inntal, auf dem Samerberg, im Chiemgau oder am Ufer des Chiemsees, sind sich die Touristik-Fachleute jedenfalls einig: Der Tourismus hat in Bayern (fast) keine Lobby; weder in der Bevölkerung noch in der Politik.
„Die echte Gastfreundschaft fehlt.“, muss nicht nur Herbert Reiter, Leiter der Tourist-Info in der Grenzgemeinde Aschau immer wieder feststellen. Entsprechend fallen die Vergleiche aus, wobei der Teufel wie so oft im Detail sitzt: Kinderspielecken in bayerischen Gaststätten sind vielerorten ebenso Mangelware wie mehrsprachige Speisekarten, Bergwanderer suchen hier während des Aufstiegs oft vergeblich nach Ruhebänken, und eine einheitliche Beschilderung von Rad- und Wanderwegen lässt in Bayern immer noch auf sich warten. Doch gerade ein durchgängiges Konzept mit Kombipaketen (z.B. Hotelaufenthalt plus kostenfreie Nutzung von Bussen und ermäßigten Eintritt in Bäder und Museen) macht in den Augen von Reiters Kollegin Margitta Niederhuber, Touristik-Chefin in Nußdorf am Inn, „sehr, sehr viel aus“. So weisen etwa die Nachbarn den Inntalweg-Radlern auf ihrer Tour von Rosenheim nach Passau regelmäßig den Weg zu – österreichischen - Herbergen, während auf deutscher Seite entsprechende Tafeln größtenteils fehlen. Der Urlauber aber macht an der Grenze nicht halt – und der Wettbewerb ebenso wenig...
Bereits im Kindesalter werde jenseits des Schlagbaums mit Schulprojekten die Akzeptanz für das Thema Tourismus geweckt; und auch bei der Fachkräfte-Ausbildung seien die Österreicher noch einen großen Schritt voraus, fügt Ferdinand Reb, Geschäftsführer der Priener Tourismus GmbH, dem Bild ein weiteres Mosaiksteinchen hinzu.
Mit Fremdenzimmern im Stil der 50er Jahre kann kaum ein Betrieb in Grenznähe punkten, wenn nur wenige Kilometer entfernt, für den selben Preis, ein Flachbildfernseher und Internetanschluss geboten werden. Angesichts der hohen Abgabenlast bleibe jedoch vielen heimischen Hotel- und Pensionsbetreibern keine Luft für Modernisierungen. Unterm Strich, ist Werner Schroller, der Chef des „Kaiser-Reichs“, dem touristischen Zusammenschluss der beiden Inntal-Gemeinden Oberaudorf und Kiefersfelden, überzeugt, bleibe bei der Tiroler Konkurrenz einfach mehr in der Kasse. So müsse beispielsweise ein hiesiges 100-Betten-Haus allein an Rundfunkgebühren (GEZ) ein Vielfaches dessen berappen, was ein vergleichbarer Betrieb auf der anderen Seite der Grenze abführe.
Und noch ein Punkt komme den Tirolern immer wieder zugute: Ihre Geschäftstüchtigkeit. Mit dem Paket „Millionensuche“ hatte der Tourismusverband Kufstein beispielsweise prompt auf den Besucherandrang in dem Waldstück bei Ebbs reagiert, in dem die Beute aus der Unterschlagung eines ehemaligen Vermögensberater vermutet wurde.
Bei der Euregio Inntal, einer Informationsplattform der Landkreise Rosenheim und Traunstein, der Stadt Rosenheim und der Tiroler Bezirke Kufstein und Kitzbühel, will man nun Kooperationen zwischen hüben und drüben anschieben. Bereits vor Jahren, bis zur Umstrukturierung in Tirol, hatte beispielsweise die „Grenzenlos“-Gemeinschaft den bayerisch-tirolerischen Brückenschlag in Sachen Vermarktung erfolgreich bewerkstelligt.
Allerdings warnt Samerbergs Bürgermeister Georg Huber vor "zu viel Aktionismus und vor allem vor zu viel Papier". Man solle "nicht zu viele Konzepte entwickeln." Viel mehr setzen die Touristiker auf den direkten Kontakt, auf projektbezogene Zusammenarbeit wie gemeinsame Veranstaltungskalender und Wanderführer und vor allem auf den Erfahrungsaustausch, etwa was die Öffnungszeiten von Bergbahnen anbelangt oder einen ansprechend gedeckten Frühstückstisch. Denn zweifelsohne sei Tirol hier „eine Länge voraus“.
Nachholbedarf aber hat gerade Oberbayern auch auf dem hochsternigen Hotel-Sektor und im Wellness-Bereich. Indes fehlen die Zugpferde in der Region, die „Leuchttürme“, wie es Huber formuliert. „Denn was“, fragt er, „nützt ein Masterplan, wenn sich kein Betreiber findet?“
September 2010
 |
| Im Medical Park in Prien wird gutes Arbeitsklima großgeschrieben: „Pro Arbeit“-Geschäftsführerin Claudia Georgii (rechts) und Ausbildungsvermittler Alexander Halle-Krahl (links) bedankten sich bei Klinikdirektor Otto Praxenthaler und Pflegedienstleiterin Tina Fuchs (Dritte von links) mit Blumen und einem Buch für die langjährige gute Zusammenarbeit; das handgefertigte Präsent stammt aus einer Projektarbeit der – ebenfalls von „Pro Arbeit“ betreuten - Praxisklasse an der Volksschule Fürstätt. Für Esra Demirdag (Dritte von rechts) steht unterdessen auch nach den Abschlussprüfungen zur medizinischen Fachangestellten „Lernen, lernen, lernen“ auf dem Programm, denn sie besucht ab Herbst die Berufsoberschule in München. Währenddessen hat ihre Kollegin Tanja Schlee noch ein Jahr Ausbildung vor sich. Foto: Pilger |
Prien / Rosenheim (pil) – Hauptschulabschluss, Ausbildung, Abitur an der Berufsoberschule, Medizinstudium – Der Weg, den Esra Demirdag eingeschlagen hat, ist beileibe kein Zuckerschlecken. Doch dass die 21jährige, die sich später in der Entwicklungshilfe engagieren will, ihr Ziel auch tatsächlich erreichen kann, traut ihr nicht nur Tina Fuchs zu, die Pflegedienstleiterin im Medical Park Kronprinz in Prien. Dort hat Esra in den vergangenen drei Jahren ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten (früher Arzthelferin) absolviert und wagt nun den Sprung auf die BOS, wo sie ihr Abitur „bauen“ will.
Das erste Etappenziel hat die gebürtige Türkin, die seit 1993 in Deutschland lebt, nicht zuletzt mit der Unterstützung durch den Verein „Pro Arbeit“ erreicht: An der Berufsschule in Bad Aibling, wo sie die JoA-Klasse für Jugendliche ohne Ausbildungsstelle besuchte, vermittelte die dortige Schulsozialarbeiterin das Mädchen zunächst in verschiedene Praktika; darunter in ein Pflegepraktikum in der Fachklinik am Chiemsee, welches schließlich in eine Lehre mündete. Während dieser Zeit hielt Ausbildungsvermittler Alexander Halle-Krahl regelmäßig Kontakt sowohl mit Esra Demirdag als auch mit deren Ausbilder. Dabei ist diese nicht die einzige Schülerin einer JoA-Klasse, die mithilfe von „Pro Arbeit“ einen Ausbildungsvertrag mit der anerkannten Fach- und Rehaklinik für Psychosomatik, Innere Medizin, Naturheilverfahren und Orthopädie unterzeichnen konnte.
Für Pflegedienstleiterin Tina Fuchs jedenfalls steht fest: Zeugnisnoten sind das eine, der persönliche Eindruck während eines längeren Praktikums das andere. Dieser Devise folgend und vor allem angesichts der guten Erfahrungen will sie auch künftig jungen Frauen den Einstieg in eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten ermöglichen – sehr zur Freude von „Pro Arbeit“-Geschäftsführerin Claudia Georgii: „Wir und vor allem unsere Jugendlichen sind auf solche Betriebe angewiesen.“, unterstreicht sie den hohen Stellenwert der Kooperation. Denn von jeher ist es das erklärte Ziel des 1997 gegründeten Vereins, junge Menschen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben zu begleiten und zu unterstützen. - Ein Projekt also, für das es wiederum gilt, laufend neue Ausbildungs- und Arbeitsstellen bei Betrieben in der Region zu akquirieren.
Juli 2010
von Marisa Pilger
Rosenheim/Brannenburg - Die Hauptschule hat Ahmet mit der Mittleren Reife (M-Zug) beendet. Das war im Sommer 2006. Seine – zugegebenermaßen bisweilen halbherzige - Suche nach einem Ausbildungsplatz blieb allerdings lange erfolglos; auf jede Bewerbung folgte prompt eine Absage. Ein Grund dafür war wohl auch die Vier in Mathe, glaubt der heute 20jährige. Die vielen Rückschläge gingen indes nicht spurlos an dem Hauptschüler aus Kiefersfelden vorüber; Frustration machte sich breit. Dass er im Herbst 2008 seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei Elektro Lerch in Brannenburg antreten konnte, hat er letztlich einer Kooperation zwischen „Pro Arbeit e.V.“ und der Arge Landkreis Rosenheim zu verdanken. Und sein Chef Hans-Jürgen Schrödl will ihn nach der Lehre „auf jeden Fall übernehmen“.
 |
| Fühlt sich sichtlich wohl an seiner Lehrstelle: Ahmet Seren, hier mit Ausbildungsvermittler Alexander Halle-Krahl (links), seinem Chef Hans-Jürgen Schrödl und dessen Frau Linda. |
Monika Hofmann (Stadt) und Alexander Halle-Krahl (Land) nehmen in Abstimmung mit den Argen Jugendliche und junge Erwachsene unter ihre Fittiche, die sonst nur geringe Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten; sie motivieren ihre Schützlinge und bieten Unterstützung bei den Bewerbungen. Von den mehr als 360 Teilnehmern, die das Programm bislang durchlaufen haben, konnte mehr als ein Drittel in sozialversicherungspflichtige Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse vermittelt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei im Einzelhandel, bei den männlichen Teilnehmern zudem in der Metallbranche. Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss kommen häufig in klassischen kaufmännischen Berufen (Büro-, Groß- und Außenhandel) zum Zuge.
„Die Abbrecherquote liegt bei rund zehn Prozent und damit deutlich unter dem Bundesmittel.“, ergänzt Halle-Krahl die Statistik; wobei ein Großteil davon in anderen Betrieben oder fortsetzenden Maßnahmen untergekommen sei. Wie seine Kollegin Monika Hofmann hält auch er engen Kontakt zu den Betrieben. Und diese wiederum, betont er, seien in besonderem Maße bereit, ihren Lehrlingen in schwierigen Situationen Rückendeckung zu geben. (siehe auch "Baby und Berufsausbildung - Spagat oder Zerreißprobe?")
Die Kooperation Argen/Pro Arbeit hat sich unterdessen auch für Hans-Jürgen Schrödl als Glücksfall erwiesen. Vor wenigen Jahren hatte der Elektromeister den alteingesessenen Betrieb in der Sudelfeldstraße übernommen – damals mit 2,5 Arbeitsplätzen. „Lange Zeit habe ich händeringend nach Nachwuchs gesucht.“, schildert der Unternehmer die damalige Situation.
Mit einem neuen Ausbildungsplatz wollte er seinen Beitrag leisten, dem eklatanten Fachkräftemangel entgegen zu steuern. Allein: Die Kontaktaufnahmen mit der Brannenburger Haupt- und Realschule blieben ergebnislos: Trotz 180 Abgängern landete keine einzige Bewerbung auf seinem Schreibtisch. „Der Anruf von Herrn Halle-Krahl kam also genau zur rechten Zeit.“ Nach einem dreimonatigen Praktikum und einigen Anlaufschwierigkeiten stand für Schrödl fest. „In Ahmet steckt etwas.“ Wobei sich das Aufgabengebiet längst nicht auf Schlitze schlagen und Strippen ziehen beschränkt; der fachgerechte Umgang mit dem Laptop auf der Baustelle gehört hier ebenso wie der Umgang mit Kunden im Laden zum täglich Brot. Ahmet jedenfalls, der schon als Bub „immer rumgeschraubt hat“, fühlt sich in dem Familienbetrieb sichtlich wohl; nur die schriftlichen Prüfungen bereiten ihm wie auch seinem Lehrherrn noch etwas Sorge.
Von den Erfolgen des Vermittlungs-Projekts, das immer wieder auch die Vernetzung zu den Schulsozialarbeitern von „Pro Arbeit“ zurückgreift, sind auch Franz Heuberger, Geschäftsführer der Arge Land, und sein Vertreter Willi Stadler, beeindruckt. Auszubilden verlange den Verantwortlichen – abgesehen vom finanziellen Aufwand - schon per se ein großes Maß an Engagement, Organisation, Zeit und Nerven ab. Umso mehr Respekt und Anerkennung gebühre deshalb denjenigen, die zudem jungen Leuten aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine Chance gäben.
Für Schrödl jedenfalls, der mittlerweile vier Vollzeit- und drei Teilzeitkräfte beschäftigt und spätestens fürs kommende Jahr eine weitere Lehrstelle plant, steht bereits fest: „Der erste Anruf gilt dann der Ausbildungsplatzvermittlung von Pro Arbeit“.
Mai 2010
von Marisa Pilger
Rosenheim/Raubling – Baby und Lehre – Lehre trotz Baby?! Für junge Mütter ist es meist ein Ding der Unmöglichkeit, Familie und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen. Dass es trotzdem funktionieren kann, zeigt das Beispiel von Regina Heldt (18), die im September 2008 beim Frischecenter Prechtl eine Teilzeitausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel begonnen hat. Anstelle der üblichen 40 Wochenstunden - entsprechend den Öffnungszeiten des Supermarkts im Schichtdienst - arbeitet sie lediglich 30 (inklusive Berufsschule). Auf diese Weise bleibt ihr mehr Zeit, sich um ihre zweijährige Tochter zu kümmern, die sonst von der Oma betreut wird.
 |
| Lehrling und Mutter zugleich – ein Spagat, an dem viele junge Frauen scheitern. Ohne die Unterstützung durch ihre Familie könnte Regina Heldt ihre Teilzeitausbildung nicht meistern: Ihre kleine Tochter wird während der Arbeitszeit von der Oma betreut.
Fotos: Pilger |
Dabei hatte Regina Heldt schon einmal, nämlich im Jahr 2007, den Zuschlag für eine (Vollzeit-)Lehrstelle bei Prechtl in der Tasche – und wurde schwanger. Sie besuchte damals die JoA-Klasse (Jugendliche ohne Ausbildungsplatz) an der Berufsschule II in Rosenheim. Zu schweigen, den Lehrvertrag kurzerhand zu unterschreiben und sich wenige Monate später in den Mutterschutz zu verabschieden, kam für die Jugendliche jedoch nicht in Frage. „Das wäre nicht fair gewesen.“
Dieses Spiel mit offenen Karten hat Monika Prechtl, die Verantwortliche für die Auszubildenden in Raubling und den Frischemarkt-Filialen in Brannenburg und Bad Aibling, ihr so hoch angerechnet, dass sie der jungen Frau die Stelle für ein Jahr frei hielt. Und auch der Sonderweg „Teilzeitausbildung“, den Alexander Halle-Krahl, Ausbildungs- und Arbeitsplatzvermittler von Pro Arbeit, während dieser Zeit ins Spiel brachten, stieß bei Prechtl sofort auf offene Ohren. Stimmen die Noten, kann Regina Heldt trotzdem ihre Lehre nach drei Jahren abschließen und hat dann „etwas in der Hand“. Ihre Chefin jedenfalls, Mitglied des IHK-Prüfungsausschusses bei den Einzelhandelskaufleuten, ist „sehr zufrieden“.
Bereits in der Vergangenheit hat das Raublinger Familienunternehmen mehreren Jugendlichen aus dem Kooperationsprojekt Pro Arbeit/ Arge eine Chance gegeben – und ist mit den Lehrlingen durchwegs gut gefahren.
Angesichts etwa 860 alleinerziehender Mütter, die allein bei der Arge Rosenheim-Land gemeldet sind, wünscht sich allerdings nicht nur Halle-Krahl mehr Betriebe, die sozialgesellschaftliche Verantwortung in die Tat umsetzen. Denn „viele junge Frauen bleiben einfach auf der Strecke.“
Mai 2010
 |
von Marisa Pilger
Amerang – Den Skitourengehern an der Pyramidenspitze muss buchstäblich die Kinnlade heruntergeklappt sein, als Wolfram von Oy vor einigen Jahren im tiefsten Winter an ihnen vorbeizog. „Ich glaub', ich hab' was an den Augen.“, soll einer gemurmelt haben. Nicht von ungefähr. Denn der Ameranger war so unterwegs, wie er seit 30 Jahren durchs Kaisergebirge, rund um den Großglockner oder im Karwendel marschiert: Flott, den Blick hochkonzentriert auf den Boden gerichtet - und barfuß.
 |
Freilich sprechen ihn regelmäßig andere Berggänger an. Manche mit spöttischen Kommentaren wie „Passen die Schuhe nicht mehr?!“; von den meisten aber erntet der Mann mit dem Pferdeschwanz Bewunderung und Respekt. „Das ist schon schön.“, freut er sich. Und damit er nicht immer wieder die gleiche Geschichte erzählen muss, verweist er dann gerne auf seine Homepage www.barfuss.info, die ihm sein Sohn Emanuel vor einiger Zeit eingerichtet hat. Die Website gibt minutiös Auskunft über den Lebensweg eines Mannes, der am Fronleichnamstag 1956 seinen Anfang nahm und durch viele Höhen und Tiefen führt.
Genau drei Jahrzehnte liegt seine erste Wanderung „unten ohne“ nun zurück: Einem Bergkameraden waren bei einer Hüttenübernachtung im Kaisergebirge die Schuhe abhanden gekommen und der marschierte deshalb kurzerhand barfuß weiter. Von Oy, seit seiner frühesten Jugend in der Bergwelt zu Hause, zeigte sich solidarisch und verzichtete für den Rest der Tour ebenfalls auf Schuhwerk.
Richtig los ging's mit der Barfußgeherei im folgenden Jahr. Für seine damalige Freundin, eine Italienerin, war das Bergsteigen mit nackten Füßen gang und gäbe; Grund genug für von Oy, das auch auszuprobieren. „Und dann hat sich das einfach so entwickelt.“ Zwischen 1998 und 2006 war er fast jeden Tag unterwegs, wohl 1500mal erklomm er damals von der Spatenau aus den 1569 Meter hoch gelegenen Hochriesgipfel – oft in nur 50 Minuten; an manchen Tagen drei- bis viermal. Zu seinen absoluten Rekorden aber zählt er die 8000 Höhenmeter, die er vor Jahren binnen 24 Stunden bewältigt hat. Nach drei Touren im Kaiser hängte er noch zehn Gipfelgänge auf die Hochries dran. Zur Zeit macht er sich „nur“ dreimal in der Woche auf den Weg; bisweilen im Rückwärtsgang oder, je nach Laune, auch nachts.
Waren seine Füße anfangs von riesigen Blutblasen übersät, gab sich dies mit der Zeit, mit zunehmendem Training und vor allem mit dem „Willen, etwas zu leisten“. Irgendwann wagte sich von Oy, der als Kind massiv mit Asthma zu kämpfen hatte, schließlich an seine erste Schnee-Wanderung, stapfte durch das kalte Weiß an Naunspitze und Petersköpfl vorbei auf die Pyramidenspitze (1998 m). Seiner blutigen Füße sei er sich erst bei der Hütteneinkehr bewusst geworden.
 |  |
| Barfuß auf die Berge – das ist für Wolfram von Oy viel mehr als nur ein Hobby. Eine seiner Lieblingstouren führt auf den Roßkaiser, eine andere auf das Stripsenjoch. „Das ist so schön steinig.“ Und noch eine seltene Leidenschaft pflegt der passionierte Bergsteiger, der jede seiner Touren schriftlich dokumentiert: An die 6000 Exemplare umfasst die akribisch gepflegte Sammlung alter Bücher im Dachgeschoss. Fotos: Pilger/Oy |
Völlig unbeschadet ist er trotzdem nicht davon gekommen: Vor gut zehn Jahren erlitt er schwere Erfrierungen an beiden Füßen und konnte eine Woche lang vor Schmerzen nicht schlafen. Wegen des stark geschädigten Gewebes rieten ihm die Ärzte zwar dringend von weiteren Barfuß-Märschen im Schnee ab. Doch von Oy machte sich im Winter drauf wieder auf den Weg und tut dies – ohne Folgeschäden - bis heute. Cremes und Salben sind für ihn dabei kein Thema. Den unvermeidlichen frostbedingten Verletzungen – wenn etwa die Haut an Zehen oder Fersen wieder weit eingerissen ist - rückt er lediglich mit Heftpflaster zu Leibe. „Und davon brauch' ich ziemlich viel.“, grinst er.
Oberhalb der Knöchel unterscheidet sich von Oys Ausrüstung ohnehin nicht von der „herkömmlicher“ Gipfelstürmer. Auch er setzt auf Funktionswäsche, Fleecejacke, Stirnband und – ein Muss im Winter – auf Handschuhe. Ebenso wenig verzichtet er auf gefederte Wanderstöcke aus der Werkstatt seines Freundes Jochen Schwarz. Allein vor dem Abstiegslauf schlüpft er seit einigen Jahren in Trekkingsandalen. Für bestimmte Strecken im Wilden Kaiser allerdings zieht der Naturliebhaber, der auch im Flachland am liebsten unbeschuht unterwegs ist, bereits im Tal seine Leichtbergschuhe an – der Kreuzottern wegen. Und so werden die Cowboystiefel in Größe 46, die seit Jahren ein Schattendasein fristen, wohl auch in Zukunft nicht in die Gänge kommen.
Mai 2010
Nußdorf /Stephanskirchen (pil)– Landtagsabgeordneter, Staatssekretär, Staatsminister, Präsident des Bayerischen Sparkassen- und Giroverbandes, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Landesbank, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft – Stationen auf dem Lebensweg eines Mannes, der nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges buchstäblich vor dem Nichts stand, Jura studierte, zunächst eine Laufbahn bei der Finanzverwaltung einschlug und später über Jahre hinweg die bayerische Landespolitik maßgeblich mitgestaltete. Nun feierte Franz Neubauer, der am Josefitag 1946 mit seiner Familie aus dem Egerland in Rosenheim ankam und seit mehreren Jahren in Nußdorf am Inn lebt, seinen 80. Geburtstag.
 |
| Gleich zwei amtierende Bürgermeister gratulierten Staatsminister a.D. Franz Neubauer zum 80. Geburtstag. Weder Sepp Oberauer aus Nußdorf (rechts) noch sein Stephanskirchner Kollege Rainer Auer ließen sich einen Besuch im Haus des einstigen Landespolitikers und langjährigen Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft nehmen. Neubauer, Ehrenbürger in seinem einstigen Heimatort Stephanskirchen, lebt seit rund zehn Jahren in der Inntalgemeinde. Foto: Pilger |
Nach seinem „Umzug“ vom Finanzamt ins Bayerische Finanzministerium im Jahr 1967 leitete Neubauer das Referat Kommunalfinanzen. Er wurde 1970 in den Landtag gewählt und gehörte von 1977 bis 1986 dem Kabinett an; zunächst als Staatssekretär im Justiz-, dann im Innenministerium, bevor er 1984 Fritz Pirkl als Staatsminister für Arbeit und Sozialordnung ablöste. Einige Jahre leitete er außerdem die nach ihm benannte „Neubauer-Kommission“ zur Entbürokratisierung.
Sein großes Interesse für Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten führte Neubauer 1986 auf den Stuhl des geschäftsführenden Präsidenten beim Bayerischen Sparkassen- und Giroverband. Von dort wechselte er 1993 auf den Präsidentenposten der Bayerischen Landesbank.
Aber auch in sozialen Organisationen – etwa in der Aktion “Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ - engagierte sich der CSU-Politiker, dessen Leistungen unter anderem mit dem Bayerischen Verdienstorden und dem Großen Bundesverdienstkreuz gewürdigt wurden.
Viele Jahre hat Neubauer mit seiner Familie in Stephanskirchen gelebt. Als Gemeinderat (1972 bis 78) schob er dort verschiedene richtungweisende Projekte wie den Simssee-Ringkanal und den Bau der Umgehungsstraße an und stemmte sich vehement gegen eine Eingemeindung nach Rosenheim. Vor zehn Jahren wurde Neubauer dort das Ehrenbürgerrecht verliehen. Grund genug für Bürgermeister Rainer Auer, sich der Nußdorfer Gratulationsdelegation mit dem dortigen Rathaus-Chef Josef Oberauer anzuschließen.
Mai 2010
| Die Idee wurde – wie sollte es anders sein - auf einer Osterbrunnen-Rundfahrt durch die Fränkische Schweiz geboren. Inspiriert von den mit hunderten und tausenden bunten Eiern prächtig herausgeputzten Exemplaren, die dort in der Osterzeit zum Ortsbild gehören, hat Sepp Pilger aus Niedermoosen in diesem Jahr ein Stück fränkisches Brauchtum nach Oberbayern geholt. Alustangen wurden für die Krone gebogen, meterweise Girlanden gebunden und an die 500 blaue, gelbe, grüne und rote Kunststoffeier auf Draht gefädelt für den Niedermoosener Osterbrunnen. Und als Blickfang läuft dieser seiner Nachbarin Aphrodite derzeit unbestritten den Rang ab. Text/ Foto: pil |  |
Rosenheim (pil) – Mit der pro-aktiven Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt schlägt der Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim ein ganz neues Kapitel im Hinblick auf einen möglichst nachhaltigen Opferschutz auf. Der pro-aktive Ansatz soll, anders als die traditionelle Komm-Struktur, auch diejenigen Frauen erreichen, die von sich aus keine Beratungsstelle aufgesucht hätten: Binnen drei Tagen nach einem Polizeieinsatz nimmt die neugeschaffene Einrichtung Kontakt mit der misshandelten Frau auf - deren Einverständnis vorausgesetzt. Dadurch kann auf Grundlage des Gewaltschutzgesetzes insbesondere die Zeitspanne zwischen dem Platzverweis für den Täter durch die Polizei und einer richterlichen Schutzanordnung (nach der Devise „Der Täter geht – Das Opfer bleibt“) besser überbrückt werden, verdeutlichte Diplom-Sozialpädagogin Gudrun Gallin vom Frauen- und Mädchennotruf bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Polizeiinspektion Rosenheim.
 |
| Gewalt gegen Frauen vom eigenen Partner ist keine Privatangelegenheit: Mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen dem Frauen- und Mädchennotruf und der Polizeiinspektion Rosenheim wurde der Start der pro-aktiven Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt besiegelt. Von links: Helene Gurgießer, Gundula Velemir-Sorger und Lotte Zinkl, die Notruf-Vorstandsfrauen, und Martin Irrgang von der Polizeiinspektion Rosenheim. Dem offiziellen Schulterschluss wohnten außerdem Martina Wildenburg, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rosenheim, und Katharina Spöttl, Beauftragte für Frauen und Kinder beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd, bei. Foto: pil |
Die neue Institution will misshandelte Frauen gezielt dabei unterstützen, den Absprung zu schaffen. Oberste Priorität hat für Gudrun Gallin dabei die Sicherung der Wohnung für die Opfer und deren Kinder sowie das Leben in einem gewaltfreien Umfeld. Wesentliche Bestandteile des kostenlosen Hilfsangebots sind deshalb neben der Aufklärung über die rechtlichen Möglichkeiten die Entwicklung eines Sicherheitsplans und Informationen über weitere Beratungs- und Schutzeinrichtungen.
Als „wichtigen Mosaikstein“ wertet auch Martin Irrgang die vom Runden Tisch „Häusliche Gewalt“ initiierte pro-aktive Einrichtung im Künstlerhof am Ludwigsplatz. Der Polizei sei in der Vergangenheit in erster Linie die Rolle des Schlichters bei den so genannten "Familienstreitigkeiten" zugekommen, ohne im Vorfeld erneute Übergriffe verhindern zu können. Und nicht selten, räumte er beim Pressetermin im Rathaus unumwunden ein, wurde der Ernst der Lage verkannt. Erst das Gewaltschutzgesetz von 2002 habe das Thema zunehmend ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und auch die Polizisten sensibilisiert für die bedrückende, bisweilen schier ausweglose Situation der geprügelten Frauen. Nun können Opfer häuslicher Gewalt in der Region Rosenheim kompetente, individuelle und zeitnahe Unterstützung in Anspruch nehmen, die „die Polizei alleine nicht leisten kann“.
Die erforderlichen Daten übermitteln die Einsatzbeamten – mit Einwilligung der Betroffenen – an die Beratungsstelle. Zugleich aber appelliert Irrgang im Interesse der misshandelten Frauen an die Bevölkerung, nicht die Augen vor möglichen Fällen häuslicher Gewalt zu verschließen. „Für einen wirkungsvollen Schutz sind wir auf Hinweise angewiesen.“
Unterdessen ist der Frauen- und Mädchennotruf auch in anderer Hinsicht gefordert: Mangels staatlicher Unterstützung tritt der Verein, der sich zu 80 Prozent aus Eigenmitteln finanziert, für den Betrieb der Beratungsstelle (zunächst fünf Stunden pro Woche) im Rahmen eines Modellprojekts in Vorleistung.
März 2010
von Marisa Pilger
Thansau – Umsatzeinbrüche, Produktionsrückgang, Kurzarbeit – auch an Schattdecor, dem Weltmarktführer auf dem Sektor bedruckte Dekorpapiere, ist die Wirtschaftskrise nicht spurlos vorüber gegangen. Doch mittlerweile ist die Talsohle durchschritten, die Auftragslage hat sich deutlich erholt. Im Oktober wurde beinahe eine Rekordproduktion gefahren. „Unsere Unternehmenskultur hat hier einen großen Beitrag geleistet.“, ist der Vorstandsvorsitzende Reiner Schulz überzeugt. Voller Zuversicht blickt er in die Zukunft nach einer Durststrecke, der er durchaus auch positive Seiten abgewinnt.
Dankbarkeit schwang auch bei seiner Rede im Rahmen der firmeninternen Weihnachtsfeier mit; Dankbarkeit, Stolz und Freude über die Belegschaft, dank der das Unternehmen die bislang wohl schwierigsten Monate in der bald 25jährigen Firmengeschichte mehr oder minder mit einem blauen Auge überstanden hat. In Zahlen ausgedrückt, die im Februar niemand für möglich gehalten hätte, heißt das: Das Umsatzminus im Vergleich zum Vorjahr - 2008 haben die 1100 Mitarbeiter des Konzerns knapp 400 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet – liegt trotz der weltweit überaus angespannten Wirtschaftslage bei weniger als 15 Prozent.
 |
| Blickt voller Zuversicht in die Zukunft: Reiner Schulz, der Vorstandsvorsitzende der Schattdecor AG. |
Noch immer ist Schulz sichtlich beeindruckt vom Verständnis, mit dem seine Mitarbeiter diese bittere Entscheidung aufgenommen und vor allem mitgetragen haben, und von der Solidarität unter den Kollegen: „Sogar die Verwaltung hat mitgezogen.“ Die Vorstandsmitglieder verzichteten in dieser Zeit freiwillig auf zehn Prozent ihres Monatsgehalts – bei voller Arbeitszeit.
Dabei will der Vorstandschef beim Pressegespräch in der obersten Etage des Bürozylinders gar nicht viele Worte verlieren über die Krise als solche, die sich ohnehin nicht mehr ungeschehen machen lässt; sie versteht er nun vor allem als Chance, als Herausforderung. Beispielsweise wurde so mancher Automatismus aus früheren „guten“ Zeiten – und sei es nur der Kostenfaktor wöchentliche Fensterreinigung – in den vergangenen Monaten auf den Prüfstand geschickt und gegebenenfalls abgeschaltet.
An einem Punkt aber habe man bei Schattdecor, wo im April die millionste Tonne bedruckter Dekorpapiere die Packstraße verlassen hat, bewusst nicht gespart, nämlich am „wertvollsten Gut“: Weder fiel die traditionelle Jahresabschlussfeier für die Mitarbeiter den Sparzwängen zum Opfer, noch wurde der Rotstift bei Urlaubsgeld, Weihnachtsgratifikation oder Prämien angesetzt. Ebenso wenig gab es an irgendeinem Standort krisenbedingte Entlassungen.
Im Gegensatz zu manchen Konkurrenten seien Liquiditätsprobleme bei Schattdecor zu keiner Zeit ein Thema gewesen, ergänzt Schulz. Schließlich stehe das familiengeführte Unternehmen auf sehr gesunden Beinen: „Uns haut so schnell nix um.“ Mit einer gesunden Mischung aus Innovation und Bodenständigkeit will er die Firma in den kommenden Jahren weiter vorwärts bringen und die Marktposition weiter festigen.
Und auch die nächsten Stationen der „Weltreise“, die Firmengründer Walter Schatt vor 25 Jahren begonnen hat, stehen bereits fest: Neben der Expansion in den USA peilt der oberbayerische Global Player für 2010/2011 einen Produktionsstandort im asiatischen Teil der Türkei nahe Istanbul an. - Investitionen, die letztlich auch die Arbeitsplätze in der Konzernzentrale in Thansau sichern.
Dezember 2009
 |
| Die Notruf-Stele, Symbol für Hinschauen und Handeln, wurde gestaltet vom Bildhauer Rudl Endriß. Foto: pil |
Von arbeitsreichen Monaten, die zugleich geprägt waren von personellen Veränderungen, zeugte der Rechenschaftsbericht von Vorstandsfrau Helene Gurgießer bei der Jahreshauptversammlung im Mailkeller. Insgesamt 523 Kontakte mit Hilfesuchenden hat das Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen allein in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres verzeichnet; fürs gesamte Jahr 2008 wurden dort 478 registriert. 123 (88) persönliche Beratungen haben den Aktiven ein „enormes Arbeitspensum“ abverlangt; in 194 (111) Fällen suchten Frauen wegen körperlicher oder seelischer Misshandlungen Hilfe. Zusätzlich zur kostenlosen und auf Wunsch anonymen Beratung begleiteten Notruf-Mitarbeiterinnen die Betroffenen gegebenenfalls auch bei Behördengängen oder zu Gerichtsterminen. Auf großes Interesse stieß zudem eine Fortbildung zum Thema Stalking, an der sogar einige Sozialpädagoginnen aus Österreich teilnahmen.
Fester Bestandteil im Angebot des Frauen- und Mädchennotrufs ist längst auch die Fachstelle Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen; insgesamt 36 Schulklassen hatten 2008 die Präventionsveranstaltungen gebucht. Darüber hinaus standen diverse Informationsveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte und Eltern auf dem Programm sowie ein Vortrag am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring.
Mit rund 3500 Stunden haben zwölf eigens ausgebildete Ehrenamtliche die Fach- und Beratungsstellen im vergangenen Jahr unterstützt. Um aber das hohe Niveau der Arbeit in Zukunft aufrecht erhalten zu können, „brauchen wir immer wieder Ehrenamtliche“, betonte Gurgießer. Entsprechend herzlich war der Applaus für die zwei „Neuzugänge“ - Gitti Ziegelmeier und Dagmar Euler - im Kreis der Aktiven.
Weniger erfreulich zeichnet sich unterdessen die Entwicklung des Mitgliederstandes ab, der seit 2002 von 219 auf mittlerweile 202 geschrumpft ist. Mit gezielten Werbeaktionen im kommenden Jahr hoffen die drei Vorstandsfrauen Gundula Velemir-Sorger, Helene Gurgießer und Lotte Zinkl, den Abwärtstrend zu stoppen, der sich über die Mitgliedsbeiträge letztlich auch in den Finanzen niederschlägt.
Nur ein kleiner Teil der Einnahmen sei sicher, merkte Zinkl in ihrem Kassenbericht für 2008 an, der bei einem Gesamtetat von 117.000 Euro ein Defizit von 4500 Euro aufweist. Fürs laufende Wirtschaftsjahr konnte sie dank der Spenden anlässlich des 20jährigen Vereinsbestehens sowie einer unerwarteten Zuwendung seitens der Regierung von Oberbayern „ein dickes Plus“ vermelden; zumal auch die Bußgelder mit bislang 38.300 Euro bereits jetzt deutlich über dem Jahresmittel lägen. Mit verstärktem Fundraising will der Frauen- und Mädchennotruf zudem neue Geldquellen erschließen: „Eine Herausforderung für alle.“
In einer Powerpoint-Präsentation ließ Gudrun Gallin abschließend das Jubiläumsjahr Revue passieren, das dem Verein nicht zuletzt die Notruf-Stele an der Burgermühle beschert hat.
Weitere Infos zum Frauen- und Mädchennotruf sind im Internet unter www.frauennotruf-ro.de erhältlich; die Beratungsstelle ist telefonisch erreichbar unter 08031/268888.
November 2009
|
von Marisa Pilger
Rottmoos/Wasserburg – Immer montags und donnerstags wird gesprungen in Rottmoos; dann steht dort das Phantom ganz hoch im Kurs. Denn nicht von ungefähr übt die Torbogen-förmige Konstruktion – einem Kuhhintern durchaus ähnlich - einen ganz besonderen Reiz auf die Fleckvieh-Bullen aus, die in der Sprunghalle der Meggle-Besamungsstation zur Sperma-Abgabe „antreten“. Mindestens ebenso begehrt bei den vierbeinigen Samenspendern aber ist das Leckerli danach, schmunzelt Stationstierarzt Mag. Josef Dengg.
Im Grunde genommen ist es mit eine der natürlichsten Sachen der Welt, die hier vor sich geht - wenngleich mit einem kleinen Unterschied: es fehlt die Kuh. Stattdessen wird das Ejakulat, das der Stier in eine künstliche, vorgewärmte und sterile Scheide abgibt, in einem Glas aufgefangen. Genauestens wird es im Labor unter anderem auf Volumen, Dichte, Farbe (idealerweise elfenbein), Konsistenz (möglichst milchig-rahmig) und Anteil der beweglichen Spermien (in der Regel 60 bis 80 Prozent) untersucht. Mit einer Gefrierschutzlösung verdünnt wird es dann in mehrere hundert Einzeldosen portioniert, in hauchdünne Röhrchen, die Straws, abgefüllt, abgekühlt und tiefgefroren. Oberstes Gebot bei allen Arbeitsschritten ist hier die Hygiene.
Die Kuh indes kommt erst mit der Samen-Bestellung aus dem Stierkatalog ins Spiel: Ihr spritzt der Besamungstechniker unter rektaler Kontrolle das aufgetaute Sperma mithilfe einer angewärmten Inseminationspistole direkt in die Gebärmutter. Spitzenbullen bringen es auf diese Weise zu einer sechsstelligen Nachkommenschaft, ohne je eine Kuh besprungen zu haben. Acht Besamungsstationen sichern in Bayern die Zucht leistungsstarker Rinder, vornehmlich des Simmentaler Fleckviehs. Für die zweitälteste, die Meggle-Station im Wasserburger Ortsteil Rottmoos, steht dabei in diesem Jahr ein runder Geburtstag an: Vor sechs Jahrzehnten, im Januar 1949, wurde die Einrichtung, die heute insgesamt 60 Mitarbeiter beschäftigt, als kleine Abteilung der Molkerei gegründet; seit 2001 firmiert sie als GmbH.
Deckseuchen wie Brucellose, Infektionskrankheiten also, die bei der Begattung übertragen werden, und Zoonosen, Tierkrankheiten, die auf den Menschen überspringen können, gaben für die Molkereien im Nachkriegsdeutschland den Ausschlag, fortan auf die weitaus hygienischere, künstliche Besamung zu setzen. Kriegsveterinäre hatten das Verfahren, dessen Einführung zunächst auf großen Widerstand in der bäuerlichen Bevölkerung stieß, aus der Sowjetunion „importiert“.
Für die Rinderhalter indes lagen die Vorteile der künstlichen Besamung schnell auf der Hand. Schließlich bedeutete ein Stier auf einem gewöhnlichen Bauernhof nicht nur viel Arbeit und großen finanziellen Aufwand; auch ereigneten sich immer wieder Unfälle mit den teils sehr aggressiven Bullen, die schon mal 1500 Kilo auf die Waage bringen können. Zudem blieb das Erbgut gewissermaßen über Generationen hinweg in der Familie.
Täglich um vier Uhr früh wurde damals der Stier-Samen gewonnen und möglichst umgehend an die Kuh gebracht, schildert Geschäftsführer Dr. Wolfgang W. Lampeter die Anfänge. Im Zuge der Qualitätssicherung wurden in der Folgezeit zudem Zuchtprogramme entwickelt. So konnte die Station anfangs Zuwächse von jährlich 30 bis 40 Prozent bei der Anzahl der Besamungen verzeichnen. Heute beliefert das Unternehmen rund 5000 Viehhaltungsbetriebe – überwiegend in Bayern, aber auch im europäischen Ausland, in Süd- und Nordamerika sowie in Asien – mit hochwertigem Fleckvieh-Sperma aus Eigenproduktion. Sperma für andere Rassen wird zugekauft.
Einen wahren Quantensprung erlebte die Künstliche Besamung in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Einhergehend mit der Entwicklung der Leuchtstoffröhre wurde Flüssigstickstoff als Nebenprodukt hergestellt. Erst dies machte die Langzeitlagerung der Straws – jedes der 0,25-Milliliter-Röhrchen enthält etwa 18 Millionen bewegliche Spermien - bei minus 196 Grad Celsius möglich. Zusätzlich ebnete die Weiterentwicklung des Lochkartensystems den Weg für eine Großrechner-gestützte Populationsgenetik und erlaubte verlässliche Aussagen über die Vererbung einzelner Merkmale wie Körperbau, Milchleistung oder Fleischertrag. Diese und andere Qualitätskriterien konnten nun noch gezielter und großflächig in die Zucht der Zweinutzungsrasse Bayerisches Fleckvieh (Milch und Fleisch) eingebracht werden.
Insgesamt 40 Besamungstechniker, darunter einige Frauen, touren an 359 Tagen im Jahr (nicht an Neujahr, am Oster- und Pfingstsonntag, an Fronleichnam, Allerheiligen und am ersten Weihnachtsfeiertag) für Meggle durch den südostbayerischen Raum, beraten die Landwirte und nehmen jährlich 150.000 Erstbesamungen (zum Vergleich: deutschlandweit sind es 3,8 Millionen, weltweit 110 Millionen) vor. Im Gepäck haben die Außendienstler Tiefkühl-Container mit Sperma-Portionen von rund 100 verschiedenen Bullen; denn nur etwa ein Drittel der Bauern hat bereits bei der Bestellung den Vater der künftigen Kälber erkoren.
Mit einer Non Return-Rate von durchschnittlich über 70 Prozent, salopp ausgedrückt der „Trefferquote“ beim ersten Mal, belegen die Meggle-Stiere im Landesvergleich regelmäßig einen der vorderen drei Plätze, unterstreicht Lampeter die Wertigkeit der Station. Einen Natursprung allerdings erleben seinen Schätzungen zufolge inzwischen 90 Prozent aller Kühe unter dem weißblauen Himmel niemals.
Als den „bislang letzten Durchbruch“ bezeichnet er das gesexte Sperma, welches das Geschlecht des Nachkommen mit bis zu 95-prozentiger Sicherheit voraussagen lässt. Für Simmentaler spiele dies bislang jedoch keine allzu große Rolle, da sich die Bullenkälber hervorragend zur Mast eignen. Zudem, ergänzt Lampeter, sei das Herstellungsverfahren mittels Flow-Zytometer-Technologie sehr teuer, die Ausbeute geringer und die Fruchtbarkeit weniger gut.
Für die Bullen selbst beginnt das Leben als Stationsstier bei Meggle mit zwölf bis 14 Monaten. Jährlich werden dort – neben der Hege und Pflege der 30 „aktiven“ Bullen - 60 Jungstiere auf ihre Eignung zur Zucht geprüft; mehr als die Hälfte stammt dabei aus gezielten Paarungen. Insgesamt 350 weibliche Nachkommen benötigen die Fachleute für aussagekräftiges Datenmaterial; im Testzeitraum werden deshalb nur 800 bis 1000 Kühe besamt; dieses Sperma erhält der Rinderhalter zum Nulltarif. Erste Zuchtwerte werden bereits ab Tochter Nummer 35 im Internet veröffentlicht und dann laufend aktualisiert. Die gut vier Jahre bis zur ersten Laktation (Milchgabe nach dem Kalben) seiner Töchter aus dem Prüfungslauf verbringt der Bulle auf Warteposition in einem Stall in Tschechien. Erst dann entscheidet sich sein weiteres Schicksal: Station oder Schlachthaus? - Nur einer von sieben kehrt als Prüfbulle nach Rottmoos zurück und verdient sich dort rund drei Jahre lang seine Sporen als Samenspender.
Juli 2009
|
Ungewöhnlicher Höhenflug mit einer "Biene"
17jähriger Ape-Fan aus Griesstätt tuckert auf den Großglockner
Einen Höhenflug der ungewöhnlichen Art hat Emanuel von Oy (Foto) hinter sich: Gemeinsam mit seiner „Biene“, einer blauen 50 ccm-Ape, hat der 17jährige aus Griesstätt bei den Vespa World Days in Zell am See den höchsten Berg Österreichs erklommen. Teilweise sei's beim „Gipfelsturm“ auf den Großglockner (die Passhöhe liegt auf über 2500 m) gerademal mit 10 km/h aufwärts gegangen. Bereits die Anreise in dem dreirädrigen Kleinlaster – der Schwester der Vespa („Wespe“) – hatte dem Schüler einiges an Sitzfleisch abverlangt: Rund dreieinhalb Stunden war er mit seinem 3-PS-Gefährt zu der Großveranstaltung ins Salzburger Land getuckert, die mehrere tausend Vespisti an den Fuß des Glockner gelockt hatte.
Bereits die Anreise in dem dreirädrigen Kleinlaster – der Schwester der Vespa („Wespe“) – hatte dem Schüler einiges an Sitzfleisch abverlangt: Rund dreieinhalb Stunden war er mit seinem 3-PS-Gefährt zu der Großveranstaltung ins Salzburger Land getuckert, die mehrere tausend Vespisti an den Fuß des Glockner gelockt hatte.Das nächste Projekt hat der umtriebige Jugendliche, der in der Vergangenheit einige Preise bei „Jugend forscht“ abgeräumt hat, bereits im Visier: Eine Fahrt über die Alpen bis nach Italien; selbstredend in einem der urtümlichen Piaggio-Zweitakter, dem Lieblingsgefährt italienischer Pizzabäcker und Lieferanten. Text: pil/ Foto: NN Juli 2009 |
von Marisa Pilger
Bad Endorf – Den Entschluss, in den Karmel einzutreten, fasste sie, da war sie gerade 15. Es war die Zeit, als sich der Petticoat anschickte, die Damenmode im Wirtschaftswunder-Deutschland zu erobern; und schon bald sollte der Rock'n'Roll die heimische Musiklandschaft revolutionieren. Viele ihrer Bekannten und Freunde hatten nur Kopfschütteln übrig für ihr Vorhaben; zumal die gebürtige Rheinländerin bekannt war für ihr Temperament und ihren Freiheitsdrang. Doch allen Unkenrufen zum Trotz und gegen den Willen ihrer Eltern wurde aus Sieglinde Lakmayer „Schwester Agnes“, eine Ordensfrau. Drei Tage nach ihrer Lehramtsprüfung zur Volksschullehrerin trat sie, 21 Jahre alt und gerade großjährig geworden, im Oktober 1959 ins Karmeliterinnenkloster in Welden bei Augsburg ein.
 |
| Auf 700 Seiten schildert die ehemalige Nonne Sieglinde Dettenkofer-Lakmayer ihren ungewöhnlichen Lebensweg. „Die Wunde, die erst im Himmel heilt...“ ist vor kurzem im Pro Business-Verlag erschienen und kann unter anderem bei www.book-on-demand.de bezogen werden. Foto: Pilger |
Die Neigung zum klösterlichen Leben verspürte Sieglinde Dettenkofer-Lakmayer (Jahrgang 1938), die ihre frühe Kindheit in Wien und in der Holledau verlebt hatte, bereits während ihrer siebenjährigen Internatszeit bei den Arme Schulschwestern in Weichs. „Doch das war mir zu wenig streng.“ Leidenschaftlich schildert die pensionierte Religionslehrerin, die heute in Bad Endorf lebt, im persönlichen Gespräch ihre Motivation, auf ein Leben „draußen“, außerhalb der Klostermauern, zugunsten eines Daseins als Nonne in einem Schweigeorden zu verzichten: „Ich hatte diese Sehnsucht, mich mit Gott zu beschäftigen.“
Ihre erste Profess legte die Novizin 1961 ab, band sich also ganz offiziell an die Ordensgemeinschaft, gelobte Armut, Keuschheit und Gehorsam. Drei Jahre später folgte die ewige Profess; als Kapitularin durfte Schwester Agnes nun an allen Beschlüssen der Gemeinschaft teilhaben.
Strenge Regeln bestimmten den Tagesablauf im Kloster, der um 5.30 Uhr begann und nicht vor 21 Uhr endete. Nach Laudes (Morgenlob) , Meditation, Prim (Morgengebet) und Messe folgte das Frühstück. Dann begann der Arbeitstag der Ordensfrauen in der Wäscherei, der Paramentenstickerei, im Klostergarten oder in der Küche. Chorgebet, Mittagessen, Rekreation und einer weiteren kleinen Tagzeit folgten Arbeiten, Vesper und, vor dem Abendessen, erneut eine Stunde Betrachtung. Rekreation, Komplet (Abendgebet), Ruhezeit und Matutin (Mitternachtsgebet) beschlossen die Tage, über denen fast ununterbrochen Schweigen zu liegen hatte. Lediglich während der zwei Stunden Rekreation durfte gesprochen werden; „aber nicht über sich oder über andere“. Und Schwester Agnes fühlte sich wohl in der beschaulichen Gemeinschaft.
Damals, in den 1960er Jahren, herrschte noch kein Nachwuchsmangel bei den Karmeliterinnen, deren Ordensregeln bei mehr als 21 Schwestern in einem Karmel eine Neugründung beziehungsweise eine Teilung der Gemeinschaft vorsehen. Dass diese Zahl auch in Welden überschritten wurde, war für Schwester Agnes gewissermaßen ein Glücksfall: Mit der Aussendung zur Gründung eines Konvents in Uganda ging 1967 für sie „der Kindheitstraum Afrika“ in Erfüllung. Der jedoch endete nach einer Visitation der Ordensleitung im März 1970; sie musste zurück nach Deutschland. Im folgenden Jahr putschte sich Idi Amin in dem ostafrikanischen Land an die Macht.
Die Rückreise markierte zugleich einen weiteren Wendepunkt in ihrem Leben. Denn die Heimkehr nach Welden wurde ihr von den Oberen verwehrt; stattdessen schickte man sie ohne weitere Erklärung für vier Wochen zu ihren Eltern. Und von dort aus - wiederum fiel die Entscheidung über ihren Kopf hinweg – in einen anderen, „sehr sehr strengen“ Konvent, an dem der Erneuerungsgedanke des Vatikanischen Konzils offenbar spurlos vorübergegangen war. „Das kann Gott nicht wollen, dass ich zugrunde gehe.“, fasst die heute 71jährige rückblickend ihren Gemütszustand während ihres letzten Nonnen-Jahres in einem Satz zusammen.
Schließlich ließ sie sich beurlauben, kehrte mit gut 30 Jahren aus freien Stücken ins Elternhaus zurück und schickte am nächsten Tag postwendend ihre Ordenstracht, den Habit mit Wolltunika, Schleier, Skapulier und Sandalen, ans Kloster zurück. Denn wieder hatte Sieglinde einen grundlegenden Entschluss gefasst: Sie würde, enttäuscht und allein gelassen vom Orden, ins „weltliche Leben“ zurückkehren.
Dank ihrer Ausbildung, auf die der Vater seinerzeit gedrungen hatte, konnte sie als Religionslehrerin unterrichten. 1973 schließlich ersuchte sie in Rom um die Entbindung von ihren Gelübden. Bereits im Jahr zuvor hatte sie ihren späteren Mann Wolfgang, einen Priester aus dem Karmelorden, kennengelernt. Sieglinde Lakmayer stand – auch mit Hilfe ihrer Eltern - nach zwölf Jahren im Schweigeorden erstaunlich schnell wieder im Leben. In der „normalen Welt“, in der Bundeskanzler Willy Brandt mit seinem Kniefall von Warschau ein Zeichen gesetzt und die blutige Geiselnahme die Olympischen Spiele von München überschattet hatte. Von der Errungenschaft der Pille beispielsweise hatte die junge Ordensfrau seinerzeit rein zufällig auf einer Bahnfahrt nach München gehört.
Mit dem klösterlichen Leben hat Sieglinde Dettenkofer-Lakmayer zwar abgeschlossen; die Wunde aber, die ihre inneren Kämpfe mit sich gebracht haben, werde in diesem Leben nicht heilen; wenngleich ihre Religiosität heute wohl tiefer sitze als im Karmel. Trotzdem „fühle ich mich in Welden immer noch daheim“, hat sie erst kürzlich bei einem Besuch wieder gespürt. Ihr „Lebensbuch“, das sie dort ihrer einstigen Priorin überreicht hat, sei von den Schwestern durchaus positiv aufgenommen worden, freut sie sich. Schließlich „wollte ich niemanden ausrichten, sondern nur mein Leben erzählen“.
Den Schritt ins Nonnenleben allerdings würde die Ehefrau, Mutter und Großmutter „nie mehr“ tun, und, schickt sie mit aller Entschiedenheit hinterher, auch „niemandem raten, ins Kloster zu gehen.“ Denn wer sich berufen fühlt, sollte „für die Menschen da sein und sich nicht hinter Klostermauern einschließen“.
Mai 2009
 |
| Der Raublinger Bahnhof soll wieder mit Leben erfüllt werden. Binnen vier Jahren, so Bürgermeister Kalspergers Ziel, soll das Projekt abgeschlossen sein. Foto: Pilger |
Raubling (pil) – Die Gemeinde Raubling will ihren Bahnhof vom Abstellgleis holen. Vor knapp sieben Jahren hat die Kommune das Hauptgebäude samt Anbau von der Bahn gekauft. Nun soll in den sanierungsbedürftigen Komplex gleich gegenüber des vormaligen Kaufhauses Prechtl wieder Leben einziehen. Allein, noch fehlen Investoren und Pächter für das Projekt.
Eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss, etwa mit einem Bistro oder einer Jazzkneipe mit Life-Musik, ist ausdrücklich erwünscht. Bürgermeister Olaf Kalsperger jedenfalls könnte sich eine Weichenstellung in Richtung „Kulturbahnhof“ sehr gut vorstellen. Er hat dabei insbesondere das Ü-30-Klientel im Visier; zumal der verkehrsgünstig gelegene Standort auch für Besucher aus dem Umland gut zu erreichen wäre.
Ober- und Dachgeschoß böten Platz für den Künstlertreff, für die VHS oder für eine Anlaufstelle des „Betreuten Wohnen“. Und auch ein Reisebüro inklusive Fahrkartenverkauf könnte sich ansiedeln. „Das Gebäude bietet einiges an Möglichkeiten.“ Selbst eine Erweiterung des Gebäudes nach Norden hin will Kalsperger nicht ausschließen. Auf jeden Fall aber soll mit der Belebung des Anwesens das Toiletten-Problem am Bahnhof gelöst werden.
Bereits nach dem Kauf im Jahr 2002 hatten mehrere Geschäftsleute Interesse bekundet an dem Objekt mit der augenfälligen Holzverkleidung und dem Blechdach. Doch erst im Herbst 2007 wurde das Gebäude entwidmet, von der Bahn Stellwerktechnik und Fernmeldeleitungen restlos ausgebaut. „Bis dahin waren wir blockiert.“ Die potenziellen Investoren waren in der Zwischenzeit allerdings abgesprungen.
Ein Abriss steht für den Gemeindechef jedenfalls außer Frage: „Wir wollen ein Stück Raublinger Geschichte erhalten.“ Die Bahnstrecke Rosenheim-Kufstein wurde am 4. August 1858 eröffnet und tags darauf in Betrieb genommen. Dementsprechend dürfte auch das zweistöckige Gebäude an die 150 Jahre auf dem Buckel haben.
In Sachen Bahnhof will Kalsperger nun auf jeden Fall zweigleisig fahren: Erst vor kurzem hat der Gemeinderat ein Architekturbüro mit der Voruntersuchung etwaiger Sanierungsgebiete im Rahmen der Städtebauförderung betraut; hierfür wird unter anderem das Bahnhofsgelände samt Umgebung unter die Lupe genommen. Wolle nun aber ein Interessent sofort auf den „Sanierungs-Zug“ aufspringen, werde ihn die Gemeinde sicherlich nicht daran hindern.
9. April 2009
Nußdorf (pil) – Kaum zu glauben, was ein Millionengewinn, den es gar nicht gibt, alles bewirken kann. Auf urkomische Weise erfuhren dies die Zuschauer beim Nußdorfer Trachtler-Theater, das in diesem Jahr mit der „Millionenoma“ auf der Bühne des Schneiderwirt steht. Mit dem Lustspiel von Monika Steinbacher sorgen Spielleiter Hans Oberauer und sein Ensemble wieder für eine gelungene Abendunterhaltung, was das Premierenpublikum mit kräftigem Applaus dankte.
Gnadenlos scheucht die 84jährige Kreitmeier-Oma (Grete Antretter) - bettlägrig aber geistig durchaus rege - im rosa-weiß geblümten Flanellnachthemd ihre Schwiegertochter Agnes (Sabine Neumayer) durch die Stube; mal ist es ein Kamillentee, mal sind es Tabletten, die sie ordert; und wenn's sein muss, verleiht sie ihrem Willen lautstark mit dem Spazierstock Nachdruck. Kein Wunder, dass der Haussegen bei den Kreitmeiers schief hängt. Zumal Tochter Marianne (Verena Grad) vermeintlich immer noch ohne Hochzeiter dasteht. Der kaputte Bulldog vom gerne mal aufbrausenden Hausherrn Kaspar (Andi Weyerer) trägt da nicht unbedingt zur Entspannung bei.
 |
| Kein Hochzeiter in Sicht? Zenzl Obergschwandler (rechts) hätte zwar einen Kandidaten für Marianne an der Hand. Doch die ist bereits versorgt, auch wenn sie ihr „Studenterl“ zunächst noch im Wäschekorb versteckt. Foto: pil |
Nicht nur die Aussöhnung mit der leidgeplagten Schwiegertochter fädelt Therese schließlich durch ein Komplott mit dem ebenso neugierigen wie dem Schnaps zugeneigten Postboten Xaver (Andi Mayer) als ihrem Komplizen ein. Dem „Großmüadele“ sei Dank bekommt außerdem Marianne letztlich ihren Auserwählten und den Segen ihrer Eltern, obwohl jener Student ist und ein Schwabe dazu. Wolfgang Gar zieht als Martin Ländle zur hellen Begeisterung der Zuschauer beim Schwäbeln alle Register. „Heidenei!“ Und ganz nebenbei bringt die pfiffige Alte auch noch das Leben des verschmähten Hochzeiters Franze ins Lot.
Mit viel Schwung und trefflich dargestellten Charakteren und so mancher Anspielung auf Nußdorfer Gegebenheiten haben die Theaterleit' der „Alpenrose“ ein ums andere Mal die Lacher auf ihrer Seite. Vor dem großen Finale, das sich selbst die örtliche Presse in Gestalt von Emmerich Schmierer alias Michael Staber („Wahnsinn!“) nicht entgehen lässt, muss die unleidige Großmutter nach einem großen Krach im Hause Kreitmeier allerdings einen Akt lang die Bettstatt in der Guten Stube räumen und in ihre Kammer ziehen.
Bleibt anzumerken, dass selbst der neue Pfarrer, der „Bata“ Oswald (Sepp Oberauer; „A Preiß, aber nett.“) nicht leer ausgeht. Denn ihre wahren Trümpfe zieht Therese zu guter Letzt aus den Kissen. Derweil haben Berta (Hilde Niederthanner) und Sophie (Inge Bernrieder) ein ganz anderes Anliegen an ihre Freundin, die selbsternannte Millionenoma: „Hauptsache, es gibt an Kaffee!“ - und hin und wieder eine hochprozentige Medizin.
27. März 2009
 |
| Ausgelassen ist die Stimmung im Wirtshaus am Michaelitag anno 1762.... Fotos: Pilger |
Mit der „Wallfahrt ins Elend“ haben die Nußdorfer Schiffleut' einen ganz besonderen Schwerpunkt bei ihrem 185. Jahrtag gesetzt. Zumal die Inszenierung unter der Leitung von Hans Oberauer mit Bürgermeister Sepp Oberauer und Pfarrer Joseph Reuder durchaus prominent besetzt war.
 |
| ...bis die Nachricht vom Schiffsunglück nahe Leonhardspfunzen aus der ausgelassenen Runde von einem Augenbick zum anderen eine Trauergesellschaft macht. |
Mit viel Applaus bedachten die Zuschauer im vollbesetzten Schneiderwirt-Saal die Vorpremiere der Theatergruppe, für die Renate Benner Kostüme aus dem Fundus des Theater Rosenheim zur Verfügung gestellt hatte. Die Leitung des Innmuseums habe bereits Interesse an einer Aufführung samt Auftritt der Schiffleut-Sänger im Rahmen der Landesgartenschau bekundet, erklärte Schriftführer Bernhard Oberauer anschließend; er hatte gemeinsam mit Hans Straßburger die 20minütige Inszenierung gesanglich untermalt.
Darüber hinaus konnten die Schiffleut auf ein durchaus bewegtes Jahr 2008 zurückblicken. Als Glanzpunkt hob Vorsitzender Hans Dettendorfer die Teilnahme am Trachten- und Schützenzug des Oktoberfestes hervor. Mit mehr als 40 Mitgliedern, einem Kuchelschiff und einem prächtigen Rossgespann waren die Nußdorfer in dem sieben Kilometer langen Festzug zur Theresienwiese mitmarschiert. Für die Schiffleut-Sänger hatte – ebenfalls eine Premiere – im Sommer eine Abendveranstaltung im Innmuseum auf dem Programm gestanden, wo eine Führung mit alten Schiffleut-Liedern begleitet wurde.
Auch den Stand beim „Rosenheimer Frühling“ und das mit 900 Gästen außerordentlich gut besuchte Sommerfest ließ Dettendorfer kurz Revue passieren. Sein Dank galt, neben allen Helfern und Förderern, insbesondere Hans Berger und seinem Montini-Chor für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Darüber hinaus machte er auf die umfangreiche Dokumentation über das Leben und Arbeiten der Nußdorfer während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufmerksam, die nach wie vor zur Einsicht im „Strasser Hof“ ausliegt.
5. Februar 2009
 |  |
| Diese Plätte (linkes Foto), gebaut von Michael Schmidl aus Neubeuern, dem letzten am bayerischen Inn tätigen Schopper und Schiffbaumeister, wurde bis 1967 als Fähre bei Kiefersfelden eingesetzt. Nach dem Tod des letzten Überführers wurde das Schiff der Neubeurer Bruderschaft gestiftet. Überfuhren wie in Kiefersfelden, bei Windshausen, Nußdorf und Neubeuern waren die einzige Möglichkeit, den reißenden Fluss abseits der wenigen Brücken zu queren. Die Passagierschifffahrt gab unterdessen nur ein kurzes Gastspiel auf dem Inn: Der Dampfer „Vorwerts“ (rechts) machte nur wenige Male in Rosenheim fest. Fotos (3): Pilger |
von Marisa Pilger
Neubeuern/Nußdorf - Es herrschte Hochbetrieb auf dem Inn; seinerzeit, als der Gebirgsfluss noch ein ungezähmter, reißender Strom war, und sich dort trotzdem Jahr für Jahr einige hundert Schiffe auf eine Reise voller Gefahren und Unwägbarkeiten machten. Ein Vergleich mit dem Betrieb auf der Autobahn, die den Flusslauf heute streckenweise begleitet, liegt nahe. Denn schon vor einigen hundert Jahren bot sich das Inntal als Verkehrsader nicht nur für den regionalen sondern auch für den länderübergreifenden Handel an – wirtschaftliche Blüte der Anrainergemeinden und Kulturaustausch inklusive.
„Niemand kann sagen, wann sich ein Mensch zum ersten Mal auf einem Baumstamm in den Inn gewagt hat.“, konstatieren die Verfasser des Buches „Innschifffahrt“, das die Neubeurer Schiffleutbruderschaft im Jahr 2004 herausgegeben hat. Doch, heißt es dort weiter, lassen Fundstücke vermuten, dass die Anfänge des Gütertransports auf dem Wasser bis in die Jungsteinzeit zurückreichen. Die Blütezeit des Verkehrs auf der „nassen Strass“ zwischen Hall in Tirol und Passau (von dort ging's meist weiter auf der Donau Richtung Wien und Budapest) aber setzte Mitte des 15. Jahrhunderts ein. Vor allem wurden – als Fortsetzung der Brennerstraße - Waren aus Nord- und Südtirol sowie aus Italien flussabwärts verschifft; es entstand die Handelsachse Venedig, Italien, Tirol, Bayern, Österreich, Ungarn.
 |
| Seit 20 Jahren erinnert ein Gedenkstein an der Innlände in Neubeuern an die Opfer der Innschifffahrt. |
Aus den Inntalgemeinden wurden vor allem Schleif- und Mühlsteine (Neubeuern), Fässer mit Kalk und Zement (Nußdorf und Flintsbach) und Nagelfluh aus der Biber in Brannenburg flussabwärts verschifft. Mit bis zu 2000 Zentnern (100 Tonnen) konnten die einfachen Plätten, Holzboote mit geringem Tiefgang, beladen werden. So wurden in so manchem Stadtpalais in Wien und Budapest damals Steine und Zement aus der Rosenheimer und Tiroler Region verbaut, und in den Stuckdecken barocker Kirchen Gips aus den Nußdorfer Brennöfen. Zu den bekanntesten Schiffsmeistern zählten in Nußdorf wohl Wolfgang Dettendorfer, Simon Untergruber, Georg Regauer sowie Johann Dettendorfer, ein Vorfahre des jetzigen Schiffleut-Vorstands, und in Neubeuern die Hupfaufs, Niedermeier, Scheicher, Johann Auer und Sebastian Pallauf. Am Ende der Naufahrten (flussabwärts) landeten die Boote (bis zu 30 Meter lang und sieben Meter breit), die nach Wien etwa zehn Tage unterwegs waren, meist beim Plättenschinder, wo sie zu Bau- oder Brennholz zerlegt wurden.
Ungleich kräfteraubender, für die Schiffsmeister mit einem bis zu 25-fachen Gewinn aber umso einträglicher, war die Gegenfuhr mit großen Schiffszügen: Drei bis vier Frachtschiffe mit insgesamt 300 bis 400 Tonnen Tragkraft wurden, mit Seilen verbunden, im Pferdezug gegen den Strom geschleppt. Getreide, Schlachtvieh und Wein aus Ungarn gelangten auf diese Weise bis nach Tirol, wo tausende Bergarbeiter Silber und Kupfer förderten. Sechs bis acht Wochen lang mussten sich Schiffleut, Reiter und Rösser plagen, bis sie den Weg von Wien nach Neubeuern bewältigt hatten. Für den Transport der gleichen Ladung auf dem Landweg wären unterdessen hunderte von Pferdefuhrwerken erforderlich gewesen; von fehlenden Straßen und dem Faktor Zeit ganz zu schweigen. Dem Schiffszug voran ritt der Stangenreiter; er suchte die günstigste Fahrrinne für den Schiffszug. Ihm folgte der „Motor“, der Rosszug mit 20 bis 22 „Wasserrossen“, und dahinter zweigte vom Hauptseil der „Aufstricker“ ab. Seine zehn bis zwölf Pferde mussten das Hauptseil durch Zug in oft unwegsamen Gelände über Wasser oder Gestein halten, damit es nicht schleifen konnte und beschädigt wurde.
 |
| Die Zunftstangen der Bruderschaften mit stilisierten Nachbildungen von Innschiffen - hier eine der Nußdorfer Stangen in der Kirche St. Leonhard - werden bei Prozessionen und feierlichen Gottesdiensten mitgeführt. Foto: NN |
Das wirtschaftliche Risiko der Transportunternehmungen trug der Schiffsmeister als der Besitzer des Schiffszuges meist allein. Auf seine Rechnung gingen Schiff und Seilwerk, die Kosten für Waren, Löhne, Verpflegung und Mauten – und der Gewinn. Hatte der Schiffsmeister Glück, wurde er steinreich; hatte er jedoch Pech, ging nicht nur der Schiffszug „baden“. Als Schiffleute verdingten sich unter anderem Bauern aus dem Gebiet um Neubeuern, Nußdorf und dem Samerberg, welche auch die Zugpferde stellten. Aber auch Knechte und Taglöhner waren mit von der Partie.
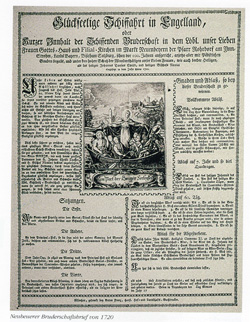 |
| Der Neubeurer Bruderschaftsbrief von 1720, unterzeichnet von Papst Clemens XI, wurde bis 1820/1830 als Mitgliedsausweis ausgegeben; nach der Säkularisation wurde er neu verfasst. Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus dem Buch „Innschifffahrt“, herausgegeben von der Schiffleutbruderschaft Neubeuern. Repro: Pilger |
Sozialen Rückhalt für die Schiffleut und ihre Familien boten die Bruderschaften. Diese Versorgungskassen gewährten alten oder kranken Mitgliedern ebenso wie den Witwen und hinterbliebenen Kindern Unterhaltszahlungen; gespeist wurde der Fonds aus den Beiträgen der Schiffleut und vor allem durch die Zahlungen der vermögenden Schiffsmeister. Waren diese Bruderschaften einst in vielen Orten entlang des Flusses zu finden, halten heute nurmehr drei Vereinigungen die Tradition am Leben: Die der Neubeurer etwa ist seit 1622 urkundlich belegt, bestand aber schon „seit unvordenklichen Zeiten“ und existiert als einzige ohne Unterbrechung bis heute. Währenddessen ist die Bruderschaftsurkunde der Nußdorfer zu deren Leidwesen nicht auffindbar: Sie könnte, so wird befürchtet, 1809 dem Brand der Pfarrkirche von Erl zum Opfer gefallen sein, dem Nußdorf vormals pfarrlich zugeordnet war. Und auch in Wasserburg, dem einstigen Hafen Münchens, von wo aus die königliche Familie aufs Wasser zu gehen pflegte, sind einige hundert Mitglieder in der Kartei vermerkt.
Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes zeichnete sich jedoch auch das Ende der Handelsschifffahrt auf dem Inn ab: Die „nasse Strass'“, jahrhundertelang eine Fernstraße erster Ordnung, verlor als Transportroute zunehmend an Bedeutung und wurde letztlich gänzlich vom Schienenweg abgelöst. Lediglich die Frachtschifffahrt hielt sich noch einige Jahre länger. So saßen am Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur die Schiffleut sondern auch die Schopper (die Schiffsbauer), die Schiffreiter und natürlich die Schiffsmeister buchstäblich „auf dem Trockenen“.
Obgleich der Inn, der seinen Anfang am Maloja-Pass im Engadin nimmt und 517 Kilometer später bei Passau in die Donau mündet, als Handelsweg jahrhundertelang viel befahren war, kam die Personenbeförderung über ein kurzes Gastspiel nicht hinaus. Mehrere Anläufe scheiterten vor allem an der Strömung, den stark schwankenden Wasserständen und einem Mangel an Fahrgästen.
Heute dokumentieren unter anderem Museen Rosenheim, Neubeuern und Wasserburg die ebenso harte wie gefahrvolle Arbeit auf dem Inn. Auch haben es sich die Bruderschaften zur Aufgabe gemacht, Forschung zu betreiben und die Erinnerung wachzuhalten an diesen einträglichen Wirtschaftszweig und zugleich an einen Berufsstand, der mit seinem Brauchtum und seinem Glauben das Leben im Inntal über Jahrhunderte hinweg nachhaltig geprägt hat.
4. Januar 2009
 |
| Sauerstoffgerät und Nasenbrille gehören für Eberhart Mädler, Ansprechpartner der LOT-Gruppe Rosenheim-Ebersberg, zum täglichen Leben. Vor allem bei feucht-kalter Witterung wird für ihn und seine Leidensgenossen „das Atmen zur Arbeit“. Foto: Pilger |
Mögen die Therapie-Systeme – vom Konzentrator über die Sauerstoffdruckflasche bis hin zum Flüssigsauerstoff - auch unterschiedlich sein; eines haben LOT (Long Term Oxygen Therapie)-Patienten gemein: Aufgrund von Erkrankungen der Lunge und/oder des Herzens leiden sie unter chronischem Sauerstoffmangel im Blut – sie bekommen vereinfacht gesagt zu wenig Luft. Reiner Sauerstoff, meist ist eine Versorgung rund um die Uhr erforderlich, ist für sie gemäß dem LOT-Motto im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Dabei liegt beileibe nicht immer eine „Karriere“ als Kettenraucher hinter den Betroffenen. Mädler etwa, zugleich Schriftführer im Bundesverband und Mitarbeiter beim halbjährlich erscheinenden Magazin „O2-Report“, hat sein Leben lang „keine Zigarette angerührt“; er litt bereits als junger Mann unter chronischer Bronchitis, wurde deswegen sogar vom Wehrdienst freigestellt und 1987 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt.
Bereits 1997, im Gründungsjahr von LOT, waren bundesweit rund 45.000 Patienten auf eine Therapie mit dem lebenserhaltenden Elixier Sauerstoff angewiesen – bei steigender Tendenz. Denn längst hat sich die COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) zu einer neuen Volkskrankheit entwickelt.
Oft sind es Kleinigkeiten, kleine Tricks und Kniffe, die das Leben mit dem Sauerstoffgerät erleichtern: Ein Silikonschlauch beispielsweise, weitaus biegsamer und beweglicher als der übliche PVC-Schlauch an der Nasenbrille; der kann auch mal ausgekocht werden und wird bei Kälte nicht so steif, erklärt Mädler. Und um nicht über die „Standleitung“ für die nächtliche Versorgung direkt aus dem stationären 40-Liter-Tank, der in regelmäßigen Abständen vom Sauerstoffzentrum befüllt wird, zu stolpern, hat Mädler in seiner Wohnung meterweise Schlauch über die Türstöcke geführt.
Dauerbrenner bei den Treffen der Gruppe Rosenheim-Ebersberg – eine von insgesamt 23 in ganz Deutschland – aber ist ohne Zweifel das Thema Reisen. Denn Urlaubsfahrten von LOT-Patienten gleichen nicht selten einer logistischen Generalstabsübung. Schließlich muss, zusätzlich zum Gepäck, der sperrige Sauerstoffspeicher – ein 20-Liter-Behälter wiegt immerhin über 40 Kilo - immer mit und im Auto sicher festgezurrt werden. Meist bemisst sich die Dauer des Urlaubs zwangsläufig in Litern Flüssigsauerstoff; entsprechend eingeschränkt ist der Bewegungsradius der Kranken. Der Aufbau eines richtiggehenden Sauerstoff-Tankstellennetzes ist deshalb eines der erklärten Ziele der 1900 LOT-Mitglieder in Deutschland.
9. Oktober 2008
|
Treffen der LOT-Gruppe D ie LOT-Selbsthilfegruppe trifft sich jeden letzten Dienstag im Monat.Auskünfte über den genauen Ort und Zeitpunkt der Treffen erteilt Eberhart Mädler, Telefon 08031/65408. |
 |
| Bodenständig, fröhlich, zufrieden: Die Volksschauspielerin Kathi Leitner, eine frischgebackene "Sechzigerin". Foto: Pilger |
Neubeuern (pil) – Es ist diese vielzitierte Annonce, die den Stein ins Rollen gebracht hat: Per Zeitungsinserat suchte das Chiemgauer Volkstheater seinerzeit eine „jugendliche Liebhaberin“. Die Bürokauffrau Kathi Leitner aus Altenbeuern fackelte nicht lange, stellte sich vor – und bekam die Rolle. So nahm 1969 die Karriere einer ungelernten Schauspielerin ihren Anfang, die sich im Laufe der folgenden Jahre mit zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen in die Herzen der Zuschauer spielen sollte – als fesches Dirndl ebenso wie als reife Charakterdarstellerin, die 1999 mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Vor kurzem feierte die Volksschauspielerin gemeinsam mit der Familie, mit Nachbarn, Kollegen und langjährigen Weggefährten ihren 60. Geburtstag.
Fest verwurzelt in der Heimat, fröhlich und rundum zufrieden – so beschreibt sich Kathi Leitner selbst. Trotz ihrer Erfolge ist sie auf dem Boden geblieben, wohnt mit ihrem Mann in ihrem Heimatdorf und holt als Mitglied des Trachtenvereins „Immergrün“ Altenbeuern für die Fronleichnamsprozession oder das Gaufest „selbstverständlich“ das Kassettl aus dem Schrank.
15 Jahre lang gehörte sie zum festen Ensemble der „Chiemgauer“ und wirkt auch heute noch regelmäßig bei den Fernsehaufzeichnungen mit. Den ersten Fernsehrollen in „Ehen vor Gericht“ (1970) und dem „Königlich bayerischen Amtsgericht“ folgten schnell weitere Engagements; 1973 trat sie erstmals im Komödienstadel auf. Bei den Dreharbeiten zu „Das Schweigen im Walde“ lernte Kathi Leitner 1976 dann ihren Ehemann Manfred, einen Film-Beleuchtungsmeister, kennen.
Nicht weniger bekannt ist ihre „Hilde“, die ebenso resolute wie patente Wirtin des „Café Meineid“ in der gleichnamigen Serie von Franz Xaver Bogner. Mit ihm arbeitet Kathi Leitner seit 20 Jahren zusammen; er war es auch, der ihr die preisgekrönte Hauptrolle der Anna Meier in „Einmal leben“ geradezu auf den Leib geschrieben hat. Noch heute ist sie nahezu sprachlos über die Würdigung, die ihr zuteil wurde; den „Blauen Panther“ aus Nymphenburger Porzellan hütet sie selbstredend wie ihren Augapfel.
Ihrem Runden hat die frischgebackene „Sechzigerin“, die ihre Texte gerne vor dem Fernseher lernt, recht gelassen entgegen geschaut. Zum einen spielt das Alter an sich für Kathi Leitner keine große Rolle, zum anderen ist das Älterwerden für sie kein Grund zum Trübsal blasen; vielmehr vergrößere sich damit das Angebot an Charakterrollen. „Es ist wunderbar, so wie es ist.“, strahlt sie und ist dem Schicksal von Herzen dankbar für ihren Werdegang: „Ich hab' soviel Massel g'habt.“ Nachdenklich wird sie allerdings, wenn sie sich bewusst macht, dass das Leben zeitlich begrenzt ist. „Denn wie viele Jahre hat man mit 60 noch vor sich?“
Langeweile jedenfalls ist ein Fremdwort für die leidenschaftliche Gartlerin. Neben Proben und Dreharbeiten – derzeit steht sie wieder für den „Kaiser von Schexing“ und demnächst auch wieder für „Kanal fatal“ vor der Kamera; neue Folgen von „Unsere Farm in Irland“ sind seit Mitte des Jahres im Kasten – engagiert sie sich unter anderem im Ortsvorsitz der Katholischen Arbeitnehmerschaft (KAB). Und als Patin des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) hatte Leitner lediglich einen Geburtstagswunsch bei ihren Gästen angemeldet: Spenden für die Einrichtung in Rosenheim anstelle von Geschenken.
22. September 2008
Nußdorf/München (pil) - Wenn sich am Sonntag der traditionelle Trachten- und Schützenzug mit rund 8000 Teilnehmern durch die Münchner Innenstadt bewegt, verschlägt es auch die Nußdorfer Schiffleut vom angestammten Inn an die Isar. Insgesamt 50 Männer und Frauen - allen voran ein Stangenreiter hoch zu Pferd – samt Taferlbua werden sich erstmals in der Vereinsgeschichte in den sieben Kilometer langen Oktoberfestzug einreihen; einen Blickfang der besonderen Art bildet dabei das originalgetreu erhaltene, von den Schiffleut-Frauen liebevoll geschmückte Kuchelschiff aus dem Rosenheimer Innmuseum.
Auf der gut zehn Meter langen Plätte mit Haus und Ruder, gezogen von einem prächtigen Vierer-Rossgespann des Nußdorfer „Schneiderwirt“ Wolfgang Grandauer, wurden einst die Mahlzeiten für die Innschiffer gekocht. Der Stangenreiter unterdessen suchte die günstigste Fahrrinne für die Schiffszüge. Diese bestanden zumeist aus drei bis vier großen Frachtschiffen, die Mühlsteine und Kalk ebenso wie Holz, Zement, Kupfer und Wein hunderte von Kilometern auf dem Wasserweg transportierten und bei der Bergfahrt – also flussaufwärts - nicht selten von bis zu 40 Rössern gezogen werden mussten.
Nicht weniger augenfällig präsentieren sich die Schiffleut in ihrer Tracht, die in Anlehnung an alte Zeichnungen und Bilder auf Bestreben des Vorsitzenden Hans Dettendorfer im Jahr 1980 wieder eingeführt wurde. Den wohl markantesten Bestandteil bildet dabei der Hut mit großer Krempe und Goldquaste. Leder-Bundhose, braune Stoffträger, eine rotes Leiberl und eine braune Joppe bestimmen zudem das Erscheinungsbild bei den Männern, während die Frauen bei den Farben für Rock, Mieder und Schürze weitgehend freie Wahl haben.
Bereits am frühen Morgen wird die Plätte, eine Leihgabe von Alfons Altendorfer aus Hochstätt (Schechen) in die Landeshauptstadt transportiert und an der Großmarkthalle „eingespannt“. Am Nachmittag schließlich werden Schiff und Rösser wieder verladen und von der Isar zurück ins Inntal gebracht.
Der Anstoß zur Teilnahme der Nußdorfer war vom Rosenheimer Gauschützenmeister Albin Wied ausgegangen; denn mit von der Partie beim Festzug sind auch Mitglieder des Schützenvereins „Immergrün“ Strasskirchen zusammen mit ihrem Schützenmeister Franz Dutz. Übrigens: Auch bei der Fernseh-Übertragung des Trachten-und Schützenzuges (ARD, 10 bis 12 Uhr) sind die Nußdorfer Schiffleut „im Bild“.
19. September 2008
 |
| Einer von 136 Service-Technikern bei den Paralympics: Orthopädietechnikmeister Andreas Radspieler aus Neubeuern. Das C-Leg, ein per Mikroprozessor gesteuertes Prothesensystem, gehört in seinem Betrieb zum Standard. In Peking werden eher Notfallreparaturen und Feinjustierungen von High-Tech-Geräten gefragt sein. Foto: Pilger |
von Marisa Pilger
Neubeuern – Wenn Andreas Radspieler aus Neubeuern am Samstag abend ins Flugzeug nach Peking steigt, geht es für ihn zwar nicht um Gold, Silber oder Bronze. Trotzdem hat es für den 34jährigen mit dem olympischen Credo „Dabei sein ist alles“ eine ganz besondere Bewandtnis: Der Orthopädietechnikmeister ist einer von 136 Technikern aus insgesamt 31 Ländern, die sich während der Paralympics vom 6. bis 17. September in der chinesischen Hauptstadt der behinderten Athleten annehmen, oder vielmehr deren Arm- und Beinprothesen und Rollstühlen.
Techniker bei den Paralympics, den Spielen nach den Spielen, „das ist die Formel 1 der Prothetik“, schwärmt Radspieler in seinen Geschäftsräumen im Gewerbegebiet Heft. Und tatsächlich ist es der Arbeit während eines Boxenstopps nicht unähnlich, was dem Service-Team des Paralympic-Sponsors Otto Bock Health Care, Kooperationspartner des International Paralympic Committee (IPC) und Weltmarktführer in Sachen Prothetik, im Sportlerdorf und an den 13 Satelliten-Werkstätten bisweilen abverlangt werden wird. Vor acht Jahren in Sydney etwa wurde ein Kniegelenk, das während des Wettbewerbs aus der Verankerung gebrochen war, in aller Eile im Stadion repariert; der Fünfkämpfer gewann Gold. Zwei Jahre später mussten die Experten in Salt Lake City über Nacht einen Ersatz für eine völlig zerbrochene Armprothese anfertigen; die Skifahrerin fuhr damit anderntags auf Platz drei. Und bei den Spielen in Athen etwa hatten die Techniker insgesamt 2200 Arbeitsaufträge abzuarbeiten.
Auf die im Drei-Schicht-Betrieb arbeitenden „Böcke“ verlassen sich nicht nur die etwa 180 deutschen Spitzensportler wie der Leichtathlet Heinrich Popow oder die Radfahrerin Natalie Simanowksi. Gerne nutzen insbesondere finanzschwache Teilnehmer aus Schwellenländern den Service und lassen ihre Rollstühle und Prothesen zum Nulltarif von den versierten Experten warten, feinjustieren und gegebenenfalls reparieren.
Bei Olympia der körperlich Behinderten sind es nicht allein die 4000 Sportler, die Höchstleistungen bringen. Auch die Prothesentechnik ist beim entscheidenden Rennen um Sekundenbruchteile und Millimeter „am Limit“, betont Radspieler. So wirken auf die gerade einmal 180 Gramm schwere Carbon-Feder eines beinamputierten Läufers zeitweise an die 1000 Kilo Last. Der Rohstoff – Prepreg aus Kohlefaser – hätte dabei durchaus auch als Airbus oder als Formel-1-Chassis enden können. Selbst jede einzelne Titanschraube an den hochentwickelten, nicht selten bis zu 50.000 Euro teuren Prothesen wird den Leistungssportlern quasi auf den Leib geschneidert. Hochqualifizierte Techniker sind also geradezu ein Muss.
In dieser Hinsicht hat der gebürtige Niederbayer bereits mehrere Spitzenplätze belegt: Für sein Gesellenstück, eine Unterschenkelprothese, wurde der frischgebackene Orthopädietechniker als bester Absolvent Niederbayerns mit dem Innungspreis ausgezeichnet; 1999 legte Radspieler seine Meisterprüfung in Landshut ab – und erhielt als Jahrgangsbester im Freistaat den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung. Dazwischen tourte er jahrelang rund um den Globus und sammelte in führenden Unternehmen unter anderem in der Schweiz, in Mexiko, den USA und Australien Erfahrungen in seinem Metier. Bevor er sich 2004 selbständig machte, war er mehrere Jahre im International Product Management des Duderstädter Unternehmens Otto Bock Health Care tätig - unter anderem in China.
Dennoch kann Radspieler - Prothesenbauer mit Leib und Seele - seine Aufregung angesichts der minutiös vom IPC durchgeplanten „Dienstreise“ zu den Paralympics nicht verhehlen. „Für mich geht ein Jugendtraum in Erfüllung!“
6. September 2008
Rosenheim (pil) – Das Klischee hält sich hartnäckig: Noch immer gilt Bridge vielerorts als Zeitvertreib für ältere Damen mit wohlonduliertem Haar, wird als elitär und snobistisch belächelt - zumal im vom Schafkopfen und Watten geprägten weiß-blauen Freistaat. Unterdessen widmen sich in Rosenheim mit den Bridgeclubs „Rosenheim 99“ und „Rosenheim-Innstadt“ gleich zwei Vereine einem Kartenspiel, das Hausfrauen ebenso wie Akademiker in seinen Bann zieht. Mag die Mitgliederstruktur der beiden Clubs auch recht unterschiedlich sein; über den besonderen Reiz des Bridge sind sich die Vorsitzenden Heinz Brenner und Meng-Hiang Bach einig: „Das ist echter Denksport“, eben ein „wunderbares Gehirnjogging“. Denn neben einem guten Gedächtnis, Intuition und strategischem Denken erfordert das „Schach unter den Kartenspielen“ höchste Konzentration und sehr viel Übung.
Jeden Montag, Dienstag und Freitag spielen die „99er“ – der Club wurde 1999 nach der Abspaltung von der „Innstadt“ aus der Taufe gehoben – im Gasthaus Höhensteiger in Westerndorf St. Peter ihre Trümpfe aus. Mit 35 Damen und sieben Herren spiegelte sich dort jüngst auch ganz klar der Frauenüberhang im Deutschen Bridgeverband wider: Von den bundesweit rund 30.000 Mitgliedern sind etwa 80 Prozent weiblich.
 |
| Bidding Box und Board zählen zur Grundausrüstung eines jeden Bridgeclub. Gespielt wird mit dem französischen Blatt ohne Joker. Foto: Pilger |
Wortlos und mit viel Bedacht wurden beim Reizen die Bietkarten aus der roten „Bidding Box“ gezogen und - einer Auktion nicht unähnlich - ausgehandelt, welches Paar wie viele Stiche machen muss und ob es eine Trumpffarbe gibt. Ebenso leise ging anschließend das Abspielen über die Bühne, wobei es galt, die Vorgaben des soeben geschlossenen Kontrakts zu erfüllen.
Den Ablauf dieses internen Turniers hatte Renate Grinzinger organisiert, einer der insgesamt sieben geprüften Spielleiter bei den „99ern“. „Eine sehr diffizile Angelegenheit“, so Brenner, zieht man das ausgetüftelte System in Betracht, nach dem die Kartenboards weitergereicht werden und die Besetzung an den Tischen alle 25 Minuten wechselt. Dazu kommt das Computerprogramm für die Auswertung.
Die meisten der 78 Mitglieder des Clubs, der bei regionalen ebenso wie bei Landesliga-Turnieren vertreten ist, haben ihren 50. Geburtstag bereits hinter sich. Wie etwa das Ehepaar (sie 83, er 85) aus Übersee, das wie viele andere auch regelmäßig Bridge-Reisen in aller Herren Länder unternimmt; nach Südafrika etwa oder in die USA und nach Teneriffa. Die Älteste unter den Aktiven erblickte das Licht der Welt sogar vor dem Ersten Weltkrieg; 70 Jahre Spielpraxis kann die betagte Dame vorweisen, die immer noch regelmäßig an den Nachmittags-Partien teilnimmt.
Am Anfang jeder Bridge-Karriere aber steht eine richtig gehende schulische Ausbildung. „Bridge erfordert die hohe Bereitschaft etwas zu lernen.“, betont Brenner. Er ist vor zehn Jahren in die komplexe Welt von Konventionen, Pass und 7 Sans eingetaucht; alle anderen Kartenspiele hatten ihn nach eineinhalb Stunden gelangweilt. Doch „man braucht Jahre, um ein passabler Clubspieler zu werden.“, verdeutlicht der 66jährige Ausbilder aus Dettendorf-Au. Und so streiche rund ein Viertel der Anfänger – in seinem Club werden derzeit 25 Bridgeschüler ausgebildet - die Segel wieder.
Ganz gezielte Nachwuchsarbeit betreibt auch Meng-Hiang Bach von „Rosenheim-Innstadt“. Ihr Faible fürs Bridge entdeckte sie zufällig vor zehn Jahren, als ein Tennismatch wegen Regens ins Wasser fiel. Nun will die 65jährige Stephanskirchnerin sowohl bei der Fachhochschule als auch an den Gymnasien kräftig die Werbetrommel rühren. In München beispielsweise hätten bereits verschiedene Schulen Bridge in ihren Wahlfachkatalog aufgenommen.
Auf gerade einmal zehn Mitglieder war der Innstadt-Club zusammengeschrumpft, bevor Bach dort im Jahr 2005 den Vorsitz übernommen hat. Mittlerweile treffen sich 35 Aktive - „Tendenz steigend“ - im Alter zwischen 35 und 70 Jahren in wechselnder Besetzung mittwochs beim Alten Wirt in Aising zum Spielabend. Untypisch für einen Club in der Provinz sei dabei die hohe Männerquote von etwa einem Drittel. Auch eine „Innstadt“-Mannschaft, die sich nun den Aufstieg von der Kreisklasse in die oberen Ligen erkämpfen will, hat die Vorsitzende wieder aufgebaut.
Mit einem Wanderpokal hofft die in Singapur geborene Chinesin darüber hinaus, die Kontakte zu den „99ern“ ebenso wie zum Bridgeclub Prien-Traunstein zu vertiefen. Ausgespielt wird der Cup das nächste Mal am Sonntag, 27. Juli, ab 10 Uhr im Gasthof Höhensteiger, bei einem von „Rosenheim 99“ ausgerichteten Turnier.
Weitere Auskünfte übers Bridgespielen, über Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie das Vereinsleben in den Clubs gibt’s bei Heinz Brenner („Rosenheim 99“; 08064/477) beziehungsweise bei Meng-Hiang Bach (“Rosenheim- Innstadt“, Telefon 08031/70191).
23. Juli 2008
Bridge im Überblick
Unter Bridge – einem Kartenspiel für vier Personen - versteht man heute die moderne Variante des Kontrakt-Bridge, die sich seit den 30er Jahren des 20. Jahrhundert weltweit durchgesetzt und ihren Vorgänger, den englischen „Whist“, weitgehend verdrängt hat. Das Regelwerk stellte der Segler Harold S. Vanderbilt im Jahr 1925 zusammen.
Gespielt wird mit dem französischen Blatt ohne Joker, also mit 52 Karten in den Farben Pik, Coeur (Herz), Karo und Treff (Kreuz). Um eine Partie öfter spielen zu können, werden Boards verwendet, Kunststoffboxen mit vier Fächern für die Karten der vier Spieler. |
 |
| Begleiteten die Zeitreise im Innmuseum musikalisch: Bariton Bernhard Oberauer(Mitte) und Hans Straßburger, Bass, in der Nußdorfer Schiffleut-Tracht mit Harfenistin Christiane Obermeyer. Foto: Pilger |
Rosenheim/Nußdorf (pil)– Es war eine Premiere der besonderen Art, die die Nußdorfer Schiffleut-Sänger den Teilnehmern einer abendlichen Führung durchs Rosenheimer Innmuseum bescherten; denn erstmals wurde die Zeitreise in dem historischen Bruckbaustadel zurück in die Epoche der Inn-und Donau-Schifffahrt auch musikalisch begleitet. An verschiedenen Stationen des Rundgangs untermalten Bernhard Oberauer (Bariton) und Hans Straßburger (Bass) gemeinsam mit der Harfenistin Christiane Obermeyer die ebenso fesselnd wie humorvoll vorgetragenen Ausführungen von Lydia Winner mit acht alten Schiffleut-Liedern. Die religiösen Texte spiegeln dabei die tiefe Verankerung der damaligen Schiffleut im christlichen Glauben wider; doch wurde seinerzeit auch die weltliche Seite des Lebens in zahlreichen Liedern besungen, wie das Repertoire der Nußdorfer beweist.
Rund 60 Interessierte - darunter Vertreter der drei einzigen existierenden Schiffleutvereine beziehungsweise -bruderschaften aus Wasserburg, Neubeuern und Nußdorf - hatten sich gemeinsam mit Gastgeber Paul Geisenhofer, dem Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim, auf die Spuren der Innschiffer und ihrem Leben auf und mit dem oftmals gefährlichen Gebirgsfluss begeben. „Laien“ ebenso wie die Schiffleut-“Experten“ zeigten sich dabei durchwegs angetan von dem Abend, der mit dem gemeinsam gesungenen „Und die Schiffleut san a Leut“ stimmungsvoll ausklang.
Bereits seit geraumer Zeit haben es sich die Nußdorfer zur Aufgabe gemacht, längst vergessenes Liedgut rund um die einstigen „Handlungsreisenden“ zu neuem Leben zu erwecken. Erste Kostproben lieferte das Trio bereits bei den Jahrtag-Gottesdiensten in der St.-Leonhard-Kirche.
Unterstützung bei ihren Nachforschungen erhielten die Musiker insbesondere von Ernst Schusser, dem Leiter des Volksmusikarchivs Oberbayern, sowie vom Vorsitzenden der Neubeurer Schiffleut, Rupert Stuffer. Fürs Einstudieren der überarbeiteten Arrangements aus vergangenen Jahrhunderten hatte sich das kleine Ensemble zudem eine professionelle Sängerin mit ins Boot geholt.
Nun hoffen die engagierten Nußdorfer Sänger, dass bald noch mehr alte Schiffleut-Lieder „auftauchen“ und dann wieder gesungen werden.
15. Juli 2008
Rosenheim (pil) – Tastbare Markierungen auf dem Temperaturregler der Waschmaschine, für jeden Banknoten-Wert eine spezielle Faltung, die langärmeligen Blusen immer ganz rechts im Kleiderschrank – es sind oftmals recht simple Kniffe, die Blinde und Sehbehinderte ganz systematisch für sich und eine möglichst selbständige Lebensführung nutzen. Die Liste ließe sich wohl beliebig fortsetzen; eines aber muss bei allen Betroffenen ganz oben stehen: Ordnung. „Die ist ganz wichtig!“, weiß Pauline Kottmair; ebenso „sich Zeit lassen“. Die ehemalige Buchhalterin ist selbst beinahe blind, musste mit Ende fünfzig ihren Beruf aufgeben und engagiert sich seit nunmehr 14 Jahren ehrenamtlich im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB).
Mehr als 80.000 Blinde und sehbehinderte Menschen – sei es das blindgeborene Kind; sei es der Maurer, dem ätzender Zement in die Augen spritzte; sei es die Rentnerin, die am Grünen Star leidet - leben nach Schätzung des BBSB im Freistaat. Für rund 800 Mitglieder bildet dabei die Rosenheimer Bezirksgruppe mit einem dichten Netz an Beratern in Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Traunstein, Burghausen, Altötting, Mühldorf und Miesbach eine wichtige Anlaufstelle nicht nur bei sozialrechtlichen Fragen. In enger Zusammenarbeit mit Sozialpädagogen in München leisten die ehrenamtlichen Mitarbeiter beispielsweise Hilfestellung beim Antrag auf Blindengeld oder vermitteln Umschulungen im Berufsförderungswerk Veitshöchheim.
 |
| Ohne Bildschirmlesegerät wäre für viele Sehbehinderte die tägliche Zeitungslektüre undenkbar, erklärt Pauline Kottmair, die Leiterin der BBSB-Bezirksgruppe Oberbayern-Rosenheim. In der Beratungsstelle in der Innstraße können vor dem Kauf verschiedene Modelle getestet werden. Foto: Pilger |
Ziel der Selbsthilfeorganisation ist es, die Selbständigkeit Blinder und Sehbehinderter so weit wie möglich zu erhalten. Die dort angestellte Rehabilitationslehrerin Caroline Müller zielt mit ihren Trainings deshalb vor allem auf die Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten wie Bügeln, Gemüseschneiden oder Einkaufen ab. Denn mit dem schwindenden Sehvermögen, so ihre Erfahrung, setze nicht selten der soziale Rückzug ein; viele wagten nicht mehr, am Leben teilzunehmen. „Sicher und effektiv“ - das ist die Maßgabe, die Müller mit ihrem „Unterricht“ verfolgt. Einfache Orientierungshilfen etwa beim Essen, wenn das Schnitzel auf zwölf und der Kartoffelsalat auf neun Uhr liegt, erleichterten die Sache ganz beträchtlich.
„Blinde sollen ihrer Umgebung ihre Techniken und Ansprüche mitteilen.“, ermuntert auch Pauline Kottmair alle Betroffenen, die trotz ihrer Eigenständigkeit doch immer wieder auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Die Sehenden sollten sich zwar nicht scheuen, am Fußgängerüberweg oder im Supermarkt ihre Hilfe anzubieten, jedoch einen Blinden niemals kurzerhand am Arm nehmen oder gar mit sich ziehen. „Offen sein, miteinander reden.“, lautet ihre Devise.
Von „sprechenden“ Ampeln können sich im Stadtgebiet Blinde bislang ohnehin nur an drei Stellen (am Bahnhof, an der Ebersberger Straße und in der Innstraße) über die Straße leiten lasse. Doch, ergänzt Kottmair, gab es im Zuge der umfangreichen Umbauten von Straßen und Plätzen grünes Licht für weitere Standorte.
Um das Thema Blindheit, das vor keiner Altersgruppe halt macht, schon frühzeitig ins Blickfeld von Kindern zu rücken, gehören Besuche in Grundschulen zum festen Programm der Bezirksgruppe. Den weißen Stock als Erkennungszeichen kennen fast alle, ebenso die gelbe Armbinde mit den drei schwarzen Punkten. Das Prinzip der Braille-Schrift aber, die zu erlernen Kottmair den Betroffenen ans Herz legt, ist nicht nur für viele Schulkinder Neuland.
Mit Tandemfahren, Skilanglauf und – dank der Unterstützung der DAV-Sektion Bad Aibling – Bergwanderungen, mit Mehrtages-Ausflügen und Weihnachtsfeier hat der BBSB, der sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüssen finanziert, außerdem einiges an Freizeitaktivitäten zu bieten. Nicht zu vergessen der Stammtisch, der an jedem ersten Montag im Monat ab 14.30 Uhr in der „Südtiroler Stub'n“ im Rosenheimer Bahnhof zusammen kommt. Und dort, fügt Kottmair an, serviert die Bedienung das Bier auf elf Uhr.
20. Juni 2008
Kontakt zum BBSB
D ie Beratungsstelle des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) in der Innstraße 43 in Rosenheim ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.Sie ist telefonisch erreichbar unter 32555. |
von Marisa Pilger
 |
| Anwohner, Gemeinderäte und Naturschützer haben ihren Protest an der Landesgrenze plakativ zum Ausdruck gebracht. Foto: Pilger |
Derweil machen nicht nur Gemeinderäte und Anwohner aus Nußdorf – insbesondere aus dem 300 Einwohner zählenden Ortsteil Hinterberg – massiv Front gegen das Vorhaben unweit des Heilig-Kreuz-Kircherls in Windshausen. Auch hat sich der Bund Naturschutz ganz klar gegen das Vorhaben ausgesprochen. Ein Gewerbegebiet mitten auf grüner Flur, weit abseits der Ortschaft, ohne geeignete Infrastruktur - diese Argumente führen die Gegner ins Feld. Die Nußdorfer befürchten vor allem eine deutliche Zunahme der Verkehrsbelastung im Ort sowie auf der Verbindungsstraße nach Erl. Die nächsten Autobahnanschlussstellen Brannenburg/Nußdorf beziehungsweise Oberaudorf/Niederndorf liegen jeweils etwa sieben Kilometer von dem angestrebten Gebiet entfernt, verdeutlicht Hans Obermeyer aus Urstall. Im Falle einer Genehmigung aus Innsbruck, so die Befürchtung, werde Richtung Erl bald „scheibchenweise“ eine Wiese um die andere zum Gewerbegrund umfunktioniert.
Schützenhilfe bei ihrem Feldzug erhalten die Bayern von den Tiroler Grünen. „Wenn es in Tirol noch Spielregeln gibt, darf dort nicht gebaut werden.“, bringt der Clubobmann (Fraktionsvorsitzende) Georg Willi seine Sicht der Dinge auf den Punkt. Jahrelang habe man im Sinne einer vernünftigen Raumordnung um das im September 2007 vom Landtag verabschiedete Regelwerk „Zukunftsraum Tirol“ gerungen, das besonderes Augenmerk auf „die Eindämmung des Flächenverbrauches“ sowie „die möglichst weitgehende Erhaltung zusammenhängender Freiräume“ legt. „Neue Gewerbe- und Industriegebiete müssen (...) eine optimale Standorteignung aufweisen...“, heißt es dort weiter. Die fehlende Verkehrs-Infrastruktur laufe diesen Anforderungen jedoch ebenso zuwider wie die an sich hochwertige landwirtschaftliche Fläche in einer wunderbaren Landschaft; zumal in und um Erl noch genügend Gewerbeflächen zur Verfügung stünden – allein im Ortsbereich noch 1,5 Hektar. Nicht zuletzt bilde das umstrittene Areal mit dem angrenzenden Bauernhof einen sogenannten „geschlossenen Hof“. Diese Einheit, so Willi, dürfe nicht ohne weiteres aufgespalten werden.
Erst vor wenigen Monaten hat der Rosenheimer Kreistag die neue Verordnung für das Landschaftsschutzgebiet Inntal-Süd beschlossen. Die werde beispielsweise in Nußdorf sehr streng gehandhabt, verdeutlicht Georg Binder, Ortsvorsitzender der Bund Naturschutz-Ortsgruppe Nußdorf-Neubeuern; gleich hinter der Grenze aber sei sie völlig ohne Belang. „An der engsten Stelle des Inntals – schlechter plaziert geht’s nicht!“, wettert er gegen das Erler Ansinnen, das demnächst auch beim Landesverband der Naturschützer auf der Tagesordnung stehe. Zudem werde das betreffende Areal als Reservefläche im Falle eines Hochwassers benötigt.
Geschlossenheit haben auch die 15 Nußdorfer Gemeinderäte in ihrer Stellungnahme zu den Plänen der Nachbarn in Tirol demonstriert. Den bayerischen Kommunalpolitikern stößt neben der Zersiedelung der Landschaft samt Beeinträchtigung von Natur, Tourismus und Naherholung vor allem die drohende Zunahme des Verkehrs im ohnehin schon stark belasteten Ortsbereich sauer auf. Eine Tonnage-Beschränkung auf der Kreisstraße Richtung Landesgrenze wurde bereits beim Landratsamt beantragt. Darüber hinaus bedauert das Gremium in seinem Beschluss die „zurückhaltende Informationspolitik auf Tiroler Seite“, die von einer Anhörung Nußdorfs abgesehen hatte.
Diese sei bei einer Einzeländerung wie dieser rechtlich nicht zwingend, erläutert dazu der Bürgermeister Erls, Georg Aicher-Hechenberger. Zudem handele es sich bei dem Vorhaben um ein Gewerbegebiet, dessen angehängter Branchenkatalog verkehrsintensive Betriebe – auch im Interesse der Erler Bürger – ausschließe. Denkbar wäre an dieser Stelle produzierendes Gewerbe ohne große Logistik. Ein Immobilienhändler habe bereits einen entsprechenden Interessenten in Aussicht gestellt, der auf dem größten Teil des Areals in Schwaigen einen Betrieb mit 70 bis 80 Arbeitsplätzen ansiedeln wolle; über die genaue Branche sei er bislang jedoch nicht informiert, ergänzt der Bürgermeister.
Ohnehin kann der Rathaus-Chef der 1450-Seelen-Gemeinde Erl die ganze Aufregung beim „befreundeten Nachbarn“ nicht recht nachvollziehen. „Es tut mir leid, dass Nußdorf dies als Bedrohung sieht.“; schließlich handele es sich um „eine normale Entwicklung einer Gemeinde, die Arbeitsplätze schaffen will“.
Währenddessen haben sich die Nußdorfer auch an die Bayerische Staatskanzlei gewandt. Bürgermeister Sepp Oberauer indes ist bislang mit seinen Bemühungen um ein klärendes Gespräch mit den österreichischen Politikern, Landeshauptmann Herwig van Staa und Landesrat Hannes Bodner, gescheitert.
8. Juni 2008
Nußdorf (pil) – Dass es oft die kleinen Laienbühnen sind, die für eine gelungene Abendunterhaltung sorgen, beweist derzeit die Theatergruppe des Nußdorfer Trachtenvereins „Alpenrose“. Turbulent geht’s zu in der Stube von Anni und Wastl Durstig, wo an einem Freitag, den 13., das Schicksal seinen Lauf nimmt. Da wird lamentiert und gebockt, geheiratet und ausgetrickst, versteckt, gesucht, herbeigeschafft und nochmals versteckt – und schließlich verliert ein Unglückstag wie er im Kalender steht sogar für die abergläubische Anni seinen Schrecken. Die gut 160 Zuschauer, darunter Horst Rankl, der Präsident des Verbandes Bayerischer Amateurtheater, honorierten die amüsante Premierenvorstellung im Schneiderwirt-Saal jedenfalls mit reichlich Beifall.
 |
| Eine Bratpfanne als Ruhekissen für die betäubte Rosl, ein Berg verschwundener Geschenke und eine ratlose Hochzeitsgesellschaft: Recht turbulent geht’s am „Freitag, der 13.“ mit den Nußdorfer Trachtlern zu. Foto: Pilger |
Mit ihrer Inszenierung des gleichnamigen Mundartstücks von Franz Schaurer führen die Nußdorfer Trachtler die für Bayern typische Form des Wirtshaustheaters mit Brotzeit, Bier und Blasmusik fort. Direkt greifbar ist dabei die Spielfreude der Darsteller. Christine Dräxl alias Rosl etwa wird ihrem Programm-Beinamen „Schnapperl“ voll gerecht. Sie versteht es, ihre Rolle nicht ins Alberne abgleiten zu lassen und spielt die Hausgenossin der Durstigs einfach nur so richtig komisch – und zwar im besten Sinne des Wortes. Eine besondere Herausforderung, wenn man bedenkt, dass der Darstellerin selbst trotz dümmlich-naiver Grimassen, siebeng'scheiter Einlassungen, Bratpfannen-Kämpfen und Fingerspielen kein Lachen auskommen soll.
Und auch Andi Weyerer, der sich mit der Rosl nur zu gerne Wortgefechte liefert, ist als Wastl Durstig ganz in seinem Element. Muntert er als besorgter Ehemann anfangs noch mit Bedacht seine Malheur-geplagte Anni auf, gerät er als Bräutigamvater ein Dreivierteljahr später, selbstredend an einem „Freitag, 13.“, wegen der „gestohlenen“ Hochzeitsgeschenke vollkommen außer sich. Und wenn es ihm die Sprache verschlägt, spricht stattdessen sein Gesicht Bände.
Sein besonnener Sohn Georg (Andi Mayer) hat unterdessen den Streich seiner durchtriebenen Spezln Sepp (Martin Grad) und Loisl (Seppi Oberauer) bei dieser „fast kriminellen Hochzeitsfeier“ längst durchschaut und setzt der allgemeinen Verwirrung noch eins drauf: Gemeinsam mit Klara, seiner Frischangetrauten (Verena Weyerer), lässt er die Geschenke kurzerhand ein weiteres Mal verschwinden.
Zum Schluss aber sieht nur noch der Loisl einen Grund, warum ein Freitag der 13. nicht unbedingt zum Glückstag taugt...
Noch dreimal stehen die Nußdorfer Trachtler mit dem ländlichen Schwank „Freitag, der 13.“ auf der Bühne; für Unterhaltung während der Pausen sorgt die Theatermusi. Karten für die Vorstellungen am Mittwoch, 12., und Freitag, 14. März (Beginn jeweils um 20 Uhr), sowie für Sonntag, 16. März, (17 Uhr) gibt’s im Gemeindeamt; Restkarten an der Abendkasse.
10. März 2008
von Marisa Pilger
Raubling - Harald Liebhaber schaut zwar gerne und oft bei "www.sauspiel.de" rein, um dort ein Solo, einen Geier oder einen Ramsch zu spielen. Die Partien beim Weltrekordversuch im Dauerschafkopfen, den der 36jährige gemeinsam mit dem noch jungen Internetportal beim Huberwirt in Raubling organisiert, werden jedoch in jedem Fall „offline“ ausgekartelt.
Seit 20 Jahren ist der Raublinger mit der Oidn, dem Eisenbahner und dem Wenz auf Du und Du. Gelernt hat er das Schafkopfen ganz klassisch in der Familie, von den Eltern. Und später, in München, fand sich rasch eine Vierer-Runde samt Kiebitz zusammen, die sich einmal in der Woche gegenseitig die Trümpfe aus der Tasche zog. Irgendwann wanderten die Zehnerl und Fuchzgerl aus den Gewinnen dann nicht mehr ins Portemonnaie eines jeden Spielers sondern in eine große Blechbüchse. Und schon nach einem halben Jahr hatten sich dort 2000 Mark angesammelt, die ausgegeben werden wollten, erzählt Liebhaber schmunzelnd. Was lag da näher, als in privater Runde ein Sommerfest mit Spanferkelessen auszurichten – ein Schafkopfturnier zur Entspannung inklusive. „70 Stunden haben wir zusammengebracht.“, erzählt er, und damit - „ohne es zu wissen“ - den damaligen offiziellen Weltrekord um beinahe die Hälfte überboten.
 |
| Wird Anfang Juli in Raubling ein neuer Weltrekord im Dauerschafkopfen aufgestellt? Gegen dieses Blatt von Harald Liebhaber hätte „sauspiel“-Geschäftsführerin Agnes Reissner jedenfalls keine Chance; allerdings ist der „Sie“ nur gestellt. Foto: Pilger |
Gemeinsam mit Agnes Reissner (27), Mitbegründerin und Geschäftsführerin von "sauspiel.de", und acht Helfern war er deshalb in den vergangenen Wochen vollauf mit der Logistik für den Dauerschafkopf vom 2. bis 6. Juli, beschäftigt. Er hat Genehmigungen eingeholt, Unterkünfte gebucht, Kaffeeautomaten besorgt und Sponsoren für das mehrtägige Rund-um-die-Uhr-Karteln mobilisiert. Allein die Versorgung der 28 Spieler an den sieben Tischen und ihrer Betreuer – diese werden zugleich als Zeugen für Guinness Records vereidigt – werde einige tausend Euro kosten, schätzt Liebhaber, der im Berufsleben als Beratungsstellenleiter bei der Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. eher mit Zahlen denn mit Karten jongliert.
Den Teilnehmern wird allerdings einiges abverlangt werden: Pro Stunde gibt es nur fünf Minuten Pause zum Ausruhen, Rauchen, Bieseln und Telefonieren, die „gesammelt“ werden können; das macht unterm Strich pro Tag zwei Stunden „Freizeit“ vom Kartentisch. Nicht von ungefähr gibt daher der Psychotherapeuth Dr. Frank Giesen beim Probelauf am 30. Mai Tipps zur Vorbereitung und informiert über psychische und physische Folgen des Schlafentzugs. Dem Siegertisch winkt im Gegenzug – neben einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde – ein „sattes Preisgeld“.
„Mit dem Weltrekord wollen wir auch die Jugendlichen mobilisieren.“, erklären Reissner und Liebhaber; denn selbst im Freistaat könnten viele Junge, so ihre Beobachtung, gar nicht schafkopfen. Deshalb ist im Rahmenprogramm des Rekordversuchs neben Turnieren (Anmeldung erforderlich) und freien Spielrunden auch ein Lernabend für Anfänger und Wiedereinsteiger geplant.
Jedenfalls warten bereits fünfzehnhundert Packerl Karten – auf der Rückseite mit dem Text der Bayernhymne und dem Logo des Berliner Interneportals bedruckt – darauf, ins Spiel gebracht zu werden. Die endgültige Auswahl der Teilnehmer nimmt „sauspiel.de“ am 31. März vor. Bei den Anmeldungen, so Reissner, sind bislang allerdings noch kaum Schafkopfer aus der Region von der Partie.
9. März 2008
| Erst im April des vergangenen Jahres ist das Internetportal „sauspiel.de“ online gegangen. Der Startschuss fiel damals mit 200 Testspielern; mittlerweile ist die Schafkopf-Community auf mehr als 30.000 Kartler aus der ganzen Welt angewachsen, berichtet Geschäftsführerin Agnes Reissner nicht ohne Stolz. Gemeinsam mit Jan Bromberger, Martin Kavalar und Stephan Eichler hat sie das bayerische Kartenspiel im fernen Berlin netzfähig gemacht. Rund um die Uhr kann so - beim Chat auf bayerisch - am virtuellen Wirtshaustisch geschafkopft werden, gegen einen Monatsbeitrag auch im Vereinsheim oder aber - seit kurzem – um bare Münze in der „Zockerstub'n“. Übrigens: Im Lauf von neun Millionen „sauspielen“ wurde bereits zweimal ein „Sie“ - alle vier Ober und Unter auf einer Hand - auf den Tisch gelegt. 9. März 2008 |
 |
| Fährt zum Landesentscheid von "Jugend forscht": Emanuel von Oy aus Griesstätt. |
Griesstätt (pil) – Die Kresse hat es ihm angetan. Bereits zum dritten Mal ist der 15-jährige Emanuel von Oy mit einer Projektarbeit über die Gewürzpflanze bei einem Wettbewerb von „Jugend forscht“ angetreten. Und wie im vergangenen Jahr in Schongau holte der Griesstätter diesmal beim Regionalwettbewerb in Ottobrunn den ersten Platz im Fachbereich Biologie; er darf damit Ende März am Landeswettbewerb im Deutschen Museum in München teilnehmen.
Seine Forschungsarbeit hat der Schüler im Vergleich zu 2007 um zwei Komponenten erweitert. Zusätzlich zum Einfluss von farbigem Licht auf Keimungsverhalten und Wachstum von Kresse- und Senfpflanzen untersuchte Emanuel von Oy - Sohn eines Landschaftsgärtners - diesmal auch die Auswirkungen der Erhöhung des CO2-Gehalts in der Luft. Zudem ließ der 15jährige seine Versuche unter energiesparenden LEDs ablaufen. Beide Faktoren, so die Beobachtung des Nachwuchsforschers, der die 9. Klasse der Privaten Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer in Rosenheim besucht, hätten sich dabei positiv aufs Wachstum der Pflanzen ausgewirkt.
Insgesamt waren bei dem von der EADS ausgerichteten Regionalentscheid in Ottobrunn 77 Teilnehmer aus dem Raum München und Oberbayern-Ost mit 56 Projekten in sieben verschiedenen Fachgebieten angetreten. Mit einem Sieg hatte der Griesstätter angesichts der starken Konkurrenz allerdings nicht gerechnet.
Dabei ist Emanuel von Oy beinahe schon ein „alter Hase“, was "Jugend forscht" anbelangt: Bereits 2005 hatte der Schüler die Qualität von Eingefrorenem unter die Lupe genommen und war dafür mit dem Deutschen Umwelttechnikpreis ausgezeichnet worden.
6. März 2008
Rosenheim (pil) – Die zweite Hotelküche samt Restaurant, die bis zum Herbst in der Berufsschule I eingerichtet werden sollen, machen es möglich: „Ab dem kommenden Schuljahr ist die Ausstattung für Blockunterricht vorhanden.“, erklärt Schulleiter Gerhard Heindl. Bislang ist der Schulbetrieb in der Prinzregentenstraße für die rund 500 Auszubildenden zum Koch, Hotel- oder Systemgastronomiefachmann als Einzeltagesunterricht organisiert. Eine Änderung des Modus würde jedoch nicht nur die Schule „grundsätzlich begrüßen“. Der Samerberger „Entenwirt“ Peter Schrödl etwa ist ein klarer Befürworter des Blockunterrichts.
Eine Blockdauer von insgesamt 14 (Koch) beziehungsweise 15 Wochen im ersten Lehrjahr sowie jeweils 9 Wochen in den beiden folgenden Jahrgangsstufen sieht das Kultusministerium im Gastronomiebereich vor. Blockunterricht, der in Rosenheim etwa für Elektro- und Metalltechniker auf dem Stundenplan steht, brächte aus Heindls Sicht auch in der Gastronomie „deutliche Vorteile“. So könnten sich die Lehrlinge über einen Zeitraum von jeweils ein bis zwei Wochen ausschließlich auf den Unterrichtsstoff konzentrieren. Mit „Schule am Stück“ ließen sich außerdem Projektarbeiten viel besser umsetzen. Zudem, ergänzt Schrödl, kämen die Jugendlichen ohne eine vorangehende Spätschicht im Ausbildungsbetrieb ausgeruht zum Unterricht. Der Blockunterricht - wie ihn die Berufsschulen Traunstein, Freilassing und Miesbach praktizieren – würde seiner Meinung nach das Ausbildungsniveau wie auch die Abschlussnoten der Gastronomie-Lehrlinge deutlich steigern.
Gut geführte Wirtschaften, mahnt Schrödl, „sind überlebenswichtig für den Tourismus im Landkreis“. Allein am Samerberg habe im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte rund die Hälfte der vormals 20 Wirtshäuser und Almen dichtgemacht. Und der Trend setzt sich fort, befürchtet der Gastwirt und Lehrherr. Auch deshalb müssten kaufmännische Inhalte künftig mehr Raum einnehmen im Berufsschulunterricht. Der 47jährige - gelernter Metzger und Koch - hat selbst erst vor wenigen Jahren sein berufsbegleitendes Studium zum Hotelbetriebswirt (HMA) abgeschlossen.
Auch im Kreisvorstand des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG) werde das Thema Blockunterricht demnächst wieder aufgegriffen, wie Vorsitzender Franz Bergmüller auf Anfrage erklärte. Allerdings habe die Kreisversammlung erst vor einigen Jahren ein entsprechendes Ansinnen mehrheitlich abgelehnt. Ohnehin gibt Bergmüller der praxisbezogenen überbetrieblichen Ausbildung zu speziellen Themenbereichen (etwa Büfett-Organisation oder Fisch-Küche) ganz klar den Vorzug gegenüber dem Blockunterricht. Die Schule am Stück, ist er überzeugt, schmälere außerdem „die Ausbildungsbereitschaft von kleineren Betrieben“.
Dort könnte es zwar durchaus zu personellen Engpässen kommen, räumt Schrödl ein. Und wer während der Schulzeit längere Zeit wegen Krankheit fehlt, müsste mehr Unterrichtsstoff nachholen als bisher; doch insgesamt „überwiegen eindeutig die Vorteile“. So könnten dann auch betriebliche Schulungen oder der Urlaub besser geplant werden.
Über die Form des Unterrichts hat letztlich der Berufsschulbeirat zu entscheiden, in dem neben Schule und Landkreis unter anderem die IHK sowie die Arbeitgeber vertreten sind. Doch keinesfalls, betont Schulleiter Heindl, werde der Blockunterricht gegen den Willen der Ausbildungsbetriebe – im Bereich Gastronomie sind dies in Stadt und Landkreis derzeit rund 250 – eingeführt.
Zu einem Konsens mit den Wirtschaften rät auch Alexandra Gehlhaar, die Geschäftsführerin der IHK-Stelle Rosenheim. Zwar berge der Blockunterricht sicherlich Vorteile. Doch ebenso müsste eine Reihe organisatorischer Fragen - wie beispielsweise die Verteilung der Unterrichtsblöcke - mit den Wirten abgeklärt werden.
2. März 2008
| Ungeachtet aller Wetterkapriolen und der Vogelgrippe breitet das Schwanenpärchen neben der Umgehungsstraße am Ziegelberg seit einem Vierteljahrhundert seine Schwingen aus. Von Höhenflügen der beiden ehernen Exemplare aus der Familie der Entenvögel indes ist nichts bekannt. Foto: Pilger |
 |
Rosenheim (pil) – Der Übergang von der Schule ins Berufsleben geht längst nicht für alle Jugendlichen reibungslos über die Bühne. Und so mancher scheitert bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz letztlich nur, weil ihm dabei eine helfende Hand fehlt. Im Rahmen einer zunächst auf fünf bis acht Jahre angelegten Aktion will die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Rosenheim deshalb jetzt die Firmpaten an ihre Mitverantwortung für den Werdegang ihrer Schützlinge erinnern; mit dem Projekt übernimmt der Kreisverband zugleich eine Vorreiterrolle im südbayerischen Raum. „Die erste Auflage von 1200 Faltblättern ist schon versandt; jetzt wird nachgedruckt.“, freute sich Alfred Hilscher bereits kurz nach dem Start über das große Interesse, auf das die Firmpatenaktion in den Dekanaten Bad Aibling, Chiemsee, Inntal, Rosenheim und Wasserburg gestoßen ist.
 |
| Das Firmpatenprojekt ist angelaufen. Die erste Auflage der Faltblätter fand reißenden Absatz; doch für Nachschub ist bereits gesorgt: Diözesansekretär Richard Müller mit den Vorständen des KAB-Kreisverbandes Marlene Weese und Alfred Hilscher (von links). Foto: pil |
Nach Aktionen zum Schutz des Sonntags und zum Mindestlohn setzt der knapp 1000 Mitglieder zählende Kreisverband beim KAB-Jahresthema „Unsoziale Marktwirtschaft“ den Schwerpunkt diesmal ganz bewusst auf die Jugend. Hilschers Schätzung zufolge könne man über den Firmunterricht in jeder der insgesamt 136 Pfarreien immerhin 70 bis 100 Firmlinge erreichen, die die Handzettel wiederum an ihre Paten weiterreichen sollen. Zudem belässt es die KAB nicht allein beim Aufruf an die Paten, die jungen Menschen auf ihrem Weg von der Schule ins Arbeitsleben zu begleiten. Alfred Hilscher, zugleich Vorsitzender des Ortsverbands Großholzhausen, hat in dem Faltblatt außerdem eine ganze Reihe von Kontaktstellen rund ums Thema Schulabschluss und Ausbildung aufgelistet.
Auch auf kirchlicher Ebene stößt das Projekt auf Zustimmung: „Eine gute Idee“, begrüßt etwa der Rohrdorfer Pfarrer Gottfried Doll, Dekan des Dekanats Inntal, die Aktion; wenngleich dort wegen des Zwei-Jahres-Turnus erst wieder 2009 gefirmt werde. Schließlich übernehme der Firmpate mit seinem Amt eine gewisse Verantwortung für seinen Schützling. Nicht umsonst, so Doll, hätten Eltern früher viel mehr als heute die Firmpaten ihrer Kinder mit großem Bedacht ausgewählt.
19. Februar 2008
von Marisa Pilger
Nußdorf – Es ist ein vergleichsweise kurzer aber überaus bedeutender Abschnitt in der Geschichte Nußdorfs, der während der vergangenen Monate in mühevoller Kleinarbeit zu Papier gebracht worden ist. Fünf dicke Aktenordner, die Hans Dettendorfer, der Vorsitzende der Schiffleut-Verein, bei der Jahreshauptversammlung nicht ohne Stolz präsentierte, gewähren nun Einblick in das Leben und Arbeiten der Nußdorfer während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Rund 1600 Seiten handschriftlicher Dokumente aus den Jahren 1754 bis 1796 sind dort abgehängt; wobei den Ablichtungen der Originaltexte aus dem Bayerischen Staatsarchiv - etwa dem Schriftverkehr „wartender Supplicanten“ mit der „Churfürstlich Hochlöblichen Hof-Kammer in München“ – jeweils die maschinengeschriebene „Übersetzung“ gegenübersteht.
 |
| Auch in der Vorstandschaft der Nußdorfer Schiffleut haben die Frauen bereits Einzug gehalten. Peter Dettendorfer, Leo Dettendorfer, Edi Faltlhauser, Regina Maurer Fuchs, Vorstand Hans Dettendorfer, Hans Straßburger und Bernhard Oberauer (von links). Fotos: Pilger |
So waren „Koichbrenna und Schöffleit“ bereits zur Zeit von Kurfürst Max Josef unweigerlich miteinander verbunden, was im Jahr 1778 zur Gründung einer „Kalchhändler Companie“ führte. Von den vielen schweren Unglücken auf der „nassen Straße“ zeugten einst die Votivtafeln auf Kirchwald, die allerdings gestohlen wurden. Erstaunlicherweise, wundert sich Annelies Wagner, hänge eine davon im Heimatmuseum in Rosenheim....
Hans Dettendorfer ist jedenfalls überzeugt, dass die Dokumente nicht nur für alteingesessene Familien von Interesse seien. Möglicherweise fänden die Unterlagen irgendwann ihren endgültigen Platz im Gemeindearchiv. Zunächst jedoch liegen die Ordner für drei Monate zur Einsicht und zum Kopieren in den Räumen der Spedition Dettendorfer am „Strasser Hof“ im Ortsteil Haus 98 aus.
Für die Schiffleut indes ist damit die Reise in die Vergangenheit nicht beendet; sie sind derzeit auf der Suche nach Unterlagen über die Innfähre bei Sonnhart, die über 200 Jahre lang Hinterberg mit Fischbach verband, bevor der Betrieb im Jahr 1973 eingestellt wurde.
 |
| Annelies Wagner hatte so manche Stunde mit der Aufarbeitung und Übersetzung der alten Handschriften verbracht. |
Insgesamt 21 Neuaufnahmen verzeichnete Dettendorfer fürs vergangene Jahr, wodurch der Mitgliederstand nunmehr auf die „stolze Zahl“ von 338 angewachsen sei. Anschließend gab Schriftführer Bernhard Oberauer einen humorvollen Überblick über die Vereinsaktivitäten es vorigen Jahres; neben Fronleichnamsprozession und Leonhardi-Ritt erinnerte er insbesondere an den Ausflug nach Dresden samt einer ausgedehnten Schifffahrt auf der Elbe.
Als Bereicherung für das Dorfgeschehen würdigte Bürgermeister Sepp Oberauer den Verein, welcher die Erinnerung an die viele Jahrhunderte zurückreichende Verbundenheit der Gemeinde mit der Innschiffahrt lebendig hält.
In diesem Sinne warten bereits die nächsten Herausforderungen auf die Schiffleut: Beim „Rosenheimer Frühling“ (vormals Südost-Messe, SOM) wollen die Gemeinden Nußdorf und Neubeuern den Besuchern die Geschichte der Innschifffahrt näher bringen. Darüber hinaus stellte der Historiker Dr. Bernhard Stalla eine Kulturveranstaltung unter dem Motto „Einst auf Wasserwegen – Rosenheim und die Innschiffahrt“ im Rahmen der Landesgartenschau in Aussicht.
Wie eng der im Jahr 1635 als eine Art Sozialkasse für die Innschiffer gegründete Verein der Tradition verbunden ist, zeigte sich einmal mehr zum Schluss des 184. Jahrtags, als sich am Tisch des Kassiers eine lange Schlange bildete: Auch in Zeiten von Internet-Banking wird der Jahresbeitrag in Höhe von einem Euro bar eingezahlt; und angesichts der soliden Bilanz, die Leo Dettendorfer auf den Tisch gelegt hatte, sah die Versammlung keinerlei Veranlassung, diesen Obolus zu erhöhen.
15. Januar 2008
|
Neuwahlen und eine besondere Ehrung
Kaum Veränderungen brachten die turnusgemäßen Neuwahlen mit sich, deren Leitung Bürgermeister Sepp Oberauer übernahm: Erster Vorstand Hans Dettendorfer, er feierte zugleich sein dreißigjähriges „Dienstjubiläum“, bleibt für weitere sechs Jahre im Amt; ebenfalls einstimmig bestätigt wurden sein Stellvertreter Hans Straßburger, Kassier Leo Dettendorfer sowie Schriftführer Bernhard Oberauer. Als Beisitzer fungieren Regina Maurer Fuchs, Edi Faltlhauser, Hans Holzner und Peter Dettendorfer.Das unermüdliche Engagement Hans Dettendorfers, dessen Vorfahren bereits aufs Engste mit der Innschiffahrt ebenso wie mit dem Verein verbunden waren, hob derweil Straßburger in seiner Laudatio hervor. So habe Dettendorfer nicht nur die Einführung der Schiffleut-Tracht vorangetrieben, auch ein Buch über Nußdorf und die Innschifffahrt sei unter dessen Ägide entstanden – und nicht zu vergessen sei die reguläre Aufnahme von Frauen in den Verein. Mit einer vergoldeten Anstecknadel in Form einer Hohenau Schiffsplätte dankte der Verein seinem alten und neuen Vorsitzenden. Dabei, erwiderte der Geehrte gerührt, „habe ich nichts getan, als ganz normal gelebt“. pil 15. Januar 2008 |
 |
| Ungefähr 50 Schrotpatronen und 200 Schuss mit Revolver und Rifle (Gewehr) verfeuert Gerhard Mayer an einem Wettkampftag; bei der Europameisterschaft waren es insgesamt sogar 450. Mit seinem Gun-Cart der Marke Eigenbau transportiert er Munition und Waffen von einem Schießstand zum anderen. Und selbstverständlich geht der „echte“ Cowboy der 1890er-Klasse nicht ohne Hut und Holster aus dem Haus. Für die Schützen, die in der 1880er-Klasse antreten, verlangt der „Dress Code“ darüber hinaus Messer und Taschenuhr. |
von Marisa Pilger
Neubeuern - Die Luft flimmert in der Hitze der endlosen Prärie; ein einsamer Kandelaber-Kaktus sprießt aus dem staubigen Boden. Eben hat der Mann mit Hut die Outlaws in die Flucht geschlagen; er schiebt mit unbewegter Miene den Colt ins Holster zurück und reitet direkt hinein in den beginnenden glutroten Sonnenuntergang. So mag das Cowboy-Leben aussehen in der Phantasie unzähliger kleiner und großer Männer. Und so oder zumindest so ähnlich lebt die Gemeinde von rund 200 Westernschützen in Good old Germany ihren Traum vom Wilden Westen aus. Stilecht ausgerüstet mit zwei Colts, einer Winchester und einer doppelläufigen Schrotflinte, mit Stiefeln, Stetson und Chaps (dem ledernen Beinschutz) lassen sie bei ihren Schieß-Wettbewerben für ein paar Tage den Mythos der Pionierzeit im Nordamerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufleben. Allein – als „Pferd“ muss bei der Meisterschaft ein Ölfass herhalten. Gefeuert wird natürlich echt und nach strengen Regeln auf Ziele aus Papier und Metall, auf Tontauben und Luftballons in bis zu 50 Meter Entfernung.
Für Gerhard Mayer aus Neubeuern jedenfalls erfüllt sich beim Westernschießen, das sich stark an das „Cowboy Action Shooting“ aus Amerika anlehnt und erst vor wenigen Jahren in die Sportordnung des Bundes Deutscher Sportschützen (BDS) aufgenommen worden ist, immer wieder ein Kindheitstraum: „Herumballern dürfen wie die Cowboys“. Was für den 67jährigen aber mindestens ebenso viel zählt, sind die Kameradschaft und die Gaudi, die bei Veranstaltungen wie der Europameisterschaft im BDS-Schießsportzentrum im württembergischen Philippsburg keineswegs zu kurz kommen. Denn auch an spielerischen Elementen mangelt es an den einzelnen Wettkampf-Stationen, den Stages, nicht. Da müssen die Schützen – selbstredend in traditionelle Cowboy-, Mexikaner-, Trapper oder Südstaaten-Kluft gekleidet – auch schon einmal Hufeisen werfen oder Stiefel nach einem „Koyoten“ schleudern.
Ein Rangemaster erklärt an jeder Stage den Ablauf der jeweiligen Übung. Und mag es an einer Station genügen, „any order“ (in beliebiger Reihenfolge) abzuräumen, kann bei der nächsten Stage der „Nevada Sweep“, der „Arkansas Shuffle“ oder gar der „Mustang Sweep“ gefordert sein. Fehlschüsse – die Kontrolle an den einzelnen Stages obliegt den drei sogenannten „Spottern“ – werden mit einer Zeitstrafe geahndet.
Mit vier Waffen muss jeder der Westernschützen sicher umgehen können. Bei den zwei Single-Action-Revolvern (Colts) schwört Mayer, der wie die meisten Schützen seine Patronen selbst lädt, auf seinen Buntline Spezial, Kaliber 357 Magnum (9 mm) mit 16 ½ Zoll-Lauf (46 cm) und auf einen .45er Colt (Kaliber 11,4 mm). Dazu kommen ein Unterhebelrepetierer, besser bekannt als Winchester, und eine doppelläufige gekürzte Schrotflinte.
Für die legendären „rauchenden Colts“ aber sorgt die in den „traditionellen“ Klassen (1880, 1870) obligatorische Schwarzpulvermunition. Hier muss neben der Ausrüstung auch die komplette Bekleidung der Western-Zeit entsprechen.
 |
| Muss bei allen offiziellen Wettkämpfen getragen werden: Der Texas Ranger Stern. Gerhard Mayer hat mit dem „Range Officer I“ noch eins drauf gesetzt und darf Westernschießwettbewerbe leiten. Fotos: Pilger |
Mayer selbst blickt auf eine „klassische“ Sportschützenlaufbahn zurück; er landete zunächst beim Luftgewehr, dann bei Klein- und Großkaliberwaffen und praktizierte einige Jahre das „praktische Pistolen-Schießen“ (IPSC-Schießen). Vor sieben Jahren machte er als einer der ältesten in Deutschland den Jagdschein und hatte zeitweise sogar eine eigene Jagd gepachtet. Doch „das war's nicht“, erklärt der Programmierer. „Ich messe mein Können lieber an den Scheiben.“ 2005 sattelte er um aufs Westernschießen, belegte bei der Südbayerischen Meisterschaft in Leibersdorf gleich den zweiten Platz in der Klasse Senioren und wurde Fünfter bei den Bayerischen Landesmeisterschaften in Lauf. Allerdings ist er dort wie auch unter den 350 Teilnehmern der Europameisterschaft 2006 in Philippsburg zu seinem Leidwesen immer als einziger Schütze aus der Region zwischen München und Freilassing angetreten; das „Bayern-Eck“ auf den Lagerplätzen dominieren nach wie vor die Freistaatler aus dem Norden.
Zweimal pro Monat trainiert Mayer als Mitglied der Schützengruppe der Reservistenkameradschaft Rosenheim mit den Revolvern, und alle vier Wochen steht er mit der Winchester am 100-Meter-Schießstand; für die Schrotflinte genügen unterdessen „Trockenübungen“. Allerdings hat es der rührige Waffenliebhaber nicht beim „herkömmlichen“ Westernschießen belassen. Seinen „Texas Ranger Stern“ mit der laufenden Nummer 200, der erst nach bestandenem Sicherheits- und Regeltest vom BDS ausgehändigt wird und ohne den eine Teilnahme bei Wettbewerben nicht erlaubt ist, ziert seit April das Zusatzabzeichen „Range Officer I“: Damit darf Mayer auch Aufsicht an den Stages führen und Western-Schießveranstaltungen leiten. Doch heute wie damals lebt der Wilde Westen nicht vom Schießen allein: Abends, nach Sonnenuntergang, wenn Country Music im „Saloon“ erklingt und der Duft von Barbecue die Luft erfüllt, gesellen sich die Damen in ihren Gewändern im Stil der Belle Epoque zu den Greenhorns und Revolverhelden, bevor man anderntags wieder ins 21. Jahrhundert zurückkehrt – zumindest bis zum nächsten Westerntreffen.
18. Januar 2008
 |
| Stromerzeuger seit einem Vierteljahrhundert: die Innstaufstufe in Nußdorf. Foto: Pilger |
Nußdorf (pil) – Als „Weiße Kohle“ bezeichnete Technik-Pionier Oskar von Miller einst die Wasserkraft, die seit nunmehr einem Vierteljahrhundert die beiden Kaplan-Turbinen in der Staustufe Nußdorf rotieren lässt. Jedes Jahr speist das jüngste und zugleich eines der leistungsstärksten der insgesamt 15 Kraftwerke, die die Eon Wasserkraft GmbH am Innlauf zwischen Windshausen und Passau betreibt, durchschnittlich 245,8 Millionen Kilowattstunden Strom ins Hochspannungsnetz ein; mehr, als 70.000 Haushalte im selben Zeitraum verbrauchen.
Begangen wurde das Jubiläum mit einer internen Feier, zu der neben Mitarbeitern und Ehemaligen auch einige jener kamen, die seinerzeit mit dem Bau der Staustufe betraut gewesen waren. Diplom-Ingenieur Franz Gillhuber, er war zehn Jahre lang als Werkleiter für alle Inn-Kraftwerke verantwortlich gewesen, hatte anlässlich des „Geburtstags“ einen bebilderten Rückblick auf die knapp dreijährige Bauphase und den Start der Anlage im Sommer 1982 zusammengestellt. Aufgrund der geographischen Lage – in der oberen Hälfte des Staugebietes ist der Inn ein Grenzfluss – wurde die Staustufe bei Flusskilometer 198,7 damals gemeinsam von der Innkraftwerke GmbH, die heute zur Eon Wasserkraft GmbH gehört, und der Österreichisch Bayerischen Kraftwerke AG (ÖBK) errichtet. Es entstand ein sogenanntes Pfeilerkraftwerk, bei dem sich Wehr- und Maschinenfelder abwechseln. Der ursprüngliche Plan, die Innstrecke im Bereich des heutigen Kraftwerks mit zwei Staustufen in Windshausen und Neubeuern auszubauen, war aus wirtschaftlichen Gründen wieder verworfen worden.
Wassermassen von bis zu 550 m³/Sekunde kann das Elektrizitätswerk mit den beiden Maschinensätzen à 25 Megawatt installierter Leistung für die Stromerzeugung nutzen; allein der Durchmesser der mächtigen Turbinen-Laufräder beträgt sechseinhalb Meter. Unterdessen schiebt der Gebirgsfluss während der Wintermonate im Mittel sekündlich „nur“ rund 250 Kubikmeter des kostbaren Nass durch die Staustufe.
Insgesamt 6,2 Milliarden Kilowattstunden elektrischer Strom wurden in Nußdorf bislang aus regenerativer Wasserkraft gewonnen – so konnten allein Dank dieses „Dauerläufers“ fünf bis sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Zudem seien mit dem Aufstau die bis dato stark abgesunkenen Grundwasserstände wieder deutlich angehoben und die bereits fortgeschrittene Sohleintiefung gestoppt worden, führte Gillhuber weiter aus. Überwacht wird das vollautomatisierte Kraftwerk von der zentralen Leitwarte in Töging.
Auch an die gigantischen Erdbewegungen für den Dammbau, die mit der Errichtung der Staustufe mit einer Fallhöhe von rund 13 Metern einher gegangen sind, erinnerte er. Dank dieser Höhendifferenz zwischen Ober- und Unterwasser zähle die Nußdorfer Staustufe zu den vier leistungsstärksten am Inn.
21. Dezember 2007
Rosenheim (pil) - Deutlich mehr Arbeit als in der Vergangenheit hatte die Beratungsstelle beim Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim im abgelaufenen Jahr zu bewältigen: Lag die Zahl der Gespräche 2005 noch bei 725, rangiert diese heuer – bei gleichen Öffnungszeiten – bereits bei rund 850, fasste Vorstandsfrau Maria Noichl bei der Jahreshauptversammlung im Mail-Keller die Entwicklung in Zahlen. Als besonders auffällig aber wertete sie den „extremen Anstieg“ bei der Gruppe junger Mädchen, die Hilfe suchen.
Seit 18 Jahren bietet der Frauen- und Mädchennotruf (Telefon 08031/268888) eine Anlaufstelle für Opfer sexueller oder häuslicher Gewalt ebenso wie für deren Angehörige. Zusätzlich lief 1996 das Präventionsprogramm an Schulen an. Einen unverzichtbaren Beitrag für die Notruf-Arbeit leisten dabei die 15 Ehrenamtlichen: Sie waren im Jahr 2006 insgesamt 3500 Stunden im Einsatz und haben damit, so Noichl, den bundesweiten Pro-Kopf-Durchschnitt an ehrenamtlichem Engagement gleich doppelt erfüllt.
„Wir suchen ständig neue Mitarbeiterinnen.“, betonte sie weiter. Denn auch die Nachfrage in der Fachstelle Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Kindern ist unverändert hoch. Diplom-Sozialpädagogin Gudrun Gallin bietet mit einem eigens geschulten Team unter anderem Projekttage und Informationsabende zur Vorbeugung sexueller Gewalt an Mädchen und Buben an und war damit im vergangenen Jahr in 35 Schulklassen in der Stadt und im Landkreis präsent; hinzu kamen Veranstaltungen in Kindergärten und Jugendgruppen sowie Fortbildungen im Klinikbereich.
Für die drei Vorstandsfrauen, neben Noichl sind dies Brigitte Kutka und Helene Gurgießer, und die Verwaltung steht unterdessen auch im kommenden Jahr die Akquise von Bußgeldern bei den Gerichten in Rosenheim und Traunstein an. Immerhin, so ging aus Kutkas Kassenbericht hervor, wurden im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent des Etats mit Einnahmen aus Bußgeldern und Spenden abgedeckt; 20 Prozent entfielen auf die Beiträge der rund 200 Mitglieder, und knapp 30 Prozent auf Zuschüsse. Unterm Strich blieb dennoch ein Defizit von etwa 8200 Euro.
Trotzdem sieht Noichl durchaus optimistisch in die Zukunft; auch, was die angestrebte Interventionsstelle „Häusliche Gewalt“ anbelangt. Diese Einrichtung sei zwar ehrenamtlich nicht zu bewältigen, doch die Verhandlungen über die Finanzierung liefen bereits. Darüber hinaus wolle man Frauen mit Migrationshintergrund künftig mehr Möglichkeiten bieten, die Beratungsstelle im Künstlerhof zu nutzen, beispielsweise durch Dolmetscher.
Einen Einblick in ihre Arbeit als Opferanwältin gab abschließend Manuela Denneborg. Da viele der hilfesuchenden Mädchen und Frauen nicht über die nötigen Mittel für einen Rechtsbeistand verfügten, müsse eine Opferanwältin nicht nur über entsprechendes Fachwissen verfügen, sondern auch umfassend über Finanzierungshilfen für Beratungs- und Prozesskosten informiert sein. Den größten Unterschied zu einer „herkömmlichen“ Anwältin sieht Denneborg darin, „dass ich mich immer auf einem extrem schmalen Grat zwischen vertretbarer Rechtsanwendung einerseits und parteilichem Opferschutz andererseits befinde.“
Mehr unter www.frauennotruf-ro.de
26. November 2007
Rosenheim (pil) – Häusliche Gewalt ist für Katharina Oberländer vom Frauenhaus Rosenheim alles andere als eine „Randerscheinung“. Allein dort hat im vergangenen Jahr im Durchschnitt jede Woche eine Frau Zuflucht gesucht; und viele waren zu diesem Zeitpunkt bereits jahrelang vom Partner geschlagen oder anderweitig misshandelt worden. Doch sind es gerade die Opfer, die das Thema - meist aus Scham – lange Zeit einfach totschweigen, erklärt Iris Hinkel, die Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Südostbayern, Träger des Frauenhauses. Der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November soll daher gezielt auf die Notlage dieser Frauen aufmerksam machen. Nicht wegschauen sondern die Betroffenen unterstützen lautet die Devise.
Im Frauenhaus (Telefon 08031/ 381478) finden misshandelte oder von Misshandlung bedrohte Frauen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Schutz. Hier können sie durchatmen, zur Ruhe kommen und vor allem Perspektiven entwickeln für ein Leben ohne Gewalt und ohne Angst. „Jede Frau, die zu uns kommt, steht an einem inneren Endpunkt und braucht Beratung.“, verdeutlicht Katharina Oberländer die dramatische Situation der Betroffenen. Nicht selten müssten sich Prügelopfer erst einmal in ärztliche Behandlung begeben.
Die Diplom-Sozialpädagogin ist insbesondere für die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zuständig, die sich neben den drei Sozialpädagoginnen und der Erzieherin engagieren. Der Pool aus 16 Ehrenamtlichen übernimmt Rufbereitschaften und arbeitet in der Krisenintervention und Beratung. Mit Informationsveranstaltungen zum Thema häusliche Gewalt ist das Frauenhaus außerdem immer wieder zu Gast in Schulen, Vereinen oder Polizeiinspektionen.
Hilfe zur Selbsthilfe wird großgeschrieben im Frauenhaus, das acht Frauen und 16 Kindern Platz bietet und über dessen Adresse Stillschweigen gewahrt werden muss. Jede Frau bekommt eine Betreuerin zur Seite gestellt, die sie in der ersten Zeit begleitet, ihr Mut macht und gegebenenfalls bei Behördengängen den Rücken stärkt. Jede hat ihren eigenen Hausstand, kann so mit dem Tag ihres Einzugs bei Bedarf ALG II beantragen und trägt auch für ihre Kinder die Verantwortung. Bei der Suche nach einem Arbeitsplatz und einer Wohnung ist zudem die Vernetzung des Frauenhauses zu anderen Fachdiensten hilfreich.
Darüber hinaus können die traumatisierten Gewaltopfer das Erlebte in Einzelgesprächen aufarbeiten und durch Gruppenangebote wie Mal- oder Kochkurse zumindest teilweise in die Normalität zurückfinden. Auch gehören Hausversammlungen, Präventivgespräche - insbesondere im Kinderbereich – und Nachsorge zum Betreuungsangebot. Oberländer: „Wir sind eine pädagogische Schutzeinrichtung, keine Notunterkunft.“
Egal ob Schläge, sexuelle Nötigung oder subtiler Psychoterror; die verschiedenen Gesichter der Gewalt sind in allen Bevölkerungsschichten auszumachen. Im Frauenhaus indes suchen überwiegend diejenigen Schutz, die keine andere Möglichkeit beziehungsweise nicht das Geld haben, anderweitig Unterschlupf zu finden: Mütter, zwischen 20 und 40 Jahre alt, mit kleinen Kindern, oft ohne eigenes Einkommen. Der Einzugsbereich deckt sich dabei im wesentlichen mit Stadt und Landkreis Rosenheim und Traunstein; die Betreuungskosten werden direkt mit der ARGE Rosenheim Stadt abgerechnet.
Zwischen zwei Wochen und drei Monaten wohnen die Frauen in der Regel im Frauenhaus. Rund ein Viertel kehrt dann nach Angaben von Katharina Oberländer wieder zum Lebenspartner zurück – die meisten allerdings nur auf Zeit. Denn für 80 Prozent von ihnen führt der Weg von Neuem ins Frauenhaus. Um so nachdrücklicher formuliert sie daher ihre Forderung auch für die anderen 364 Tage des Jahres: „Frauen haben Anspruch auf ein gewaltfreies Leben.“
Mehr unter www.frauenhaus-rosenheim.de
27. November 2007
Landkreis (pil) – Mit seiner neuen Regionsmarke „Rosenheimer Land – Inntal. Wendelstein.Kaiser.“ setzt der Kur- und Tourismusverband Wendelstein an zum Gipfelsturm. Der Verbund aus insgesamt elf Kommunen entlang der Mangfall und des Inns will mit dem neuen Label den Tourismus rund um den 1838 Meter hohen Rosenheimer Hausberg nachhaltig ankurbeln. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung ist nach Überzeugung von Geschäftsführer Thomas Jahn mit dem ersten gemeinsamen, 148 Seiten starken Gastgeberverzeichnis für die Region getan.
Im Zuge eines markengerechten Auftritts hat die Rosenheimer Werbeagentur Ortner (WAO) mit „Herzlich willbleiben!“ außerdem einen Slogan kreiert, der Emotionen wecken und neugierig machen soll – nämlich auf 415 Millionen Quadratmeter Wellness, erläuterte Siegfried Weisbach das Konzept. Traditionell und zugleich zeitgemäß – wie die Region selbst – stelle sich auch das Logo dar: Auf der einen Seite der weiß-blaue Werbespruch in geschwungener Schrift – auf der anderen Seite klare, gerade Typen auf auffälligem Rot. Elf Striche verbinden dabei die beiden farbigen Kästchen miteinander, gleich einem Reißverschluss.
Eine enge Verzahnung der einzelnen Orte im Rosenheimer Land ist es auch, die Jahn anstrebt, etwa durch eine Gästekarte für den Nahverkehr, gemeinsame Veranstaltungen oder ein Museumsnetzwerk. Abgesehen von einem Anstieg der Gästezahlen (derzeit rund 1,2 Millionen Übernachtungen jährlich) erhofft er sich von dem Neustart Verbesserungen in der touristischen Infrastruktur.
Wie ein roter Faden werde sich das Markenzeichen der Ferienregion Rosenheimer Land künftig durch alle Arbeitsbereiche des Verbands ziehen. So auch im Internet-Auftritt www.rosenheimer-land.de. Vor allem die Gliederung nach Themen wird dort den Gästen die Suche erleichtern. Darüber hinaus seien gemeinsame Messestände mit dem Chiemsee Tourismusverband und der Kooperation Urlaub auf dem Bauernhof Wendelstein-Chiemsee sowie ein neues Layout für die Verbandszeitung „Inntermezzo“ geplant. Das Kaisergebirge - auf österreichischer Seite gelegen - grenze dabei lediglich als geläufiger Begriff die Ferienregion im Süden ab.
Schließlich gelte es, das „unglaubliche Potential“ einer vielseitigen Ferienregion auszuschöpfen. Punkten könne das für Kur- und Familienurlaube gleichermaßen attraktive Rosenheimer Land vor allem mit einer intakten abwechslungsreichen Natur, mit verschiedensten Sportmöglichkeiten – vom Golfen über Wasserskifahren bis zum Langlaufen –, mit einem breiten Spektrum an kulturellen Veranstaltungen sowie mit einem überaus großen Anteil familiengeführter Hotels.
Der Kur- und Tourismusverband Wendelstein e.V. mit den Kommunen Bad Aibling, Bad Feilnbach, Brannenburg, Flintsbach, Kiefersfelden, Neubeuern, Nußdorf, Oberaudorf, Raubling, Rosenheim und Samerberg besteht seit mehr als 30 Jahren. In den vergangenen Jahren war es allerdings mit der Zusammenarbeit speziell in wirtschaftlicher Hinsicht bergab gegangen; die Bedeutung des Verbandes tendierte zuletzt nahezu gegen Null. Zum 1. Juli 2006 war die Führung des Verbandes auf die Stadt Bad Aibling übergegangen; neuer Vorsitzender wurde Erster Bürgermeister Felix Schwaller, Geschäftsführer Thomas Jahn, der Kurdirektor der Stadt.
1. November 2007
Rosenheim (pil) – Erfolgreiche Schulsozialarbeit braucht Netzwerke. Nicht nur Schule, Sozialpädagogen, Jugendhilfe und Ausbildungsbetriebe müssen deshalb im ständigen Dialog miteinander stehen; auch die Kooperation mit den Eltern ist unbedingt erforderlich. Dieses Fazit zogen die Teilnehmer beim 2. Rosenheimer Symposium zur Schulsozialarbeit, das der Verein „Pro Arbeit“ gemeinsam mit der Stadt Rosenheim und der Sparkasse Rosenheim – Bad Aibling jüngst im Schüler- und Studentenzentrum veranstaltet hatte. So stand die Schulsozialarbeit gewissermaßen zweimal im Mittelpunkt des Tages; denn im Anschluss an die Workshops hatte der Verein „Pro Arbeit“, einer der führenden Träger von Schulsozialarbeit in der Region, zur Feierstunde anlässlich seines zehnjährigen Bestehens geladen.
Über 80 Teilnehmer – neben Lehrern und Schulleitern unter anderem Sozialpädagogen und Vertreter des Jugendamts und der ARGEn – hatten in Workshops die Rolle der Schulsozialarbeit sowie Möglichkeiten zur Optimierung und der Verknüpfung mit anderen Hilfsangeboten beleuchtet. Dabei wurde insbesondere auf klare Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeiter gepocht, von deren Einsatz letztlich die gesamte Gesellschaft profitiere. Als sinnvolle Ergänzung zur Betreuung von Problemschülern wurden außerdem die Patenprojekte bewertet, bei denen sich Ehrenamtliche ganz individuell um besonders schwache Schüler kümmern. Allerdings seien auch hier klare Absprachen und eine genaue Verteilung der Aufgaben erforderlich.
Die Quintessenz der zweistündigen Workshop-Runde brachte Regionalleiter Markus Bauer bei der Präsentation der Ergebnisse auf den Punkt: „Gemeinsam geht’s besser.“ Schulsozialarbeit, so der Tenor aller Gruppensprecher, kann nicht isoliert gesehen werden. Nachhaltige Erfolge erforderten den ständigen Dialog zwischen Schule, Sozialpädagogen, Jugendhilfe und Ausbildungsbetrieben. Und vor allem müssten die Eltern als gleichwertige Partner in dieses Netzwerk eingebunden werden.
Der Erfolg von Schulsozialarbeit lasse sich zwar vornehmlich an der Zufriedenheit von Lehrern und Schülern ablesen, stellte Claudia Romer von der Berufsschule I fest. Von einem besseren Schulklima profitierten letztlich aber auch Ausbildungsbetriebe, Sachaufwandsträger und Steuerzahler – also der Staat. Dies jedoch erfordere verbindliche Rahmenbedingungen zwischen Jugendhilfe und Schule, die beispielsweise die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter klar abstecken eine adäquate Ausstattung des Arbeitsplatzes vorsehen, fasste Regina Hartmann vom Bayerischen Landesjugendamt die Forderungen ihrer Arbeitsgruppe zusammen. Neben einer kontinuierlichen und möglichst frühzeitigen Förderung der Kinder plädierte sie für eine Bündelung der Hilfsangebote.
Als sinnvolle Ergänzung anstatt als Konkurrenz zur Schulsozialarbeit wurden schließlich Patenprojekte wie an der Hauptschule Mitte bewertet. Dort nehmen Ehrenamtliche seit etwa zwei Jahren besonders schwache Schüler unter ihre Fittiche. Aber auch hier seien klare Absprachen mit allen Beteiligten und eine genaue Verteilung der Aufgaben erforderlich, betonten die Sprecher aus der Gruppe von Moderator Manfred Wierer, dem vormaligen Leiter der Berufsschule Wasserburg. Wolle man aber die Ressource Pate als zusätzliches, individuelles Hilfsangebot künftig besser ausschöpfen, sei mehr Öffentlichkeitsarbeit und mehr Anerkennung für ehrenamtliches Engagement vonnöten.
Mit dem Symposium hat der Verein „Pro Arbeit“, der im Anschluss an die Tagung sein zehnjähriges Bestehen feierte, den Komplex Schulsozialarbeit bereits zum zweiten Mal in einem großen Rahmen thematisiert: Im vergangenen Jahr hatte unter anderem Sozialministerin Christa Stewens an einer Podiumsdiskussion unter der Überschrift „Schulsozialarbeit – Luxus oder Notwendigkeit?“ teilgenommen.
29. Oktober 2007
von Marisa Pilger
Rosenheim - Die Krankheit beginnt schleichend. Anfangs verlegt der Betroffene Gegenstände, vergisst Termine oder Namen, findet die Bezeichnung für Gegenstände des täglichen Lebens nicht mehr; vertraute Orte sind ihm plötzlich fremd, und irgendwann steht er möglicherweise im Supermarkt und fragt „Was ist eigentlich eine Kartoffel?“ oder er erkennt sein eigenes Spiegelbild nicht mehr.
Es ist ein langer Leidensweg den Alzheimer-Patienten zu beschreiten haben und auf dem sie nach und nach buchstäblich den Verstand verlieren. Für mehr Verständnis und Unterstützung sowohl für die Betroffenen als auch für deren Angehörige wollte deshalb auch der Memorywalk werben, der anlässlich des Welt-Alzheimertages durch Rosenheim zog. Auch in Filmabend im Bildungswerk war dem heiklen Thema gewidmet.
Morbus Alzheimer, die häufigste Form von Demenzerkrankungen (demens, lateinisch: ohne Geist, weg vom Geist) kann jeden treffen, egal ob Mann oder Frau, ob Hilfsarbeiter oder Topmanager, ob Politiker oder Schauspieler. Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Berlin zufolge ist etwa ein Prozent der 60jährigen davon betroffen, bei den 80-jährigen rund 13 Prozent und von den über 90jährigen bereits jeder Dritte.
Deutschlandweit rechnet man derzeit mit etwa einer Million Patienten. Mit dem Anstieg der Lebenserwartung aber wird sich diese Zahl in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Denn als Risikofaktor Nummer eins für Alzheimer gilt das Alter, wenngleich die Krankheit durchaus auch bereits vor dem 50. Geburtstag auftreten kann.
Eiweißablagerungen im Gehirn legen allmählich wichtige Funktionen der Nervenzellen lahm; betroffen sind dabei vor allem die für Gedächtnis, Sprache und Denkvermögen zuständigen Hirnregionen. Später geht ein großer Teil der Nervenzellen und ihrer Verbindungen untereinander völlig zugrunde. Die Ursachen der Krankheit, die der Arzt Alois Alzheimer vor einem Jahrhundert erstmals beschrieben hat, sind jedoch erst teilweise bekannt. Medikamente können dabei den Verlauf der bislang unheilbaren Erkrankung verzögern beziehungsweise die Begleiterscheinungen lindern.
„Die Krankheit frisst den Menschen von hinten her auf.“ verbildlicht Anita Grimm, die Leiterin der Fachberatungsstelle für Pflegende Angehörige im Caritas-Zentrum Rosenheim (Telefon 08031/20370), den unaufhaltsamen Verfall. Doch auch – oder vielleicht vor allem - die Angehörigen sind Opfer des Leidens, in dessen Verlauf die Patienten neben Erinnerungen und Sprache nach und nach das Wissen um ihr eigenes Leben, ihre Biographie, ihr Ich verlieren. Denn der überwiegende Teil der Kranken wird zu Hause vom Lebenspartner oder von den Kindern versorgt. Sie kümmern sich sieben Tage in der Woche um einen Menschen, der fortwährend die gleichen Fragen stellt, mit einer Zahnbürste nichts mehr anzufangen weiß und – abgesehen von lichten Momenten - die Welt um sich herum immer weniger versteht. Manche Patienten werden aggressiv, andere versinken in Depressionen, sobald sie merken, dass ihr Verstand nicht mehr richtig funktioniert. Manchmal erkennen die Kranken nicht einmal mehr ihre engsten Bezugspersonen – es ist ein Abschied auf Raten.
„Es gibt viel auszuhalten.“, fasst Grimm das Leben mit einem Demenzkranken in einem Satz zusammen. Deshalb kommt in der Reichenbachstraße alle zwei Wochen ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige zusammen, der viel Raum für den Erfahrungsaustausch aber auch für die Verzweiflung bietet. „Die Krankheit macht viel Angst.“, sagen die Teilnehmer. Jeder einzelne musste die Erfahrung machen, dass es sehr lange dauert, bis man Alzheimer versteht und bis man akzeptiert, dass die Welt für den Kranken nunmehr eine ganz andere ist.
Der Kaffee landet im Senf, die Schuhe im Kühlschrank - was sich für Außenstehende komisch ausnehmen mag, ist für die Angehörigen nervenaufreibender Alltag, der nicht nur psychisch sondern auch körperlich zusetzt. Nachts wandern die Patienten oft ruhelos durchs Haus – an Schlaf ist dann kaum zu denken. Nicht selten hangele man sich nur von einem Tag zum anderen, erzählen alle, die den Partner oder ein Elternteil seit Jahren behüten. Erschwerend komme hinzu, dass sich viele Freunde zurückzögen. Nur ungern versäumen die Pflegenden deshalb die Treffen, aus denen sie neue Kraft für ihre Aufgabe schöpfen. „Denn man sieht, dass man nicht alleine ist mit diesen Problemen.“
„Ein freier Tag in der Woche für pflegende Angehörige“, steht ganz weit oben auf ihrer Wunschliste; zumal Alzheimer-Patienten von der Pflegeversicherung erst spät für eine Pflegestufe anerkannt würden. Ebenso fordern die Pflegenden mehr Anerkennung und mehr Unterstützung vom Staat in Form von Tagespflegeheimen oder anderen, neuen Wohn- und Betreuungsformen. Denn eine Person allein, das haben alle am eigenen Leib erlebt, „kann das niemals schaffen“. Und nicht zuletzt müssten medizinische Pflegekräfte gezielt für den Umgang mit Demenzkranken geschult werden.
Auf eine bessere Versorgung von Demenzpatienten sowie auf eine Erleichterung für deren Angehörige zielt auch die Nachbarschaftshilfe Rosenheim ab, die das Tagespflegehaus „Johanna“ betreibt. Sie plant in Kooperation mit der Jacob-und-Marie-Rothenfußer-Gedächtnisstiftung ein Demenzzentrum für Rosenheim.
Auf der anderen Seite aber ist da die Scham, die nicht nur Nachbarn und Bekannte sondern auch viele direkt Betroffene das Thema einfach totschweigen lässt. Ein Grund mehr für Renate Bruckner vom Caritas-Zentrum Wasserburg, verstärkt auf Aufklärung zu setzen: „Alzheimer ist eine Krankheit wie Krebs. Nur weiß kaum einer etwas über sie.“
3. Oktober 2007

Rosenheim (pil) – Rund eine Million Menschen in Deutschland leiden an Alzheimer. Die Zahl der tatsächlich Leidtragenden aber liegt deutlich über dieser Marke; denn Alzheimer (be)trifft nicht nur die Patienten sondern mindestens ebenso viele Angehörige. Trotzdem wird die bislang unheilbare Krankheit auch ein Jahrhundert nach ihrer Entdeckung noch vielerorts verschämt totgeschwiegen. Mit dem „Memorywalk“ anlässlich des Welt-Alzheimertages wurde am Samstag dieses weit verbreitete Tabu demonstrativ gebrochen. Rund 30 Teilnehmer gingen gegen das Vergessen an und warben um Solidarität mit den Betroffenen. Vertreter der Caritas-Zentren, der Nachbarschaftshilfe Rosenheim sowie des Inn-Salzach-Klinikums Wasserburg (vormals Gabersee) leisteten zudem Aufklärungsarbeit in Sachen Demenz und machten auf die verschiedenen Hilfsangebote ihrer Einrichtungen aufmerksam.
Allerdings bedauerte Johanna Schildbach-Halser, die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, dass sich dem von den „Schottenrock Pipers“ angeführten Zug vom Bahnhof zum Max-Josefs-Platz nicht mehr Menschen angeschlossen hatten. „Demenz geht uns alle an!“, betonte sie mit Nachdruck. Niemand sei gefeit vor dieser „schrecklichen Krankheit“, in deren Verlauf die Patienten nach und nach ins Vergessen fallen. Trotzdem, stellte sie zufrieden fest, erlange das Thema Alzheimer zunehmend Aufmerksamkeit. Erst vor wenigen Tagen habe die Bundesregierung angekündigt, für die Demenz-Forschung künftig bis zu 60 Millionen Euro jährlich bereitzustellen. Für Rosenheim stellte Schildbach-Halser ein Demenzzentrum in Aussicht, das die Nachbarschaftshilfe in Zusammenarbeit mit der Jacob-und-Marie-Rothenfußer-Gedächtnisstiftung plane.
Die Belastung der Familienmitglieder von Alzheimer-Patienten rückte Anita Grimm von der Fachberatungsstelle für pflegende Angehörige im Caritas-Zentrum Rosenheim in den Vordergrund. Rund drei Viertel der Kranken würden daheim versorgt. Über die kräftezehrende Betreuung vergäßen die Pflegenden jedoch oftmals ihr eigenes Leben; der Kontakt zu Freunden und Bekannten werde nicht selten aus Scham abgebrochen. „Diese Isolation muss nicht sein!“, macht sie den Betroffenen Mut, Beratungsangebote, Gesprächskreise oder Pflegepartner-Programme in Anspruch zu nehmen.
„Nicht wegschauen, sondern handeln“, appelliert Chefarzt Richard Schmidmeier an alle, die mit Alzheimer in der eigenen Familie, im Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft konfrontiert sind. Denn um den Patienten aber auch den pflegenden Angehörigen zu einem möglichst hohen Maß an Lebensqualität zu verhelfen, „müssen wir zusammenhalten“, mahnte der Leiter der Gerontopsychiatrie am Inn-Salzach-Klinikum. Auch eine medikamentöse Behandlung der Krankheitssymptome könne in vielen Fällen wesentlich dazu beitragen.
Eine offene und öffentliche Diskussion über Alzheimer fordert deshalb nicht nur Rosenheims zweiter Bürgermeister Anton Heindl; zumal die Krankheit angesichts der steigenden Lebenserwartung in naher Zukunft ungleich mehr Menschen betreffen wird als bisher. Im Altenhilfeprogramm der Stadt, so Heindl, sei die Thematik bereits berücksichtigt.
Um Verständnis für die Patienten, die mehr und mehr in eine eigene Welt abdriften, und vor allem um Solidarität mit den Angehörigen warb auch Christl Aicher. Die Pflegenden könnten „stolz darauf sein, zu ihren Angehörigen zu stehen“, zollte sie den Betreuungspersonen höchsten Respekt. Die frühere Seniorenbeauftragte des Landkreises hatte wie bereits in den Jahren zuvor die Patenschaft des „Memorywalks“ übernommen. Doch, warnt auch sie, bedeute die Pflege von Demenzkranken einen ungeheuren Kraftakt, der nur mit Hilfe anderer zu bewältigen sei.
3. Oktober 2007
 |
| Auch mit 80 Jahren eine Anlaufstelle für Ratsuchende: Franz Köberle, Leiter der partei- und konfessionsunabhängigen „Bürgerberatung Rosenheim e.V.“, engagiert sich zudem als Berufsbetreuer und Nachlasspfleger. Foto: Pilger |
Rosenheim (pil) – Ganz gleich, ob es sich um Mietstreitigkeiten handelt, um einen Antrag auf Befreiung von Arzneimittelkosten oder um die Stornierung einer Bestellung auf einer „Kaffeefahrt“; Franz Köberle ist es ein persönliches Anliegen, kostenlos und unbürokratisch dort zu helfen, wo Bürger Unterstützung brauchen. Und wenngleich er vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, denkt der resolute Begründer und Leiter der „Bürgerberatung Rosenheim“ noch lange nicht ans Aufhören.
Wie viele Ratsuchende aus Stadt und Landkreis sich in den vergangenen 22 Jahren an ihn gewandt haben, kann er zwar nicht sagen; jedenfalls waren es „sehr viele“. Vor allem ältere Menschen, die im Umgang mit Behörden oder Versicherungen unsicher seien und Hilfe beim Ausfüllen von Formularen benötigten, wenden sich an ihn. „Aber ich gebe keine Rechtsauskünfte.“, betont er ausdrücklich. Er leiste nur ehrenamtliche Unterstützung, gebe Tipps beispielsweise bei finanziellen Angelegenheiten wie einer Umschuldung oder helfe beim Verfassen von Testament oder Patientenverfügung.
Aufgewachsen ist Köberle in kleinsten Verhältnissen, musste als 15jähriger Verhöre der Gestapo über sich ergehen lassen. Er absolvierte – unterbrochen vom Kriegsdienst - zunächst eine Ausbildung bei der AOK in Kempten, wo er bis Anfang der 60er Jahre blieb. Dann folgte eine Reihe beruflicher Stationen, unter anderem als Geschäftsführer von Betriebskrankenkassen und als leitender kaufmännischer Angestellter, bevor er Anfang der 80er Jahre wegen gesundheitlicher Probleme aus dem Berufsleben ausschied. Von Ruhestand kann allerdings kaum die Rede sein. Denn neben der Bürgerberatung engagiert sich Köberle seit 1989 außerdem als Berufsbetreuer und seit 1996 als Nachlasspfleger.
Bei seinen „Fällen“ kommen ihm insbesondere seine zahlreichen Kontakte zu Behörden zugute – und die Unterstützung durch seine Frau Maria. Die gelernte Sekretärin war es auch, die seinerzeit den Anstoß für die „Bürgerberatung Rosenheim“ gegeben hat: Beim Bügeln hatte sie eine Radiosendung über einen Rentner aus München gehört, der Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite stand, und meinte spontan zu ihrem Mann: „Du, das machst auch.“...
So legt sich Franz Köberle seither nicht nur von seinem Arbeitszimmer in Westerndorf St. Peter (Telefon 08031/81500) aus für seine „Klienten“ ins Zeug; sogar Anfragen aus Norddeutschland und aus dem Ausland seien schon bei ihm eingegangen. Und einmal im Monat hält er eine Sprechstunde in der Klinik Bad Trissl in Oberaudorf ab. Sein Erfolgsrezept bringt Köberle dabei auf einen einfachen Nenner: „Ich kann zuhören und etwas bewegen.“ Allerdings, fügt er enttäuscht an, sei die Bürgerberatung bereits einige Male kurz vor dem Aus gestanden. Denn weder von der Stadt noch vom Landkreis erhalte der gemeinnützige Verein mit seinen knapp 30 Mitgliedern Zuschüsse.
24. September 2007
 |
 |
I n die Arbeit der Rettungshundestaffel Inntal e.V. durften Rohrdorfer Kinder im Rahmen des Ferienprogramms einen Vormittag lang hineinschnuppern. Bei verschiedenen Vorführungen erfuhren die Mädchen und Buben allerlei Wissenswertes über die Ausbildung und die oftmals lebensrettenden Einsätze der Vierbeiner – egal ob Tibet-Terrier, Labrador oder Altdeutscher Schäferhund - bei der Suche nach Vermissten im Gelände oder nach Verschütteten (Flächen- und Trümmersuche) sowie beim Mantrailing (Fährtensuche).Darüber hinaus zählen zur Rettungshundestaffel Inntal einige der wenigen geprüften Wassersuchhunde in Deutschland; sie können vom Boot aus Ertrunkene bis zu einer Wassertiefe von 40 Metern orten. Weitere Infos über die ehrenamtlichen Rettungshunde-Teams gibt’s bei der Geschäftsstelle in Rosenheim, Telefon 08031/893539 oder im Internet unter www.rhs-inntal.de. Text und Fotos: Pilger |
von Marisa Pilger
 |
| Längst beschränken sich die Bonsai-Liebhaber nicht mehr nur auf die in Japan heimische Mädchenkiefer (das Exemplar auf dem Foto ist rund 60 Zentimeter hoch). Neben heimischen Bäumen ist auch der Rosmarin (rechts) ein beliebtes Gestaltungsobjekt. |
„Bonsai sind keine spezielle Züchtung.“, räumt Heinz Zuschke gleich zu Beginn mit einem weitverbreiteten Irrglauben auf. Werden die Pflanzen nicht mehr in der Schale gezogen und gestaltet, wächst sich ein Bonsai auch noch nach Jahren zur Größe eines „normalen“ Baumes aus. Vor neun Jahren hat der Kolbermoorer den Vorsitz des Arbeitskreises von Alois Hemberger aus Raubling übernommen. Und immer wieder muss er gegen das Vorurteil der „Vergewaltigung der Natur“ ankämpfen, wenn die Sprache auf seine Leidenschaft kommt. Der Bonsai, erklärt er, werde zwar auf kleinstem Raum aber unter optimalen Bedingungen gehalten, mit dem Ziel, ein harmonisches Miniatur-Abbild der Natur nachzuempfinden.
Buddhistische Mönche hatten im 10. und 11. Jahrhundert die Bonsai-Kunst nach Japan gebracht. Auf der Weltausstellung in Paris wurde die fernöstliche Gartenkunst im Jahr 1878 erstmals einem westlichen Publikum vorgestellt und fand schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg Liebhaber auf dem ganzen Erdball.
 |
| Egal ob Freilandbäumchen oder Zimmerpflanzen. „Wirklich fertig ist ein Bonsai nie.“, betont Heinz Zuschke, der Vorsitzende des Bonsai-Arbeitskreises Inntal. Fotos: Pilger |
Bis zu 1,30 Meter und mehr ragen die Zwei-, Drei- oder gar Vier-Mann-Bonsai (je nachdem, wieviele Hände zum Transport anpacken müssen) in die Höhe, während der „Bonsai für eine Hand“ gerademal 20 bis 40 Zentimeter misst. Als kleinste Art gilt der Miniaturbonsai, der manchmal auch Taschenbonsai genannt wird; vier bis fünf Exemplare von ihm haben auf einer Hand Platz.
Unkundigen stoße besonders das Drahten und Spannen sauer auf, weil Äste mithilfe von eloxiertem Aluminiumdraht in eine bestimmte Richtung „gezwungen“ werden, weiß Zuschke. Doch nur mit viel Geduld und durch das „ständige Miteinander von Pflanze und Mensch“ entstünden die augenfälligen Bonsai-Formen, deren Klassifizierung reicht von „streng aufrecht“ (Chokkan) und „frei aufrecht“ („Moyogi“) über „windgepeitscht“ (Fukinagashi) bis hin zur „Besenform“ (Hokidachi) und „Kaskade“ (Kengai). Sogar ganze Wälder en miniature (Yose-ue) können entstehen, wenn Bäume unterschiedlichen Alters in einer Schale arrangiert werden.
An „Rohstoffen“ mangelt es den Bonsai-Liebhabern dabei nicht: Längst beschränkt sich das Repertoire nicht mehr nur auf die in Japan heimische Mädchenkiefer oder den Chinesischen Wacholder. Zuschke: „Bonsai können aus fast jedem heimischen Baum gestaltet werden.“ - egal ob Feldahorn, Esche oder Kastanie, ob Apfelbaum oder Lärche. Jungpflanzen und Ableger eignen sich zum Formen ebenso wie Sämlinge. Die Königsdisziplin aber ist die Gestaltung von „Yamadori“, von verkümmerten Findlingen, wie man sie etwa in Felsspalten im Gebirge entdecken kann.
Knapp 40 Mitglieder zählt der Arbeitskreis Inntal heute. Doch, schmunzelt Zuschke, sei die Dunkelziffer der Bonsai-Fans viel höher. Schon oft habe er erlebt, dass sich Menschen im Gespräch mit einem Gleichgesinnten zu ihrer heimlichen und beileibe nicht kostspieligen Leidenschaft bekannt hätten, die vielerorts aber nur belächelt werde.
Kindern unterdessen sind Berührungsängste mit Bonsai offenbar fremd: Der Schnupperkurs, den der Arbeitskreis seit Jahren im Raublinger Ferienprogramm anbietet, erfreut sich jedenfalls größter Beliebtheit.
11. Juni 2007
Rosenheim (pil) – Sie sind für sich gesehen ein erfolgreiches kleines Unternehmen. Sie stehen Existenzgründern mit Rat und Tat zur Seite, entwickeln gemeinsam mit Unternehmern Geschäftsstrategien, nehmen die Buchhaltung unter die Lupe, kurbeln das Marketing an oder führen in einem angeschlagenen Betrieb übergangsweise die Geschäfte. Trotzdem wird lediglich eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von 85 Euro fällig, wenn einer der zehn „Aktiven Wirtschafts Senioren“ (A-W-S) bis zu drei Monate lang die Betreuung eines Handwerkers, Dienstleisters oder Gewerbetreibenden übernimmt. Der Gewinn des gemeinnützigen „Unternehmens“ A-W-S misst sich allein am Nutzen für seine Auftraggeber.
Wie die Vereinsvorsitzende Edeltraud Hinkel fühlt sich auch Josef Kugler mit seinen „zwei mal 35 Jahren“ sichtlich wohl im selbstgewählten Unruhestand: „Wir haben einfach Spaß daran und wollen unser jahrzehntelang angesammeltes Wissen und unsere Erfahrung weitergeben.“, begründen sie ihr ehrenamtliches Engagement für Geschäftsleute, die vor dem Sprung in die Selbständigkeit stehen oder aber im Berufsleben kräftig zu rudern haben.
Besonders am Herzen liegt den A-W-S, die im vergangenen Jahr aus der Rosenheimer Gruppe der Aktivsenioren ausgeschieden sind und sich im September 2006 selbständig gemacht haben, die Hilfestellung für Unternehmer, Behörden und Vereine in der Region. „Wir kennen den Markt und viele Leute. Und wir halten intensiven Kontakt zur Wirtschaftsförderung im Landratsamt Rosenheim sowie zur Agentur für Arbeit.“
| Informationen und Sprechstunde Wer die Hilfe der „Aktiven Wirtschafts Senioren“ in Anspruch nehmen will, erhält nähere Informationen im Internet unter www.a-ws.de oder bei der Vorsitzenden Edeltraud Hinkel (Telefon 08031/5507 beziehungsweise hinkel@ronet.de). Jeden ersten Donnerstag im Monat bieten die A-W-S darüber hinaus eine kostenlose Sprechstunde im Landratsamt Rosenheim an. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich unter 08031/392-3203. |
Die acht anderen Mitarbeiter sind ebenfalls eng mit Rosenheim beziehungsweise dem Umland verbunden und hatten im Berufsleben leitende Positionen in unterschiedlichen Fachgebieten inne. So erklärt sich auch das umfangreiche Angebot an Dienstleistungen der A-W-S, das von der Rating-Beratung bis zur Firmenübergabe, vom Krisenmanagement bis zur Insolvenzabwicklung reicht – samt und sonders honorarfrei. Und bestehen Zweifel an der Umsetzbarkeit einer Geschäftsidee, „raten wir auch schon mal ab“, erklärt Hinkel.
Sich als A-W-S engagieren heißt aber auch, ständig auf dem Laufenden bleiben zu müssen, was etwa Verordnungen und Förderrichtlinien angeht. Einen nicht unerheblichen Teil ihres „Rentner“-Daseins investieren die zehn ehemaligen Manager deswegen in die eigene Fortbildung, besuchen Vorträge und machen sich via Internet über aktuelle Entwicklungen kundig.
Rund 300 Arbeitsplätze, schätzt Kugler, haben aktive Senioren mit ihrem Engagement in den vergangenen Jahren in Stadt und Landkreis Rosenheim gerettet beziehungsweise geschaffen; eine neues Sportgeschäft oder eine gerade erst eröffnete Logopädiepraxis im Raum Wasserburg seien dabei ebenso wie der noch junge Andenkenladen im Chiemgau nur einige wenige Beispiele. Und auch bei dem „Klosterladen“, der sich in Rosenheim etablieren will, habe die A-W-S Starthilfe geleistet.
10. Mai 2007
 |
| „Motivationskonferenz“ zum Wahlkampfauftakt für die Region: SPD-Bezirksvorsitzender Ewald Schurer, der Unterbezirksvorsitzende Rosenheim-Land, Roland Schmidt, Fraktionschef im Landtag Franz Maget und Maria Noichl, Unterbezirksvorsitzende Rosenheim-Stadt (von links). Foto: Pilger |
Rosenheim (pil) – So früh wie noch nie will die Landes-SPD ihre Mitglieder systematisch auf ein bevorstehendes Wahljahr einstimmen. Zu diesem Zweck trafen sich jetzt in Westerndorf St. Peter rund 70 Ortsvorsitzende, Mandatsträger und Kandidaten aus Rosenheim und dem Umland zu einer von bayernweit 15 geplanten „Motivationskonferenzen“ mit der Überschrift „Aus Liebe zu Bayern – Erfolg 2008“. Franz Maget, der Chef der SPD-Landtagsfraktion, gab gemeinsam mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden Florian Pronold, dem Bezirksvorsitzenden Ewald Schurer und dem Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, den Startschuss für den Wahlkampf in der Region.
Zwar stelle die SPD in Bayern als dem einzigen Bundesland die Oberbürgermeister in den drei größten Städten. „Doch wir wollen auch in den ländlichen Regionen erfolgreich sein.“, formulierte Maget bei einem der internen Konferenz vorangehenden Pressegespräch im Gasthaus Höhensteiger das Ziel des Landesverbands. Unter dem Motto „Jetzt reden Sie - Ihr Anliegen ist unser Programm“ starten die weiß-blauen Sozialdemokraten deshalb im Vorfeld der Kommunalwahlen am 2. März 2008 eine Dialogkampagne, über deren Details die Parteibasis im Zuge der Veranstaltung informiert wurde. Geplant sind unter anderem Fragebogenaktionen und Hausbesuche bei den Bürgern.
„Wir entwickeln gemeinsam mit den Menschen Zukunftskonzepte für die Kommunen, nicht über ihre Köpfe hinweg.“, betonte Florian Pronold. Angesichts der ebenfalls in 2008 anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen gelte es zudem, bei Themen wie Kinderbetreuung, Schul- und Energiepolitik die kommunale mit der landespolitischen Ebene zu verknüpfen. Zumal sich die SPD, wie Pronold ergänzte, „um die Sorgen der Bürger kümmert, während die CSU sich weiterhin mit sich selbst beschäftigt.“
Große Bedeutung misst Maria Noichl, die Unterbezirksvorsitzende Rosenheim-Stadt, nicht zuletzt dem Motivationsschub für die vielen Ehrenamtlichen durch die prominent besetzte Konferenz bei, wie sie in der Gesprächsrunde deutlich machte, der auch ihr Kollege aus dem Landkreis, Roland Schmidt, sowie die Raublinger Bürgermeisterkandidatin Alexandra Burgmaier angehörten. Noichl: “Wir wollen die SPD-Politik wieder in die Köpfe bringen, in vielen Herzen ist sie schon.“
25. April 2007
Söllhuben/Landkreis (pil) – Es war ein umfangreiches Programm, welches die 79 Delegierten der Jungen Union Rosenheim-Land bei der Kreisversammlung unter Tagesordnungspunkt 12 - Neuwahlen - zu absolvieren hatten. Mit einer deutlichen Mehrheit von 94,7 Prozent wurde Kreisvorsitzender Florian Ludwig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Als Stellvertreter stehen dem 27jährigen Rohrdorfer nun Julia Müller (Neubeuern), Christian Müllers (Raubling), Kajetan Zwirglmaier (Wasserburg-Soyen) und Peter Kolb (Bruckmühl) zur Seite. Einen weiteren Schwerpunkt bei der Versammlung in Söllhuben setzte CSU-Landratskandidat Josef Neiderhell: Er beleuchtete die „Perspektiven für die Jugend im Landkreis Rosenheim“.
 |
| JU-Landesgeschäftsführer Christian Hügel, Florian Ludwig, der alte und neue Vorsitzende des Kreisverbands Rosenheim-Land, Bezirksvorsitzender Georg Rohleder und die Stellvertreter im Kreisverband Christian Müllers, Kajetan Zwirglmaier, und Peter Kolb (von links). Julia Müller absolviert gerade ein Auslandssemester und wurde in Abwesenheit gewählt. Foto: pil |
Kritik hatte Florian Ludwig eingangs an der Bundesregierung geübt. Vorbei seien die „schönen Zeiten von Rot-Grün“ mit klaren Fronten. „Jetzt regieren wir mit.“, aber manchmal kann sich Ludwig eines „komischen Gefühls im Magen“ nicht erwehren. „Wo sind die angekündigten Strukturreformen?“, fragte er etwa in die Runde. Auch gegenüber Brüssel wünscht sich der JU-Kreischef mehr Mut und Rückgrat in Berlin. Südtirol etwa wolle den Tanktourismus nun im Alleingang mit einem Tankkarten-System eindämmen. Indes seien Vorstöße der Jungen Union, in bayerischen Grenzgebieten ein Stufenmodell einzuführen, bislang verpufft. „Wir bleiben an dem Thema dran.“, versprach die Bundestagsabgeordnete Daniela Raab, wenngleich sich „auch in der CSU viele vor einer Entscheidung drücken“.
Auch hätte sich Ludwig in jüngster Zeit mehr Nähe des Ministerpäsidenten zur Basis gewünscht. „Ganz so unrecht hat Pauli wohl nicht gehabt mit ihrer Kritik.“, gab er zu Bedenken. Über die Art und Weise allerdings, auf welche Edmund Stoiber gechasst worden sei, sei er „nicht glücklich“.
|
Weitere Wahlergebnisse Für die Finanzen ist weiterhin Schatzmeister Anian Kammerloher zuständig; als Schriftführer fungieren nun Tanja Obermayer und Johanna Wernberger. Den Vorstand komplettieren als Beisitzer: Toni Huber (Aschau), Katharina Tschiesche (Vogtareuth), Lorenz Baumgartner (Frasdorf), Stefan Schroller (Kiefersfelden), Regina Schlosser (Großkarolinenfeld), Hans Aßbichler (Stephanskirchen), Herbert Unterreiner (Stephanskirchen), Anna Weißenbacher (Brannenburg), Christian Staber (Amerang), Stefan Schlier (Bad Aibling) und Hans Hinterberger (Soyen). In einem wahren Wahlmarathon wurden darüber hinaus die Delegierten zur Bezirks- und Landesversammlung bestimmt. |
Die Bedeutung der jungen Generation im allgemeinen und der Jungen Union im Besonderen für die künftige Entwicklung im Lande strich nicht zuletzt der CSU-Kreisvorsitzende Klaus Stöttner heraus. Vor allem aber forderte der Landtagsabgeordnete die JU'ler auf, sich weiterhin „frech“ ins politische Geschehen einzumischen und als „flotte Schnellboote“ immer wieder für den nötigen Anschub beim „Dampfer CSU“ zu sorgen. Jedoch, konterte Landesgeschäftsführer Christian Hügel, der die Neuwahlen leitete, sei die angestrebte Quote von wenigstens einem JU-Vertreter in jedem CSU-Ortsvorstand längst nicht erfüllt.
Einen „positiven Blick auf Kinder und Familie“ mahnte noch zu später Stunde der Bezirksvorsitzende Georg Rohleder mit Verweis auf das neue CSU-Grundsatzprogramm an. Wie der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Stefan Beer, rief auch er seine Zuhörer mit Nachdruck dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und bei den Kommunalwahlen am 2. März 2008 zu kandidieren.
26. April 2007
 |
| Ein einwöchiges Praktikum haben die beiden Rosenheimer bereits absolviert, und am 1. September geht’s richtig los: Sebastian Thane (rechts) wird im Lebensmittelmarkt in Bad Aibling arbeiten, während Seid Duranovic (links) seine Ausbildung zum Verkäufer in Raubling beginnt. Nach zwei Jahren können sie entscheiden, ob sie ein weiteres Lehrjahr für die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann anhängen. Monika Prechtl, Gesellschafterin der Prechtl Frischemarkt OHG und Mitglied des IHK-Prüfungsausschusses bei den Einzelhandelskaufleuten, begrüßte ihre künftigen Lehrlinge schon jetzt ganz herzlich. Foto: pil |
Seit 1. Februar kümmert sich die Ausbildungs- und Arbeitsvermittlerin Monika Hofmann von Pro Arbeit im Auftrag der ARGE um Arbeitslose bis 25 Jahre aus Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II, die sonst nur geringe Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten. Sebastian Thane etwa hat zuletzt ein ABM-Programm absolviert; Seid Duranovic besucht die JoA-Klasse (Klasse für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz) an der kaufmännischen Berufsschule. Beides Bewerber also, die ohne die Rückendeckung der Arbeitsstellenvermittlerin unweigerlich ausgesiebt würden.
„Ohne den Kontakt zu Monika Hofmann hätte es für die beiden jungen Männer eher schlecht ausgeschaut.“, gibt auch Monika Prechtl unumwunden zu. Aus mehr als 60 Bewerbungen, die bei ihr auf die Ausschreibung von insgesamt vier Lehrstellen eingegangen sind, konnte die Unternehmerin auswählen. Entsprechend groß war die Freude über Prechtls Entscheidung deshalb auch auf Seiten von ARGE-Geschäftsführer Christian Meixner und seiner Stellvertreterin Ingrid Kuchler, die ebenfalls nach Raubling gekommen waren.
Eine Gesetzesänderung hatte bereits im vergangenen Jahr den Weg für das Projekt geebnet. Waren bis zum Jahreswechsel die Jugendlichen der Agentur für Arbeit zugeteilt, ist seither die ARGE im Sozial-Rathaus in der Reichenbachstraße Anlaufstelle für die Betroffenen im Rahmen von Hartz IV. Zwei eigens auf die Arbeit mit jungen Arbeitslosen spezialisierte Vermittler picken hier die ernsthaft Interessierten heraus und reichen diese an Monika Hofmann weiter, welche gegebenenfalls nochmals genau Stärken und Schwächen abwägt.
Nur rund ein Viertel der gegenwärtig 180 ARGE-„Mandanten“ fallen so nun in ihren Zuständigkeitsbereich, wodurch eine individuelle und effektive Betreuung der Jugendlichen erst möglich wird. Den engen persönlichen Kontakt zu Arbeitgebern in der Stadt und in der Region führt Christian Meixner als weiteren großen Pluspunkt der neuen, von der ARGE Rosenheim Stadt finanzierten Vermittlerstelle ins Feld. Darüber hinaus steht Hofmann den Lehrlingen und ihren Ausbildern bei Problemen während der Ausbildungszeit zur Seite.
Ähnliche Erfolgsmeldungen wie aus Raubling könnten unterdessen auch bald von der ARGE Landkreis Rosenheim kommen: Hier ist – ebenfalls in Kooperation mit dem Verein Pro Arbeit – am 1. März ein vergleichbares Programm angelaufen.
1. April 2007
Hochstätt/Landkreis (pil) - „Wir sind nicht mehr viele. Aber wir haben die wichtige Aufgabe, die Ernährung zu sichern.“ BBV-Kreisobmann Sepp Bodmaier ließ keinen Zweifel an der Bedeutung des Bauernstandes. Und auch wenn das Büffeln nach den anstrengenden Prüfungswochen für die nächsten Tage und Wochen erst einmal auf Eis liegt, appellierte Bodmaier, ebenso wie die stellvertretende Landrätin Marianne Steindlmüller, bei der Schulschlussfeier der Landwirtschaftsschule Rosenheim an die jungen Leute, nie mit dem Lernen aufzuhören. „Ihr seid unsere Zukunft! Ihr habt es in der Hand!“, betonte er und machte zugleich denjenigen Mut, deren Noten nicht so überragend ausgefallen waren.
 |
| Stellvertretende Landrätin Marianne Steindlmüller, die Schulleiterin Abteilung Hauswirtschaft Hildegard Brandl, Barbara Sappl aus Antdorf (Kreis Weilheim/Schongau), Maria Seehuber aus Steinhöring (Kreis Ebersberg), Christine Schwäbl aus Bruck (Landkreis Ebersberg) mit Semesterleiterin Marlies Schwaller und BBV-Kreisobmann Sepp Bodmaier (von links). Foto: pil |
Hildegard Brandl, Leiterin der Abteilung Hauswirtschaft, hatte das Bild des weißen Rauchs im Vatikan auf die rauchenden Köpfe der nach drei Semestern nunmehr staatlich geprüften Wirtschafterinnen umgemünzt („Wir haben fertig!“). Den Schulbetrieb im abgelaufenen Semester hätten vor allem die Veränderungen aufgrund des neuen Lehrplans geprägt, führte Brandl aus. „Die schulischen Neuerungen werden uns noch eine Weile beschäftigen.“, ist sie überzeugt. Zumal seit dem Wintersemester 2006/2007 Hauswirtschafterinnen in Rosenheim nun auch ihren Meister machen können; aus diesem Anlass hatte Josef Miller, Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten, der Schule im November einen Besuch abgestattet.
Im Zeitraffer ließ Semesterleiterin Marlies Schwaller einige Meilensteine des eineinhalbjährigen Lehrgangs Revue passieren. So hatten die frischgebackenen Absolventinnen als erster Jahrgang eine Backaktion zugunsten der „Aktion für das Leben“ durchgezogen und dabei acht Kilo Plätzchen fabriziert. Das prämierte Semesterbild „Wellness im Heu“, das als Kalenderbild einen Monat Tag für Tag Werbung macht für die Landwirtschaftsschule Rosenheim, hob Schwaller darüber hinaus als gelungene Marketing-Maßnahme ihrer Studentinnen hervor. Mit einem Rollentausch klang die offizielle Feier aus: Die Drittsemester nahmen dabei mit viel Witz die Eigenheiten ihrer „Pauker“ aufs Korn und verabschiedeten sich so endgültig. Für alle anderen beginnt am Montag, 26. März, das nächste Semester an der einstigen „Winterschui“.
Absolventinnen und Jahrgangsbeste
Mit Buchpreisen und einem Stipendium an einer Land-Volkshochschule wurden die drei besten Absolventinnen der Abteilung Hauswirtschaft bedacht: Maria Seehuber aus Steinhöring/ Landkreis Ebersberg (Notendurchschnitt 1,20), Christine Schwäbl aus Bruck/ Landkreis Ebersberg (1,26) und Barbara Sappl aus Antdorf/ Kreis Weilheim-Schongau (1,33). Desweiteren schlossen ihre Ausbildung ab: Magdalena Baumgartner aus Tuntenhausen, Eva-Maria Diechler (Pfaffing), Anneliese Hermann (Irschenberg), Katharina Jörg (Holzkirchen), Marlis Kundinger (Herzogenaurach), Veronika März (Königsdorf), Regine Müller-Tolk (Staudach-Egerndach), Marianne Nöscher (Holzkirchen), Monika Obermaier (Hochstätt), Barbara Pirsch (Mettenheim) und Anna Vorbuchner (Reischach).
Jahrgangsbeste bei den 20 Erstsemestern Hauswirtschaft wurden: Martina Schrott aus Nabburg/ Landkreis Schwandorf (1,22), Caroline Seidl aus Vogtareuth und Juliane Freiberger aus Babensham (beide 1,55) sowie Theresia Forstner aus Bad Endorf und Margit Sporer aus Wielenbach/ Landkreis Weilheim-Schongau (beide 1,66).
Bei den 31 Studierenden der Abteilung Landwirtschaft (1. Semester) stachen hervor: Martin Hoeher aus Frauenneuharting/ Landkreis Ebersberg (1,30), Johannes Fichtner aus Fischbachau/ Kreis Miesbach (1,60) sowie Rudolf Liedl aus Griesstätt und Johannes Strein aus Neubeuern (beide 1,70).
29. März 2007
 |
| Emanuel von Oy hat das Wachstum bei Kresse und Senf beleuchtet: Als Regionalsieger Biologie in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“ fährt der Wirtschaftsschüler am 23. April zum Landesentscheid nach Dingolfing. Fotos: Pilger |
 |
| Was Gymnasiasten so alles auf dem Buckel haben, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, wie Michaela Meyer, Franziska Pilger und Sandra Meyer (von links) bei ihrer „Aktion leichtere Schulranzen“ feststellten. |
„Rein zufällig“ war der Sohn eines Landschaftsgärtners über das Thema gestolpert, mit dem er bereits im vergangenen Jahr angetreten war. Die Auswirkungen von rotem, grünem, blauem und gelbem Licht auf das Saatgut hatte der Schüler jeweils untersucht, wobei er im zweiten Anlauf sein Augenmerk insbesondere auf die exakte Analyse und genaue Angaben zu Wellenlänge und Ernte-Ausbeute richtete.
Dabei hatte der Nachwuchsforscher wegen einer schweren Erkältung zunächst mit dem Gedanken gespielt, gar nicht bei dem zweitägigen Wettbewerb in Schongau anzutreten. „Und jetzt bin ich Regionalsieger!“, strahlte der Achtklassler nach der Feierstunde in der Realschule Schongau übers ganze Gesicht.
Insgesamt waren in diesem Jahr 99 Teilnehmer mit 55 Arbeiten aus den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik / Informatik, Physik und Technik bei dem von der Firma Hoerbiger International ausgerichteten Entscheid angetreten; zwei Teams davon besuchen Rosenheimer Schulen.
So hatten Franziska Pilger (13 Jahre), Sandra und Michaela Meyer (beide 14) vom Finsterwalder-Gymnasium in einer umfassenden Wiegeaktion an ihrer Schule das Gewicht der Schulranzen in der Unterstufe unter die Lupe genommen. Immerhin soll einer Empfehlung des bayerischen Gesundheitsministeriums zufolge das Gewicht der Rucksäcke samt Inhalt ein Zehntel des Körpergewichts nicht überschreiten. Wie die Untersuchung der drei Schülerinnen der achten Klasse ergab, kann dies aber so gut wie nie eingehalten werden; ein Sieben-Kilo-Ranzen ist durchaus keine Ausnahme. Mit diversen Verbesserungsvorschlägen wollen die Mädchen aus Thansau dem täglichen Schleppen für den Unterricht ein Ende bereiten und damit Kopfschmerzen und bleibenden Haltungsschäden vorbeugen.
11. März 2007
Rosenheim (pil) – Unspektakulär und in entspannter Atmosphäre verlief die Jahreshauptversammlung der Maßschneider-Innung. Auch bei den Neuwahlen ergaben sich so gut wie keine Veränderungen: Ohne Gegenstimme wurde Monika Reiter aus Bernau für weitere drei Jahre als Obermeisterin bestätigt; ihre Stellvertreterin bleibt Barbara Baier aus Kolbermoor.
Rund ein Drittel der Schneiderbetriebe aus Stadt und Landkreis Rosenheim sind in der Innung zusammengeschlossen, die auch auf der Südostmesse mit einem Stand vertreten war. Abgesehen vom Erfahrungsaustausch und vom engen Kontakt unter den Mitgliedern stehen auch immer wieder Betriebsbesichtigungen auf dem Programm; so besuchten die Schneider zuletzt eine Blaudruckerei und eine Plissée-Anstalt. Für den Sommer ist ein Ausflug nach Lustenau, dem Zentrum der Vorarlberger Stickerei-Industrie, geplant.
 |
| Neben Obermeisterin Monika Reiter (rechts) und ihrer Stellvertreterin Barbara Baier (links) gehören dem Vorstand der Maßschneider-Innung wieder Elisabeth Schelzke, Maria Wagner und Heinrich Koula als Beisitzer an. Die beiden letzteren sitzen darüber hinaus im Ausbildungsausschuss. Zum Lehrlingswart wurde Barbara Leibl gewählt. Foto: Pilger |
Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Maßschneider, in dessen Berufsbild seit 2004 die früheren Sparten Damen-, Herren- und Wäscheschneider vereinigt sind. Im Verlauf der Lehre wird der Schwerpunkt entweder auf Damen- oder Herrenschneiderei gesetzt.
Es ist bevorzugt individuelle „Anlasskleidung“ - sei es für den Bridgeabend oder eine Hochzeit -, die sich die Kunden in den Ateliers auf den Leib schneidern lassen. Und mittlerweile, freut sich Reiter, werden auch einige Faschingsgilden von Innungsbetrieben eingekleidet. Umso besser passe da die für März geplante Besichtigung des Miederwarenherstellers Anita in Brannenburg ins Konzept.
Ein größeres „Event“ mit vielen Überraschungseffekten peilt die Obermeisterin indes fürs Frühjahr 2008 im Festsaal der Burg Wasserburg an, welche die Kreishandwerkerschaft Rosenheim im Herbst übernommen hat.
Für einen heiteren Ausklang der Versammlung im Happinger Hof sorgte schließlich Heinz Hußmann - Herrenschneidermeister und viele Jahre im Deutschen Mode-Institut beschäftigt - mit Passagen aus seinem Episodenroman „Schneider, Tod und Teufel“. Mit einem Augenzwinkern lässt der Autor den Schneidermeister Florian Schroffenegger 850 Jahre Münchner Stadtgeschichte erleben und zugleich die Entwicklung seines Berufsstandes vom zünftigen Handwerk zum globalen Modemarkt.
21. Februar 2007
Rosenheim (pil) – Es waren in der Tat die „Börsenkings“, die im Gebiet der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling den ersten Preis beim „Planspiel Börse“ abräumten. Freudestrahlend nahmen Dominik Wied, Julian Söhnlein und Martin Sontag von der Wirtschaftsschule Alpenland, Bad Aibling, bei der Siegerehrung im Sparkassen-Hochhaus die 500 Euro aus der Hand von Sparkassen-Chef Alfons Maierthaler entgegen. Das Trio hatte innerhalb von zehn Wochen stolze 7.105,74 Euro mit virtuellen Wertpapierorders erwirtschaftet.
Mit 50.000 Euro fiktivem Startkapital war jedes der 43.835 Teams aus insgesamt sieben europäischen Ländern bei dem Wettbewerb angetreten, den der Sparkassen-Verlag bereits zum 24. Mal aufgelegt hatte. Im Einzugsbereich der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling hatten anfangs 143 Teams aus allen Schularten auf den Sieg spekuliert. „So viele wie noch nie in den letzten Jahren.“, zog Koordinatorin Alexandra Frank vom Sparkassen-Marketing zufrieden Bilanz. 71 der 122 gewerteten Mannschaften gelang es, durch Aktienkäufe und -verkäufe mehr aus ihrem Geld zu machen; wenn auch - wie in einem Fall – nur 5,98 Euro. Der Rest musste Verluste von bis zu 5900 Euro auf dem Depot verbuchen.
Das vierstellige Minus indes, das die „Börsenkings“ gleich zu Anfang eingefahren hatten, kehrte sich ins Gegenteil; dank klassischer Werte wie Karstadt/Quelle und VW konnten die drei Nachwuchs-Spekulanten letztlich schwarze Zahlen schreiben.
 |
| Siegerehrung mit Ausblick - Die Preisverleihung zum 24. Planspiel Börse ging im elften Stockwerk des Sparkassenhochhauses über die Bühne. Von links: Sparkassen-Chef Alfons Maierthaler, Stefan Weiberg und Markus Loferer („Moneymaker“), Julian Söhnlein, Dominik Wied und Martin Sontag („Börsenkings“), Susanne Schruff („Bulle und Bärchen“) und Planspiel-Koordinatorin Alexandra Frank (von links). Foto: pil |
Einen anderen Weg hatten die Zweitplatzierten „Bulle und Bärchen“ - die tierischen Sinnbilder fürs Auf und Ab der Börsenkurse - eingeschlagen: Susanne Schruff und ihre beiden Mitstreiter vom Finsterwalder-Gymnasium Rosenheim hatten auf den Sportwettenanbieter bwin gesetzt. Einen Gewinn von 7.080,52 Euro wies das Konto der Gymnasiasten schließlich auf, die damit auf regionaler Ebene den zweiten Preis in Form von 300 Euro einstreichen konnten (Bayern 32./ Deutschland 110.)
Auf dem mit 200 Euro dotierten dritten Platz landeten die „Moneymaker“ (Sprecher Stefan Weiberg) von der Dientzenhofer-Realschule in Brannenburg mit einem Plus von 5.707,45 Euro (Bayern 99. / Deutschland 331.). Sachpreise gingen an die viert- und fünftplatzierten „BörsenCracker“ (55.160,73 Euro) um Tim Schark und „money makers“ (54.766,45 Euro) um Philipp Schmitt, beide vom Gymnasium Bad Aibling.
Beim Tipp für den EuroStoxx50 lagen die „Black-Börsianers“ um Ludwig Biller vom Ignaz-Günther-Gymnasium Rosenheim mit ihrer Prognose für den 12. Dezember von 4051,31 Punkten (tatsächlich 4054,72) auf regionaler Ebene am besten (Platz 24 im Freistaat).
Gewonnen, so Maierthaler, hätten aber alle Teilnehmer zumindest an Erfahrung, und so mancher die Überzeugung, „wie gut, dass es nicht das eigene Geld war“. Denn mit dem Planspiel eröffne sich den Jugendlichen ein vielschichtiges und hochtechnisiertes Marktgeschehen – längst werden sämtliche Orders via Internet abgewickelt – mit all seinen Risiken. Sein Dank galt deshalb den Lehrern, die die Jung-Börsianer betreut hatten.
Einen kurzen Überblick über das Geschehen an den Aktienmärkten während des Planspiels von Ende September bis Mitte Dezember gab Vermögensberater Michael Kösters. So hatte die bevorstehende Mehrwertsteuererhöhung zwar zunächst für Schwankungen am deutschen Aktienmarkt gesorgt, letztlich aber nicht den befürchteten Abschwung gebracht. Auch in den USA hatte sich das Konsumklima wieder aufgehellt. Der sinkende Ölpreis habe sich anregend auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt und den Nachwuchs-Brokern noch eine „schöne Spielphase“ beschert. Auf mittlere Sicht schätzt Kösters den Verlauf des europäischen Marktes weiterhin positiv ein.
Bei den Sparkassen laufen unterdessen die Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe des Planspiels: Am 1. Oktober startet die 25. Auflage des Wettbewerbs.
17. Februar 2007
Rohrdorf (pil) – Es herrscht Aufbruchstimmung unterm Dach des alten Schulhauses. „Wir leisten Pionierarbeit in Kleingruppen.“, beschreibt Schulleiter Herbert Rechmann die Atmosphäre drei Monate nach dem Startschuss für die private Montessori-Fachoberschule (FOS) in Rohrdorf, die gemeinsam mit der Einrichtung in Passau eine bayernweite Vorreiterrolle innehat (wir berichteten). Sieben Jugendliche, fünf davon direkt im Anschluss an die M-Klasse der Montessori-Hauptschule, peilen hier seit Herbst ihr Fachabitur in den Fachrichtungen Wirtschaft/Recht beziehungsweise Sozialwesen an.
Stundentafeln und Unterrichtsinhalte für die 11. und 12. Jahrgangsstufe orientieren sich dabei im Wesentlichen am staatlichen Lehrplan. Und wie die Schüler an der staatlichen FOS absolvieren die Jugendlichen im ersten Jahr Betriebspraktika im Wechsel mit Unterrichtsblöcken. Doch statt auf den an Regelschulen üblichen Frontalunterricht setzt die Montessori-Schule auch in der Sekundarstufe II auf selbständiges Arbeiten in Kleingruppen, auf individuelle Studierzeiten, jahrgangsgemischte Klassen und nicht zuletzt auf fächerübergreifende Projekte. Anhand der virtuellen Staubsaugerfirma „Ultraclean“ etwa will Josef Nikolaus Braun seinen Schülern nicht nur betriebs- und volkswirtschaftliche Zusammenhänge erklären; auch Bereiche wie Wirtschaftsenglisch, Organisationswesen, Marketing oder Steuerrecht könnten an dem Unternehmen griffig aufbereitet werden.
Im Vorgriff auf eine mögliche FOS 13, die dann mit der allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen werden könnte, steht darüber hinaus Italienisch als Wahlfach im Angebot.
Was allerdings noch komplett fehle, sei Montessori-Freiarbeitsmaterial für die Sekundarstufe II, erklärt Sabine Huber, die Leiterin der Grund- und Hauptschule, die mitterweile knapp 340 Kinder besuchen. Deshalb, bedauert sie, müsse man in der FOS momentan verstärkt auf für die Reformpädagogik der Maria Montessori (1870 bis 1952) eher untypischen Lehrbücher zurückgreifen.
Als Versuchskaninchen fühlen sich die Schüler – vier davon Mädchen - derweil nicht im geringsten. Bereits jetzt wissen auch die beiden Quereinsteiger die Unterrichtsatmosphäre in dem kleinen zielstrebigen Kreis zu schätzen. Insgesamt acht Prüfungen stehen für die Klasse im übernächsten Jahr an: Deutsch, Englisch, Mathe und ein zweigspezifisches Fach seien für alle Anwärter auf die Fachhochschulreife verpflichtend, erläutert Rechmann. Für die Montessori-Schüler als externe Prüflinge an einer staatlichen Schule kämen vier weitere dazu, da sie nicht mit Vornoten aufwarten können; denn Zeugnisse mit Noten gibt es an der Privatschule nicht.
„Doch den Spagat zwischen Montessori-Grundgedanken und Prüfungsnotwendigkeit kriegen wir hin.“, sind Huber und Rechmann gleichermaßen überzeugt. Letzterer muss zunächst selbst noch dazu lernen. Rechmann stand bis zu seiner Pensionierung im Sommer 37 Jahre lang als Mathematik- und Physiklehrer am Finsterwalder-Gymnasium in Rosenheim vor Klassen mit oftmals 30 und mehr Schülern.
Die Kosten für die FOS in Rohrdorf muss die Privatschule anfangs komplett selbst bestreiten. Erst wenn jeweils wenigstens zwei Drittel der Montessori-Kandidaten die Abitur-Prüfungen 2008 und 2009 bestehen, fließen seitens des Staates Finanzmittel in Höhe von 65 Prozent der förderfähigen Kosten, erläutert Alejandrina Höllbauer vom Vorstand des Trägervereins. Gemeinsam mit Marlies Berninger – der stellvertretenden Leiterin von Grund- und Hauptschule – hatte sie sich beim Landesverband für Rohrdorf als einen der ersten FOS-Standorte Bayerns stark gemacht. Die Einführung der Sekundarstufe II, hofft sie zudem, könnte endlich auch das Ansehen der Montessori-Schulen, die immer noch von vielen als Hilfsschulen belächelt würden, aufwerten.
16. Dezember 2006
Landkreis/Raubling (pil) – „Das find' ich klasse!“ Ernst Baumann, Vorsitzender des bayernweiten Arbeitskreises Schule Wirtschaft, ließ keinen Zweifel daran, wie sehr er die Gründung des regionalen Arbeitskreises Schule-Wirtschaft für die Stadt und den Landkreis Rosenheim begrüßte. Schließlich, betonte das Vorstandsmitglied der BMW AG bei der Auftaktveranstaltung im Gymnasium Raubling, sei Bildung „der wichtigste Rohstoff am Wirtschaftsstandort Deutschland“, welchen es heute mehr denn je zu fördern gelte. Mittels eines branchen- und schulartübergreifenden Netzwerks als Nahtstelle zwischen Schulen und Betrieben will der Arbeitskreis, der am Donnerstag offiziell aus der Taufe gehoben wurde, künftig schulische und betriebliche Ausbildung in der Region besser aufeinander abstimmen.
Das neue Gremium solle dabei alles andere als ein Debattier-Club werden, versprach Alfons Maierthaler in der Raublinger Aula vor rund 170 Gästen. Die Chancen auf Erfolg stünden angesichts des reichhaltigen Branchen-Mix der rund 3000 Unternehmen im Landkreis dabei durchaus gut. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling steht dem Arbeitskreis auf der Wirtschaftsseite vor; die Schulen vertritt die Rektorin der Johann-Rieder-Realschule Rosenheim, Stephanie Keill.
 |
| Rund 170 Gäste aus den verschiedensten Bereichen begrüßte Schulleiterin Kathrin Hörmann-Lösch in der Aula des Raublinger Gymnasiums, darunter Realschulrektorin Stephanie Keill als Arbeitskreis-Vorsitzende der Schulseite, die CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Raab, Ernst Baumann, Vorstandsmitglied bei BMW, Sparkassenchef Alfons Maierthaler als Arbeitskreis-Vorsitzender auf Seite der Wirtschaft, und Elisabeth Schmid, Geschäftsführerin des Landes-Dachverbands (von links). Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Schul-Big Band unter Leitung von Martin Stolz; zudem sorgten die Arbeitsgemeinschaften Technik und Catering für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung inklusive anschließendem Stehempfang. Foto: pil |
Gerade der rasante Wandel in der Arbeitswelt – alte Tätigkeitsbereiche fallen weg, neue entstehen – erfordere den ständigen Dialog mit der freien Wirtschaft, um die Schüler gezielt für die Anforderungen in den Unternehmen fit zu machen, betonte Keill. Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer und Schulleiter sollen den partnerschaftlichen Brückenschlag zwischen Schule und Wirtschaft untermauern und zum besseren Verständnis sowie zur „gegenseitigen Wertschätzung“ auf beiden Seiten beitragen.
Geburtshilfe für Rosenheim hatte nicht zuletzt der Arbeitskreis in Wasserburg geleistet, der dort bereits seit 19 Jahren etabliert ist. Für den „Täufling“ hatte der dortige Vorsitzende Wolfgang Helmdach sogar einen Weisertwecken mitgebracht.
Die Früchte des Modells, die Schule, Schülern und Betrieben gleichermaßen zugute kämen, „werden sie bald ernten“, stellte Ernst Baumann in Aussicht. Zwar lag es dem BMW-Vorstand fern, ein „Klagelied auf die Bildungssituation“ anzustimmen. Doch stellte er in seinem Vortrag klar heraus, dass er den Technologiestandort Deutschland in Gefahr sehe. Die wissenschaftliche Elite wandere vermehrt ins Ausland ab. Darüber hinaus machte der Referent große Mängel am Bildungsniveau aus, deren Folgen letztlich die gesamte Gesellschaft zu tragen habe. Oft klafften die Anforderungen, die ein Wirtschaftsunternehmen an Bewerber stelle, und der Kenntnisstand der Schulabgänger weit auseinander, kritisiert er. Rund 1200 Lehrlinge stelle BMW in Deutschland pro Jahr ein; wie jedoch die Auswertung eines Bewerberjahrgangs ergeben habe, zöge sich zunehmend eine Schwäche in „Kulturtechniken“ wie Rechnen, Gesprächsfähigkeit, Allgemeinwissen und Gruppenarbeit durch alle drei Schultypen.
| Kontakt zum Arbeitskreis Egal ob Elternbeiräte, Lehrer, Verbände, Behörden, Unternehmer oder Privatleute: Der neu gegründete Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Rosenheim ist offen für alle Interessierten, betont Arbeitskreis-Geschäftsführer Martin Jerrendorf von der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling. Dort ist auch die Geschäftsstelle angesiedelt; Telefon 08031/182-134. |
Vor allem von der Hauptschule fordert Baumann, die steigenden Anforderungen der Wirtschaft stärker zu berücksichtigen. Sie „darf nicht die ungeliebte Restschule sein“, warnte, wie zuvor schon Stephanie Keill, der BMW-Vorstand, dessen Unternehmen etwa 40 Prozent eines Auszubildenden-Jahrgangs aus der Hauptschule rekrutiert. Eine Lanze brach der Ingenieur auch für die naturwissenschaftlich-technischen Fächer am Gymnasium, die aus seiner Sicht vernachlässigt würden. Mit Aktionen wie Schulpartnerschaften, Hochbegabtenförderung und Schülerwettbewerben sei etwa die BMW Group bestrebt, das Thema Bildung regelmäßig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
Trotz aller Bedenken aber sieht Baumann den Freistaat durchaus auf einem guten Weg. Das bayernweite Netzwerk Schule-Wirtschaft mit der Geschäftsstelle im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft in München habe in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich dazu beigetragen, die Kluft zwischen öffentlichen Bildungseinrichtungen und privater Wirtschaft zu überbrücken. Als beispielhafte Projekte der letzten Jahre stellte er neben dem „Lernzirkel Berufsorientierung“, einer Loseblattsammlung für den Unterricht, und „Profis“, einem Coaching-Projekt für Schulleiter, insbesondere die Online-Plattform „Sprungbrett“ heraus, auf die auch Rosenheim aufspringen will.
11. Dezember 2006
Neubeuern (pil) – Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz – für Sepp Dürr, den Vorsitzenden der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, stellen sie zwei der größten Herausforderungen dar, die es in naher Zukunft zu bewältigen gilt. Unter dem Motto „Unser Inntal braucht Grün“ gab der Parlamentarier bei der Kreisversammlung in Neubeuern einen kurzen Überblick über die aktuelle politische Lage und stellte sich dann den Fragen der etwa 40 Zuhörer in „Auers Schloßwirtschaft“, darunter auch Dürrs Landtags-Kollegin Barbara Rütting. Als einer der Schwerpunkte des Abends, bei dem Dürr an Kritik in Richtung CSU nicht sparte, kristallisierte sich die Bildungspolitik heraus.
Das dreigliedrige Schulsystem als Abbild einer spätfeudalen ständischen Ordnung sei längst nicht mehr zeitgemäß. Anstatt die Schüler bereits in der vierten Klasse einem enormen Auslesedruck auszusetzen, fordert Dürr (Jahrgang 1953) eine gemeinsame Schulzeit bis zur 9. beziehungsweise 10. Jahrgangsstufe, möglichst in ortsnahen Ganztagsschulen. Eine gezielte individuelle Förderung solle die Chancengleichheit für alle Kinder gleich welcher Herkunft herstellen und so jedem die freie Wahl des Bildungsweges ermöglichen. Mit seiner harschen Kritik am bayerischen Schulsystem stieß Dürr allerdings nicht nur auf Zustimmung im Publikum; Widerspruch erntete er auch mit der Feststellung „Bildungsarmut wird vererbt“.
 |
| Sepp Dürr bei der Grünen-Kreisversammlung in Neubeuern. Foto: pil |
Neben der sozialen Gerechtigkeit – benachteiligt sei hier der ländliche Raum - brennt dem Grünen nicht minder der Klimaschutz auf den Nägeln. Längst sei es nicht mehr fünf vor zwölf sondern bereits Viertel nach, was sich etwa bei der Hurrikan-Katastrophe in New Orleans im August 2005 auf dramatische Weise gezeigt habe. „Das weiß inzwischen auch die CSU.“, konstatierte Dürr. Umso unverständlicher sei deshalb deren Haltung etwa bei der Besteuerung von Biodiesel. Dabei sei Klimapolitik – abgesehen vom Umweltgedanken – „auch Wirtschaftspolitik“: Allein im vergangenen Jahr seien auf diesem Sektor 170.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Auch kaufe der Freistaat jährlich für neun Milliarden Euro Energieträger wie Öl im Ausland ein; schon mit einem Bruchteil dieser Summe könnte die Nutzung erneuerbarer Energien im eigenen Land entscheidend vorangetrieben werden, ist er überzeugt.
Scharf verurteilte der Biobauer aus Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) die Kürzungen der EU-Gelder für die sogenannte „zweite Säule“, aus der unter anderem Umweltleistungen der Landwirte honoriert würden. Mit Skepsis verfolgt er auch den Umschwung der CSU in Sachen Gentechnik, der wohl nur bis zur Landtagswahl 2008 anhalten werde. Dürr, der nachdrücklich ein „gentechnikfreies Bayern“ fordert: „Ich traue dem Frieden nicht.“ Zu mehr Bedacht mahnte er die Kommunen schließlich bei der Planung und Ausweisung neuer Gewerbegebiete; denn beim Bodenversiegeln sei Bayern nach wie vor „Spitze“.
13. November 2006
Rosenheim (pil) – „Mit dieser Riesenresonanz hat keiner gerechnet.“ Mehr als zufrieden zog Wolfgang Tschuschner, Ausbildungsleiter der Raiffeisenbank Rosenheim eG, Bilanz für die Informationsveranstaltung „Job in Sicht“, die in diesem Jahr bereits in die dritte Runde gegangen ist. Insgesamt 1868 Teilnehmer aus Gymnasien, Real-, Haupt- und Wirtschaftsschulen konnten die Volksbanken und Raiffeisenbanken in der Stadt und im Landkreis Rosenheim diesmal in den beiden Durchläufen der Infobörse rund ums Thema Berufsstart in der Hammerhalle verbuchen.
Geboren wurde die Veranstaltungsreihe eigentlich aus einer Not heraus. Weil auf den Schreibtischen der verantwortlichen Ausbilder immer weniger Bewerbungen landeten, ging Tschuschner in die Offensive und regte eine Art Lehrwerkstatt zum Thema Bewerben an: Acht Auszubildende der Raiffeisenbank zimmerten schließlich das Konzept für „Job in Sicht“. Bereits bei der Premiere Anfang 2004 sammelten an zwei Tagen insgesamt 200 Jugendliche Informationen rund um den ersten Schritt ins Arbeitsleben; wegen der großen Nachfrage wurde im Oktober des selben Jahres ein zusätzliches Seminar nachgeschoben. Inzwischen haben sich etwa 4800 Schüler an dem Projekt beteiligt, das auch mit den Lehrplänen abgestimmt ist.
Gerade die Idee, Auszubildende als eigenverantwortliche Moderatoren an den einzelnen Stationen einzusetzen, komme bei den Schülern besonders gut an, erklärt Tschuschner. Schließlich seien die Lehrlinge „viel näher dran an den Jugendlichen, und sie sprechen die gleiche Sprache“. Kleine, zufällig zusammengewürfelte Gruppen und „Learning by Doing“ anstelle von Frontalunterricht trügen ein übriges zum Erfolg der Veranstaltungen bei, denen Vertreter aus der Wirtschaft ebenso wie Politiker regelmäßig einen Besuch abstatten. Die Neuntklassler der Rosenheimer Mädchenrealschule hätten in den Kurs sogar einen unterrichtsfreien Nachmittag investiert.
Für „Job in Sicht“ hat sich zu Tschuschners Freude mittlerweile sogar der Genossenschaftsverband Bayern interessiert; und so könnte das Programm nicht mehr nur von den Volks- und Raiffeisenbanken in Stadt und Landkreis angeboten, sondern in ganz Bayern aufgelegt werden.
6. November 2006
Rosenheim (pil) – Eine Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt schwebt dem Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim bereits seit längerem vor; wegen des Umzugs in den Künstlerhof verschwand ein entsprechendes Konzept aus dem Jahr 2003 allerdings wieder in der Schublade. Bis Ende 2007, hofft Vorstandsfrau Maria Noichl, soll dort nun diese Anlaufstelle geschaffen werden, die auch bei der Jahreshauptversammlung breiten Raum einnahm. Gespräche mit dem „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt“ seien bereits im Gange, erläuterte Geschäftsführerin Astrid Rethmann.
Der Rosenheimer Entwurf indes wurde in der Zwischenzeit in Fürstenfeldbruck aufgegriffen, wo vor einem Jahr die „Interventionsstelle für Opfer häuslicher Gewalt“ ihre Arbeit aufgenommen hat. Entsprechend groß war das Interesse am Bericht von Diplom-Sozialpädagogin Nadine Schmidt, der Leiterin der Einrichtung; zu den Zuhörern im Mail-Keller zählte unter anderem Gertraud Goßmann, die Beauftragte für Frauen und Kinder im Polizeipräsidium Oberbayern.
Schmidt will einen „Anker setzen“ für misshandelte Frauen, die nach der polizeilichen Wegweisung des Täters aus der gemeinsamen Wohnung oftmals nicht wüssten, wie es weiter geht. Zusätzlich zur unmittelbaren Betreuung informieren die Mitarbeiterinnen über Möglichkeiten zum Schutz vor weiteren Übergriffen, geben Rückenstärkung bei Gerichtsterminen und vermitteln die Opfer bei Bedarf an andere Beratungs- und Therapie-Einrichtungen weiter. Durch den „pro-aktiven Ansatz“ - Mitarbeiter der Einrichtung gehen auf die Frau zu – würden viele Betroffene erreicht, die von sich aus keine Hilfe gesucht hätten.
So übermittelte die Polizei innerhalb eines Jahres die Daten von insgesamt 58 Opfern mit deren Einverständnis an die Interventionsstelle: In 83 Prozent der Fälle folgte ein Beratungsgespräch; zwei der Betroffenen lehnten eine Unterstützung durch die Kontaktstelle ab; der Rest war für Schmidt oder ihre ehrenamtlichen Helferinnen nicht erreichbar.
Die gute Zusammenarbeit mit der Polizei führt Schmidt nicht zuletzt auf die regelmäßigen Gespräche und Schulungen in den einzelnen Inspektionen zurück. Konnten die Beamten früher meist nur den Sachverhalt protokollieren und beim nächsten Übergriff erneut ausrücken, will die Interventionsstelle möglichst zeitnah reagieren und den Opfern – in den allermeisten Fällen Frauen – Auswege aufzeigen.
Dank verschiedener Sponsoren ist der Betrieb im Brucker Stadtteilzentrum West zunächst für zwei Jahre gesichert. Ohnehin hinke Bayern auf diesem Gebiet weit hinterher, kritisierte Schmidt und verwies auf das Land Niedersachsen; dort habe sich Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen bereits während ihrer Zeit als Landespolitikerin für Interventionsstellen stark gemacht.
Eine Anschubfinanzierung aus Spendengeldern – ähnlich der in Fürstenfeldbruck - werde wohl auch in Rosenheim vonnöten sein, glaubt Noichl; gleichzeitig hofft sie aber, dass die öffentliche Hand ihren Beitrag zur Interventionsstelle leisten wird.
 |
| Keine personellen Veränderungen brachte die Neuwahl der Vorstandsfrauen mit sich: Brigitte Kutka, Helene Gurgießer und Maria Noichl (von links) wurden von den Aktiven per Handzeichen für zwei weitere Jahre gewählt. Foto: pil |
Einen deutlichen Zulauf verzeichnet unterdessen die Fachstelle Prävention des Frauen und Mädchennotrufes, welcher, wie Noichl betonte, als einzige Einrichtung in Stadt und Landkreis auch den direkten Kontakt mit Kindern suche. So nahmen im vergangenen Jahr – abgesehen von den Fortbildungen für Lehrer und Erzieher – insgesamt 1728 Mädchen und Buben (1224 im Jahr 2004) an den Veranstaltungen zur Vorbeugung sexuellen Missbrauchs teil. Mit 120 Kindern war das Programm im Jahr 1996 angelaufen; bereits im folgenden Jahr war die Zahl auf 984 angestiegen. Bislang stelle der Notruf lediglich die Hälfte der anfallenden Kosten von 300 Euro pro Klasse in Rechnung, der Rest werde aus der Vereinskasse beglichen. Denn Aufklärungsarbeit, so Noichl, dürfe nicht am Geld scheitern.
Wie allerdings aus Brigitte Kutkas Kassenbericht hervorging, ist der Verein derzeit finanziell nicht auf Rosen gebettet. Zwar sei das „erschreckende“ Minus von mehr als 40.000 Euro aus dem vergangenen Jahr durch den Umzug zustande gekommen; und das Defizit für 2006, das nach derzeitiger Hochrechnung rund 14.000 Euro betragen wird, „werden wir noch wegbekommen“, zeigte sich Maria Noichl zuversichtlich. Doch insgesamt sei die Haushaltslage schwierig.
Zum einen würden immer weniger Bußgelder ausgeschüttet. Zum anderen würden laufend öffentliche Fördergelder gekürzt. Besonders schmerzhaft sei der Einschnitt beim allgemeinen Zuschuss des Landkreises ausgefallen. Während er sich im Jahr 2002 auf noch 12.800 Euro belief, waren es 2004 lediglich 8000 Euro, und fürs vergangene Jahr wurden nurmehr 4000 Euro bewilligt. Eine Entscheidung, die Noichl nicht recht nachvollziehen kann. Schließlich leiste der Notruf allein zwei Drittel seiner Präventionsarbeit – „eigentlich eine kommunale Pflichtaufgabe“ - im Landkreis.
Um auch künftig Beratung, Vorbeugung und Selbsthilfe im bisherigen Umfang anbieten zu können und um die Internetberatung auszubauen, wird sich der Notruf neben der Spendenakquise nun verstärkt in die Mitgliederwerbung stürzen. Weitere Informationen, auch über die Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Tätigkeit, sind in der Geschäftsstelle (Telefon 08031/9016944) erhältlich.
6. November 2006
von Marisa Pilger
Rosenheim – „Schulsozialarbeit – Luxus oder Notwendigkeit?“ Die Frage, die als Titel fürs erste Rosenheimer Symposium zur Schulsozialarbeit diente, war eher rhetorischer Art. Weniger eindeutig fällt unterdessen die Antwort in Sachen Finanzierung aus. Zwar hat das Bayerische Sozialministerium mit JaS („Jugendsozialarbeit an Schulen“) einen Zehn-Jahres-Plan aufgelegt, der bis zum Jahr 2013 insgesamt 350 Planstellen an 500 Schulen anpeilt; doch ist dieser in jüngster Zeit „ins Stocken geraten“, wie Sozialministerin Christa Stewens bei der Podiumsdiskussion im Kultur- und Kongresszentrum einräumte. Und so ist manche Kommune auf diesem Terrain inzwischen selbst aktiv geworden.
In Rosenheim betreibt bereits seit 1998 der Verein „Pro Arbeit“ Schulsozialarbeit: Elf Sozialpädagogen kümmern sich derzeit an zehn Grund-, Haupt- und Berufsschulen in der Stadt und im Landkreis um Kinder und Jugendliche. Eineinhalb Stellen im Stadtgebiet laufen dabei über das JaS-Programm, das heißt, der Freistaat trägt 40 Prozent der pauschalierten Personalkosten. Für den Rest kommen die Kommunen, der Trägerverein, der ESF (Europäische Sozialfonds) und Sponsoren auf. Gewaltigen Rückenwind hat „Pro Arbeit“ vor allem im vergangenen Jahr erfahren, als die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling mit einem bayernweit einzigartigen Sponsoring-Vertrag in das Thema einstieg und so auf fünf Jahre drei zusätzliche Vollzeitstellen für Sozialpädagogen in Rosenheim sichert. Allerdings machte Alfons Maierthaler, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, keinen Hehl daraus, dass dies lediglich als eine „Anschubfinanzierung“ zu verstehen sei, als ein Signal für die Entscheidungsträger.
 |
| Eine Doppelstunde zum Thema Schulsozialarbeit, moderiert von Fernsehjournalist Peter Fraas: Zu den Diskussionsteilnehmern beim Symposium „Schulsozialarbeit – Luxus oder Notwendigkeit?“, dem ersten seiner Art in Rosenheim, zählten neben Schulleiterin Hermine Deindl, dem Diplom-Sozialpädagogen Klaus Schöberl, Stefan Fischer vom Stadtjugendamt München, Dr. Werner Schrom, Referatsleiter im Kultusministerium, und Staatsministerin Christa Stewens (Foto von links) auch Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, stellvertretender Landrat Lorenz Kollmannsberger, Alfons Maierthaler, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, sowie die „Pro Arbeit“-Vorsitzende Inge Ilgenfritz. Foto: pil |
Ministerin Stewens allerdings ist ganz anderer Meinung: Die CSU-Politikerin versteht die Schulsozialarbeit oder vielmehr die Jugendsozialarbeit an Schulen vorrangig als eine „originäre Aufgabe der Jugendhilfe“. Doch mit sieben neuen Stellen noch in diesem Jahr und weiteren 32 im kommenden will sie das JaS-Programm, für das derzeit jährlich 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen, wieder ankurbeln und hofft, den Etat bis zum Jahr 2008 auf 2,5 Millionen Euro aufstocken zu können. Allerdings werde es „nicht an jeder Schule einen Schulsozialarbeiter geben“, warnte die Landespolitikerin, selbst sechsfache Mutter, vor übertriebenen Erwartungen.
Warum diese Einrichtung nicht nur für Brennpunktschulen ein wahren "Juwel" darstellt, listete Rektorin Hermine Deindl mit aller Deutlichkeit auf: Insgesamt 24 Nationalitäten sind in der Volksschule Fürstätt vereinigt, eine der beiden Rosenheimer Schulen, an denen die Sozialarbeit startete. Nicht nur dort weisen viele Kinder und Jugendliche soziale Defizite auf, zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Vor allem fehlt oft jeglicher familiärer Rückhalt. Hinzu kommen die enorm gestiegenen Anforderungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt: Frustration und Hoffnungslosigkeit machen sich breit, das Konfliktpotential steigt. Mit Sozialtrainings, Streitschlichterausbildungen und Unterstützung bei der Lehrstellensuche stehen deshalb Sozialpädagogen den Heranwachsenden zur Seite, wollen ihnen Sozialkompetenz und Selbstwertgefühl vermitteln. Wie auch seine Kollegen lotet Diplom-Sozialpädagoge Klaus Schöberl von der Hauptschule Mitte Stimmungen aus, führt Gespräche, baut Vertrauen auf, hält Kontakt zu Lehrern und zum für Laien schier unüberschaubaren Netzwerk an Beratungs- und Förderstellen. Und er fungiert als eine Art „soziales Frühwarnsystem“, wie es Stefan Fischer vom Stadtjugendamt München formulierte.
Doch längst gehören nicht mehr nur die Hauptschulen zum Klientel der Schulsozialarbeiter. Auch Gymnasien haben beim Rosenheimer Schuldezernenten Michael Keneder Interesse angemeldet. Umso eindringlicher warnt er deswegen davor, den fachlichen Bedarf mit Blick auf die vorhandenen Geldmittel zu erheben. Auch das JaS-Programm in seiner jetzigen Form sieht er nicht unkritisch, da es lediglich bei neugeschaffenen Stellen greife. Von einem Bonus-System könnten dagegen auch diejenigen Kommunen profitieren, die sich bereits selbst auf diesem Sektor engagieren.
Wie dieser Einsatz aussehen kann, hat Lorenz Kollmannsberger schon während seiner Zeit als Bürgermeister von Prien vorgemacht: Er wollte die „Nische zwischen Schule und Staatsanwaltschaft nutzen“, den „Schwächeren eine Perspektive geben“, und stellte kurzerhand einen Schulsozialarbeiter ein. Seine Forderung ans Finanzministerium: „Im Interesse der jungen Leute Prioritäten setzen!“
Die beste Förderung jedoch, war man sich nicht nur auf dem Podium einig, müsse bereits in der Grundschule ansetzen. Mehr Lehrer an dieser Stelle erfordere in der Folge weniger sozialpädagogische Betreuung an den Hauptschulen, konstatierte Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer an die Adresse von Dr. Werner Schrom vom Kultusministerium. Planstellen würden ohnehin nur dort zurückgenommen, wo sie nicht mehr gebraucht würden, erläuterte dieser.
Die bevorstehende Umgestaltung der Hauptschule veranlasste unterdessen Hermine Deindl noch zu einigen grundsätzlichen Einlassungen: Ihrer Ansicht nach sei hier ein grundlegender Umbruch notwendig; schließlich sei die Hauptschule „keine abgespeckte Realschule“. „Unsere Schüler brauchen andere Formen des Lernens!“, nämlich solche, bei denen sich den Jugendlichen der praktische Nutzen schnell erschließe. Und dass der viel zitierte Vergleich mit PISA-Spitzenreiter Finnland hinke, habe sich spätestens beim Besuch der Fürstätter Partnerschule in Finnland gezeigt: 15 Kinder würden dort von zwei Lehrkräften und einem Assistenten betreut. Umso mehr ist Deindl in der jetzigen Situation angewiesen auf den „Luxusartikel“ Schulsozialarbeit.
23. Oktober 2006
Rosenheim (pil) – Die Familientauglichkeit des Ballermann haben bereits Pete Paparazzo und Mike Mission - die kleinen Maulwürfe aus den Überraschungseiern - unter Beweis gestellt. Für Annette Engelhardt aus Großkarolinenfeld, Inhaberin der Ballermann-Markenrechte, schien der Markt also reif zu sein für ein eigens auf Kinder zugeschnittenes Label. Seit kurzem sind deshalb die „Ballermann-Kidz“ im Rennen, die wiederum für den Verein Fortschritt Rosenheim eine ganz besondere Rolle spielen werden: Ein Jahr lang fließen 20 Prozent aller Lizenzeinnahmen aus der Verwertung des neuen Markenzeichens als Spende an den Verein, der im Stadtteil Oberwöhr mit dem Kindergarten „Sonnenschein“ ein Konduktives Förderzentrum für überwiegend spastisch gelähmte Kinder etabliert hat. Am 20. Oktober, wenn unter dem Titel „Hey, das geht ab!“ die erste CD aus der neuen Reihe in die Läden kommt, fällt der offizielle Startschuss der Aktion.
 |
| Gelungene Überraschung an der Rohrdorfer Schule: Annette Engelhardt, Inhaberin der Ballermann-Markenrechte, versüßte den gemeinsamen Heimat- und Sachkundeunterricht von Petö-Kindern und Kooperationsklasse mit einem Korb voller Überraschungseier. Ein Jahr lang fließt ein Fünftel der Lizenzeinnahmen aus Engelhardts neuem Markenzeichen „Ballermann Kidz“ als Spende an den Verein Fortschritt. Foto: pil |
Für Annette Engelhardt, die darüber hinaus seit mehr als 30 Jahren im Behindertenbereich tätig ist, ist es ganz selbstverständlich, von den Einnahmen „etwas abzugeben“. „Und wenn schon ein Kinderprojekt, dann soll es auch Kindern zugute kommen.“
Wie hoch die Summe ausfallen wird, mit der der Verein Fortschritt und damit die zum Teil mehrfach schwerstbehinderten Kinder von den „Ballermann-Kidz“ profitieren, hängt nun von den nächsten zwölf Monaten ab. Doch bereits jetzt ist Siegfried Weisbach begeistert vom Engagement seiner Nachbarn, der Engelhardts: „Das ist sensationell.“ Denn so mancher Sonderwunsch wie etwa ein spezieller Sprachcomputer ließe sich nur durch Spenden erfüllen.
Gemeinsam mit seiner Frau hat Weisbach vor wenigen Jahren das Konduktive Förderzentrum in Rosenheim-Oberwöhr ins Rollen gebracht, wo spastisch gelähmte Kinder nach der Methode des ungarischen Arztes und Pädagogen Professor András Petö therapiert werden. Insgesamt 30 Mädchen und Buben besuchen nach Angaben der Vereinsvorsitzenden Doris Weisbach derzeit den Kindergarten „Sonnenschein“, 15 davon in einer Mutter-Kind-Gruppe zur Frühförderung.
Im vergangenen Herbst wurde darüber hinaus im Rahmen eines bundesweit einmaligen Pilotprojekts an der Rohrdorfer Schule für die Petö-Kinder eine Außenklasse des Förderzentrums Aschau eingerichtet, die wissenschaftlich begleitet wird und zunächst auf vier Jahre befristet ist. Gemeinsam mit einer Sonderschullehrerin betreuen hier zwei Konduktorinnen und ein Zivildienstleistender die mittlerweile neun Mädchen und Buben; nach Schulschluss steht bis 15.45 Uhr zudem eine Tagesstätte zur Verfügung. Hemmschwellen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten verschwinden dank des gemeinsamen Unterrichts mit der Kooperationsklasse der Regelschule beinahe von allein, und die Petö-Kinder werden schrittweise und soweit wie möglich in den normalen Schulbetrieb integriert. Julia zum Beispiel stehe die Begeisterung täglich ins Gesicht geschrieben, freut sich ihre Mutter Doris Weisbach.
Möglicherweise, so hofft sie ebenso wie Sonderschulrektor Josef Eberl, werde dieses Modell bald auch von anderen Schulen im Bundesgebiet aufgegriffen.
16. Oktober 2006
Rosenheim (pil) – Der tabellarische Lebenslauf kann durchaus länger sein als eine Seite; das Foto darf auf keinen Fall aus dem Automaten stammen; und fürs Anschreiben wird dem Verfasser eine Schriftart mit Serifen empfohlen. Diese und noch viele weitere Tipps rund ums Thema Bewerbung hatten die Auszubildenden der Rosenheimer Volksbanken und Raiffeisenbanken zusammengetragen. Dabei bildet die Station „Bewerben, aber wie?“ nur eine von insgesamt sechs Anlaufstellen bei der Informationsveranstaltung „Job in Sicht“, die noch bis zum 20. Oktober in der Hammerhalle im Citydome angelaufen ist.
Mit dem Projekt, das seit dem Startschuss im Jahr 2004 mehr als 2500 Jugendliche durchlaufen haben, wollen die Veranstalter die Schülerinnen und Schüler frühzeitig fürs Thema Jobsuche sensibilisieren, Hilfestellung für den Start ins Berufsleben geben und Perspektiven für die Zeit nach der Schule aufzeigen, erklärt Wolfgang Tschuschner, Ausbildungsleiter bei der Raiffeisenbank Rosenheim.
So bedeutet „Job in Sicht“ nicht nur für die beiden neunten Klassen der Rosenheimer Johann-Rieder-Realschule, für die das erste Startsignal ertönte, den Einstieg in den fächerübergreifenden Themenkomplex Bewerbung. Schließlich läuft die Bewerbungsphase für die Realschüler bereits mit dem Zwischenzeugnis der neunten Klasse an. „Wer erst in der 10. Klasse anfängt, ist zu spät dran.“, warnt Lehrer Anton Griesbeck. Das Interesse der knapp 80 Jugendlichen, die mit einer Stempelkarte ausgestattet von Station zu Station wanderten, sich Einstellungstests unterzogen, in Teamarbeit übten und Informationen über berufsberatende Einrichtungen sammelten, spiegelte sich dabei im Geräuschpegel in der Hammerhalle wider: Der lag erstaunlich niedrig.
 |
| Zwei Wochen lang bieten die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Stadt und Landkreis Rosenheim für Jugendliche aller Schultypen im Citydome Informationen rund ums Thema Berufsstart. Den Auftakt bei „Job in Sicht“ machten in diesem Jahr Neuntklässler der Johann-Rieder-Realschule aus Rosenheim. Foto: pil |
Für Brunhilde Tögel, Ausbildungsleiterin bei der Volksbank-Raiffeisenbank Rosenheim-Mangfalltal, stellt beispielsweise eine fehlerhafte Adresse im Anschreiben – ebenso wie Rechtschreibfehler - ein absolutes k.o.-Kriterium dar. Ungefähr 110 Bewerbungen landen jedes Jahr auf ihrem Schreibtisch, rund ein Drittel kommt in die nächste Runde, in der sich das Unternehmen anhand eines umfangreichen Fragebogens ein genaueres Bild von den Anwärtern verschafft; einen Ausbildungsvertrag erhält schließlich etwa ein Dutzend der Kandidaten.
Bei Wolfgang Tschuschner hingegen wird grundsätzlich jeder Bewerber – egal ob M-Zügler oder Studienabbrecher - eingeladen. In Gesprächen und Rollenspielen werden dann Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Konfliktverhalten und Sprachgebrauch unter die Lupe genommen. Und welchen Eindruck schlechte Manieren und mangelnde Umgangsformen nicht nur bei einem Vorstellungstermin hinterlassen, veranschaulicht bei „Job in Sicht“ ein Kurzfilm.
Vom Konzept der Veranstaltung, bei der Banklehrlinge die Rolle der Moderatoren übernehmen, zeigte sich unter anderem der Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner bei seinem Rundgang angetan. Auch Michael Herzig, Schulrat beim Staatlichen Schulamt, unterstrich den Wert des Projekts als Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen die Situation auf dem Ausbildungsmarkt und dessen Anforderungen vor Augen zu führen. Zugleich warnte er aber davor, Probleme und Defizite der Schulabgänger zu sehr in den Vordergrund zu stellen und die positiven Seiten zu wenig zu würdigen. Als vormaligem Leiter der Volksschule Obing liegen Herzig vor allem die Hauptschüler am Herzen. Diese, kritisiert er, würden oftmals völlig zu Unrecht als der „Rest“ bezeichnet, der den in der vierten Klasse alles beherrschenden Übertritt an eine weiterführende Schule nicht geschafft hat. Jedes Kind, appelliert er an alle Eltern, sollte diejenige Schule besuchen, in der es am besten aufgehoben ist – also auch nicht überfordert ist. Denn, ist Herzig überzeugt, „es ist besser, ein guter Hauptschüler zu sein als ein schlechter Realschüler“ und fordert deshalb eine „Wertschätzung für jeden Beruf“.
11. Oktober 2006
Neubeuern (pil) – Der kleine Springbrunnen, der neuerdings vor ihrem Fenster plätschert, gefällt der alten Dame aus dem Erdgeschoß ganz besonders. Auch die Himbeeren und Monatserdbeeren erfreuen sich bereits großer Beliebtheit bei den Bewohnern vom Pflegeheim „Haus Gisela“ in Neubeuern. Denn wer sich in dem frisch angelegten Sinnesgarten auf einen Spaziergang begibt, darf ganz nach Belieben schnuppern, tasten, anfassen und auch schmecken. Mit einem Teich, bunten Windrädern und Klangspielen ausgestattet, soll die Anlage möglichst alle Wahrnehmungskanäle ansprechen. Sitzecken wie unter der Pergola und den Trompetenbäumen bieten darüber hinaus Möglichkeiten zum Rückzug ebenso wie zur Begegnung.
 |
| Noch taufrisch: Der neu angelegte Sinnesgarten im Pflegeheim „Haus Gisela“ in Neubeuern erstreckt sich um mehrere Ecken auf rund 450 Quadratmeter. Im Teich ziehen bereits Goldfische unbeirrt ihre Runden. Foto: Pilger |
Einen wichtigen Beitrag, erklären beide, leiste dabei die Auswahl der Pflanzen, die sie gemeinsam mit dem Oberaudorfer Landschaftsgärtner Ulrich Gradl vorgenommen haben. Mit Bauernhortensien, Frauenmantel und Phlox können sich die Hausbewohner nunmehr an Gewächsen erfreuen, die sie früher auch im eigenen Garten hatten. Am Spalierobst, das schon im kommenden Jahr Früchte tragen soll, wird die Abfolge der Jahreszeiten zusätzlich greifbar; und für eine eindrucksvolle Blütenpracht im Frühjahr sorgt unter anderem eine Zierkirsche. Den Geruchssinn spricht Hopf, die sich nicht zuletzt wegen ihrer beiden behinderten Brüder mit ganzheitlich ausgerichteten Gartenanlagen befasst, darüber hinaus gezielt mit stark duftenden Silberkerzen an.
Auch wollen Corinna Weber und ihr Mann Peter mit dem rollstuhlgeeigneten Sinnesgarten dem ungeheuren Bewegungsdrang dementiell Erkrankter Rechnung tragen, die oftmals stundenlang auf- und abwanderten. Der Bodenbelag aus einheitlich grauen Steinplatten sorge dafür, dass bei den Patienten möglichst wenig Unsicherheit aufkommt. Zur Überraschung der Heimleiterin zeigten die Bewohner jedoch auch bei den mit Mulch beziehungsweise Kies ausgelegten Wegabschnitten kaum Berührungsängste. Dem für Demenzkranke charakteristischen Weglauftrieb setzt ein 1,80 Meter hoher Holzzaun Grenzen, der durch seine versetzt angeordneten Latten auch immer wieder einen Blick nach draußen ermöglicht. Und damit sich niemand eingesperrt fühlen muss, ranken sich Klematis und Kletterrosen an den Wänden empor.
Im Rahmen der Beschäftigungstherapie werden die Heimbewohner nun die Betonränder der Hochbeete eigenhändig mit Mosaiken aus winterharten Fliesenresten verzieren. Entsprechende Materialspenden nimmt die Heimleitung gerne entgegen (Telefon 08035/984959).
Unterstützt wird die 30.000 Euro teure Gartenanlage vom „Förderverein Haus Gisela“, der rund 2500 Euro beisteuert. „Eine tolle Idee!“, lobt Vorsitzende Uschi Brakels die neue Einrichtung. Der mehr als 100 Mitglieder zählende Verein sponsert zudem den jährlichen Wiesn-Ausflug der Heimbewohner und organisiert Ausflüge sowie diverse Veranstaltungen.
Wenngleich sie selbst noch keine Erfahrung mit derartigen Anlagen in Pflegeheimen gemacht habe, befürwortet auch Edda Gorzel, die Seniorenbeauftragte des Landkreises, das Vorhaben grundsätzlich („Das ist bestimmt eine gute Sache.“) und verweist auf öffentlich zugängliche Sinnesgärten wie etwa in Nürnberg. Bereits als Leiterin der Altenpflegeschule Altenhohenau habe sie immer wieder die Bedeutung des Anreizes der Sinne Pflegebedürftiger ins Blickfeld ihrer Schüler gerückt. Jetzt bleibe abzuwarten, wie der neue Garten von den Heimbewohnern in Neubeuern angenommen werde.
19. September 2006
 |
| Hier im Haus „Bergweg 2“ im Kiefersfeldener Ortsteil Mühlbach wurde die Mutter von Papst Benedikt XVI. Geboren. Bald soll eine kleine Gedenktafel die Vorübergehenden darüber informieren. Foto: Pilger |
von Marisa Pilger
Kiefersfelden – Viele Wanderer mögen das schmucke Haus mit den Blumenkästen am Balkon und dem alten Steinbrunnen im liebevoll bepflanzten Garten auf ihrem Weg nach Gfall, Mühlau oder auf den Brünnstein schon bewundert haben. Doch für so manchen Urlauber bedeutet das alte Gebäude am Bergweg im Kiefersfeldener Ortsteil Mühlbach (Pfarrei Oberaudorf), in dem am 8. Januar 1884 Maria Paintner, verheiratete Ratzinger, zur Welt kam, bereits das eigentliche Ziel des Ausflugs. „Im letzten Sommer hat sich hier einiges gerührt.“, erinnert sich Burgi Gabenstätter. Sie arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Chronik über das Anwesen mit der Hausnummer 2, in dem die Wiege der späteren Papst-Mutter stand.
Bis ins Jahr 1750 ist sie bei ihren Recherchen bereits zurückgestoßen. „Ich glaube aber, dass das Haus noch um einiges älter ist.“, erklärt sie und breitet behutsam eine große Papierrolle auf dem Tisch in der Wohnküche aus. Auf dem weißen Bogen hat sie fein säuberlich mit Bleistift den Stammbaum der Gabenstätters - der Vorfahren ihres Mannes Toni - zusammengeschrieben, die das Haus seit 1862 bewohnen.
Erst vor ein paar Wochen hat sie die Notizen, mit denen sie bereits vor einigen Jahren begonnen hatte, wieder aus der Schublade hervorgeholt und weitergeführt. Allerdings weniger, weil der Besuch von Papst Benedikt XVI. im Freistaat bevorstand, sondern vielmehr, weil sonst noch „alle Zeitzeugen wegsterben“, die aus erster Hand über das Leben in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und über Erzählungen von Eltern und Großeltern berichten könnten. Neben Sterbebildern dienten ihr unter anderem die Aufzeichnungen des Neubeurer Chronisten Bernrieder als ergiebige Quelle.
Als Zuhäusl zum Neuner-Anwesen war das Haus Mühlbach Nr. 195 in einer Zeit gebaut worden, als es noch lange keine Straßennamen gab. Beim „Sagschneider“ hieß das Leerhäusl (ein „Gütl ohne Grund und Boden“) noch 1822. Dies sollte sich 40 Jahre später ändern, als Mathias Gabenstätter (1813 bis 1883) das Haus erwarb. Wo heute die Wohnstube untergebracht ist, übte der Schuhmachermeister von Rosenheim (einst Geselle beim Grabenschuster in Oberaudorf und Ururgroßvater des heutigen Hausherrn Toni) fortan sein Handwerk aus; und aus dem „Sagschneider“ wurde „Beim Schuaster“.
 |
| Vor gut einhundert Jahren entstand diese Aufnahme. Zu sehen sind darauf der Urgroßvater des jetzigen Hausherrn mit seiner Familie. Im Vordergrund verläuft der heutige Bergweg. Repro: Pilger |
Wie lange Maria Paintner (senior) mit ihrer kleinen Tochter in Mühlbach blieb, sei allerdings unklar. Das ist ein Punkt, der Burgi Gabenstätter keine Ruhe lässt. In der Literatur bilde erst der Umzug nach der Heirat mit dem Bäcker Isidor Rieger nach Rimsting im Jahre 1890 die nächste greifbare Station, wundert sich die Ahnenforscherin aus Leidenschaft und streicht nachdenklich über das knisternde Papier. „Da will ich auf jeden Fall weiterforschen.“ Auch in der eigenen Familie gibt es noch allerhand zu erkunden, wie die diversen Anmerkungen und Fragezeichen auf der Ahnentafel zeigen. „Ich will einfach wissen, wie's früher war.“, erklärt die 42jährige, die seit jeher ein Faible hat für die Vergangenheit, für alte Dinge und das Leben, wie es die Altvordern geführt haben. „Eigentlich hätte ich 200 Jahre früher leben sollen.“, schmunzelt sie.
Für Verwirrung über den tatsächlichen Geburtsort der Papst-Mutter hatten zwischenzeitlich einige zufällige Parallelen gesorgt: Auch die Mutter der kleinen Maria, die Dienstmagd Maria Paintner, war seinerzeit als uneheliches Kind zur Welt gekommen, und zwar in Mühlbach im Pustertal, führt etwa Johann Nußbaum in seinem Büchlein „Poetisch und herzensgut“ aus der Reihe Rimstinger Lebenserinnerungen aus. Eine Geburtsurkunde im Kiefersfeldener Rathaus belege jedoch, dass ihre Tochter, die spätere Papst-Mutter, nicht in Tirol sondern in Kiefersfelden geboren wurde, erklärt der hiesige Standesbeamte. In Kiefersfelden sei diese Tatsache schon lange allgemein bekannt und schlage bislang keine großen Wellen.
Der Zufall war es auch, der Pate stand beim ersten Aufeinandertreffen der Feuerwehren aus den beiden Mühlbachs in Oberbayern und Südtirol: An der Gründung der bayerischen Wehr im Jahre 1906 war Tonis Urgroßvater Hubert (1870 bis 1950, Erster Kommandant von 1906 bis 1936), Sohn des Mathias Gabenstätter, beteiligt gewesen. Vor einigen Jahren nun rückten die Inntaler zu einem Ausflug ins Museum nach München aus. Zur selben Zeit wurde dort allerdings einer anderen Feuerwehr-Gruppe der Zutritt zunächst verwehrt: „Die Feuerwehr Mühlbach ist doch schon drin.“, hieß es am Einlass.... - Selbstredend gab es ein großes Hallo mit den Südtirolern. Der Grundstein für eine Freundschaft war gelegt, und so fehlte bei den Feierlichkeiten anlässlich des 100jährigen Bestehens der FFW Mühlbach (Kiefersfelden), der auch Toni Gabenstätter angehört, eine Abordnung der Südtiroler nicht. Bezeichnenderweise fungierte eben jener Hubert Gabenstätter nicht nur jahrzehntelang als Zweiter Bürgermeister sondern auch als Waisenrat, fügt Burgi an. Noch zwei Huberts folgten in den nächsten Generationen „Beim Schuaster“, was nicht selten für Verwirrung sorgt; insbesondere wenn Burgi gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Josefa, die ebenfalls im Haus wohnt, den Stammbaum durchgeht. Denn reden beide vom „Großvater“, meint die Jüngere den ihres Mannes Toni, während die Ältere den ihres verstorbenen Mannes Hubert im Sinn hat.
Ein dritter Hubert im Haus wäre seinerzeit allerdings auch Josefa zu viel gewesen, als sie mit ihren Schwiegereltern unter einem Dach lebte. Sie bestand deshalb darauf, ihren Sohn auf den Namen Toni – nach seinem in Russland gefallenen Onkel - taufen zu lassen. Der Papstbesuch steht - abgesehen von der Geschichte des Hauses - für die gebürtige Dortmunderin unter einem ganz besonderen Vorzeichen: Nach einer Begegnung mit Kardinal Ratzinger in Rom im Jahr 1993 nimmt Josefa Gabenstätter als Begleiterin eines Kommunion-Kindes aus der Gemeinde an der Vesper im Münchner Liebfrauendom teil.
Burgi Gabenstätter trägt derweil tief in sich die Hoffnung, dass Papst Benedikt XVI. eines Tages nach Mühlbach kommt, um dem Geburtshaus seiner Mutter einen Besuch abzustatten – und den Gabenstätters, deren Vorfahren mehr oder weniger zufällig das Schicksal der Maria Paintner ganz erheblich mitbestimmt haben.
14. September 2006
 |
| Auf den ersten Blick eine reine Frauensache. Neben Kathrin Braun, Stefania Krämer, Marianne Consten, Eveline Scheidt, Uschi Brakels, Maria Heinrich, Gertrud Kuhn, Renate Trautvetter und Angelina Sitzberger (von links) sind bei der „Natürlichen Nachbarschaftshilfe“ noch weitere Damen, aber auch einige Männer aktiv. Foto: pil |
Neubeuern (pil) – Eine Art Feuerwehr in Sachen nachbarschaftlicher Hilfe hat sich bereits vor längerem in Neubeuern zusammengeschlossen. Unter der Bezeichnung „Natürliche Nachbarschaftshilfe“ übernimmt dort ein Kreis von etwa 15 Gleichgesinnten kostenlos kurzfristige Fahrdienste zum Arzt, besorgt Einkäufe oder führt auch mal eine kleinere Reparatur aus.
Des öfteren war Uschi Brakels, die gemeinsam mit ihrem Mann das Schreibwarengeschäft am Marktplatz betreibt, in der Vergangenheit vor allem von älteren Kunden gebeten worden, dieses oder jenes aus dem Dorf mitzubringen. Daraus wurde damals die Idee geboren, in der Gemeinde ein Auffangnetz für Notfälle zu spinnen. Einem entsprechenden Aufruf im Gemeindeblatt folgten im vergangenen Sommer etwa ein Dutzend Neubeurer, die sich bereit erklärten, unentgeltlich anzupacken, „wenn's brennt“.
Auf die Gründung eines Vereins haben die Helfer ganz bewusst verzichtet. „Alles soll freiwillig bleiben.“, betont Brakels. Und ob sich ein „Notfall-Einsatz“ zur dauerhaften Hilfestellung entwickle, bleibe jedem selbst überlassen. Auf keinen Fall aber wolle die Gruppe in Konkurrenz zu den Dorfhelfern treten.
Vielmehr versteht sich die „Natürliche Nachbarschaftshilfe“ mit ihrem Beitrag zur Dorfgemeinschaft als Ersthelfer; um eine dauerhafte Lösung müssen sich die Betroffenen jeweils selbst bemühen.
Weitere Auskünfte gibt’s bei Uschi Brakels, Telefon 08035/6583.
24. Juli 2006
Rosenheim (pil) – Die anhaltend angespannte Situation auf dem Lehrstellenmarkt ist auch für die Berufsschulen nicht ohne Folgen geblieben. Angesichts der wachsenden Zahl von Schulabgängern, die zwar keinen Ausbildungsplatz haben aber noch schulpflichtig sind, haben sich bereits im vergangenen Schuljahr die Berufsschulen I, II und Bad Aibling zusammengetan, um den Betroffenen in JoA-Klassen (Jugendliche ohne Ausbildungsplatz) interessensorientierten Unterricht anzubieten. Während einer Orientierungswoche zu Beginn des neuen Schuljahres können sich die Jugendlichen künftig einen Überblick über die einzelnen Ausbildungsmodule verschaffen, bevor sie sich für eine der Sparten – sei es Bau, Holz, Metall, Kfz, Handel, Farbe, Büro oder Gastronomie – und damit für eine der vier Schulen im Landkreis entscheiden; ab Herbst werde das modulare Konzept auch an der Staatlichen Berufsschule Wasserburg umgesetzt, kündigte Studienrat und JoA-Multiplikator Jürgen Ersing am Rande einer Sozialtrainings-Abschlussveranstaltung in Rosenheim an.
Neben Blockunterricht anstelle von Einzeltagesunterricht setzt das Programm zusätzlich auf Deutschkurse für Ausländer ebenso wie auf sozialpädagogische Trainingseinheiten und die Unterstützung durch einen Lehrstellenentwickler, zum Großteil finanziert durch Lokales Örtliches Sozialkapital der Stadt Rosenheim (LOS). Teilzertifizierte Blöcke sollen den Jugendlichen darüber hinaus die Möglichkeit geben, sich für einfache Tätigkeiten bewerben zu können.
Immerhin bekämen einer offiziellen Statistik des Kultusministeriums zufolge fast 20.000 Jugendliche im Freistaat keinen Ausbildungsplatz; für den Landkreis Rosenheim beziffert Ersing die Gesamtzahl der betroffenen Schulpflichtigen im laufenden Schuljahr (inklusive der Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen) auf rund 600 von insgesamt 1500 vorwiegend Haupt- und Förderschulabsolventen. Ungeklärt sei Ersings Angaben zufolge allerdings noch die Finanzierung der Schulwegkosten; denn durch die Aufteilung der Sparten auf die einzelnen Schulen würden auf einen Teil der Jugendlichen längere Anfahrten zukommen.
Bis vor einigen Jahren mussten sich alle Betroffenen des Landkreises Rosenheim an der Staatlichen Berufsschule Bad Aibling anmelden; die Anzahl bewegte sich dabei bis Ende der 90er Jahre zwischen 150 bis 200, wobei fast jeder der Jugendlichen einen Arbeitsplatz hatte (Jungarbeiterklassen). Seit dem Schuljahr 1997/98 allerdings wuchs die Zahl der JoA kontinuierlich auf etwa 300 an, wobei inzwischen rund die Hälfte ohne Arbeitsplatz war. Diese Entwicklung wurde mit der Gründung von zwei BVJ-Klassen (Vollzeit) mit den Schwerpunkten Metall und Hauswirtschaft abgefangen. Fürs Schuljahr 2003/04 verzeichnet Ersings Zusammenstellung eine Verschlimmerung der Situation: Die Zahl der Jugendlichen ohne Ausbildungsstelle lag deutlich über 350 und war für Bad Aibling alleine nicht mehr zu bewältigen. Deshalb bilden seither auch die anderen Berufsschulen des Landkreises JoA-Klassen. Darüber hinaus wurde in Bad Aibling die Berufsfachschule Metall (Vollzeitjahr) ins Leben gerufen, deren Besuch auf eine folgende Lehrzeit angerechnet werden kann.
Von dem modularen Konzept – es wurde entwickelt vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) - , das Ersing als von der Regierung von Oberbayern eingesetzter JoA-Mulitplikator an insgesamt 13 Berufsschulen im Süden Oberbayerns einführen will, erhofft sich der Aiblinger Studienrat nicht zuletzt eine „signifikante Verbesserung der Situation“ sowohl für die Jugendlichen als auch für die Lehrkräfte. Nicht zuletzt müsse auch die Schulsozialarbeit des Vereins „Pro Arbeit“ auf die Schulen Rosenheim II und Wasserburg ausgeweitet werden.
Weitere Informationen über die JoA-Klassen gibt's im Internet unter http://www.joa.bayern.de.
30. Juni 2006
Landkreis (pil) – Dem Waldorfkindergarten im Landkreis steht ein Umzug ins Haus: Mit dem Start des neuen Kindergartenjahres im September öffnet die Einrichtung, die bislang in Brannenburg angesiedelt ist, im Gebäude der Waldorfschule Rosenheim (Aisingerwies) ihre Pforten.
Vor zwei Jahren hatte eine Elterninitiative den eingruppigen Kindergarten ins Leben gerufen, da der Waldorfkindergarten Rosenheim (Schwaig) nur in begrenztem Umfang Zwergerl aus den Landkreisgemeinden aufnehmen kann. Angelika Horner-Gay, die Vorsitzende des „Verein für Waldorfpädagogik Inntal e.V.“ betont in diesem Zusammenhang, dass mit dem Rosenheimer Kindergarten „Das Samenkorn“ auch weiterhin eine enge Zusammenarbeit angestrebt werde, um eine Konkurrenzsituation zu vermeiden.
Fürs neue Jahr gibt es in Aisingerwies noch freie Plätze. Nähere Auskünfte sind erhältlich bei der Kindergartenleitung Diana Kehrberg (Telefon 08036/4082).
Auch beim Verein selbst steht ein Wechsel bevor. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 23. Juni, wird der Vorstand neu gewählt. Beginn der Veranstaltung in der Waldorfschule ist um 20 Uhr.
Rosenheim (pil) – „Zwei Mütter – etwas Besseres kann einem nicht passieren“. Ruth muss es wissen; schließlich kam sie bereits mit gut einem Jahr zu einer Tagesmutter. Heute ist sie 15 und an Probleme, ein „Tageskind“ zu sein, kann sie sich ebenso wenig erinnern wie die 21jährige Laura, die acht Jahre lang von einer Kinderfrau betreut worden war. „Das war ganz normal“, erklärten die beiden übereinstimmend beim Geburtstagsfest des Tageselternservice (TES) Rosenheim.
 |
| Fünf Jahre Tageselternservice (TES) Rosenheim – ein kleiner Grund zum Feiern für Isabel Neumüller, die Ansprechpartnerin für den Landkreis, Lena Schuster (Stadt), Renate Heilmann, stellvertretende Vorsitzende des Evangelischen Bildungswerks, und Susanne Diestelhorst-Weiand, ebw-Geschäftsführerin und mit der TES-Gesamtleitung betraut (von links). Im Landkreis Ebersberg feierte TES vor kurzem sein zehnjähriges Bestehen. Foto: pil |
Seit Jahresbeginn benötigen Tagesmütter, die Kinder außerhalb des Elternhauses mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen, eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt (Sozialgesetzbuch VIII § 43). TES wartet dabei nicht nur mit Kursen für die entsprechende Qualifizierung auf, sondern ist darüber hinaus im Auftrag der Jugendämter zuständig für die Vermittlung von Tagesmüttern in Stadt und Landkreis sowie für deren intensive Beratung und Betreuung.
Ein dickes Lob sprachen Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und Jugendamtsleiter Gerd Rose am Dienstag den Verantwortlichen bei TES sowie den Tagesmüttern für ihr Engagement und ihre Flexibilität aus. 80 Frauen sind derzeit im Stadtgebiet, weitere 170 im Landkreis als Selbständige im Einsatz und bieten damit nicht nur jungen Familien eine Alternative zur Kinderkrippe. Dank der Netzwerk-Arbeit können sie sogar für erkrankte „Kolleginnen“ einspringen. Doch wie im „richtigen“ Familienleben laufe trotz aller Begeisterung für diesen Beruf auch bei den Tagesmüttern nicht immer alles glatt, berichteten die drei Teilnehmerinnen einer kurzen Interviewrunde von ihren Erfahrungen. So mache den Kleinen beispielsweise der Abschied von der Mutter oft zu schaffen; zumal wenn sich die Beziehung zwischen der Tagesmutter und ihrem Schützling erst noch festigen muss. Gespräche nähmen daher einen ganz wichtigen Platz ein, betonten die annehmenden (Tages-)Mütter ebenso wie die abgebenden.
Bleibt abzuwarten, ob sich Gerd Roses Hoffnung erfüllt und sich demnächst auch ein paar Tagesväter bei TES melden.
7. Juni 2006
 |
| Um nicht aus der Übung zu kommen, steht für Lea Cia und Andreas Pötzl nach wie vor Trockentraining am Fahrlerngerät auf dem Programm. Einmal im Monat üben sich die beiden außerdem in Hundham im Hindernisfahren. Foto: pil |
 |
| Auch das Anspannen will gelernt sein. Foto: nn |
Mehrere Wochen lang hatten sich die Mädchen und Buben intensiv auf ihre Prüfung vorbereitet. Theorie wie das Benennen der Bestandteile einer Kutsche und verschiedener Pferdearten stand dabei ebenso auf dem Trainingsprogramm wie das Üben der Achenbach'schen Leinengriffe am Fahrlerngerät.
Gemeinsam mit seinem Helfer Peter Pötzl machte Weinmayr die Hufeisen-Anwärter schließlich für den Straßenverkehr fit. Entsprechend problemlos ging auch die Prüfung bei Richter Helmut Meidert von Herrenchiemsee, für die zwei Haflinger und zwei Tinker eingespannt wurden, über die Bühne.
Gänzlich umsatteln aufs Gespann-Fahren wollen zumindest Lea Cia und Andreas Pötzl dennoch nicht: Während die andere große Leidenschaft des Mädchens nach wie vor das Reiten ist, steht der Panger nämlich auch gerne beim Kampfsport-Training auf der Matte.
7. April 2006
von Marisa Pilger
Rosenheim – Noch immer gilt sie bei vielen als Tabu, an das nicht gerührt werden darf, und wird deshalb nicht selten einfach totgeschwiegen: die Trauer. Aus diesem Grunde haben es sich die Leiter mehrerer Trauergruppen in der Region nun zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, verstärkt um Aufmerksamkeit und um Verständnis für eine Thematik zu werben, die bislang nur an Allerheiligen gesellschaftsfähig zu sein scheint, Betroffene aber ein Leben lang in irgendeiner Form begleitet. „Man muss Krisen zulassen dürfen.“, fordert nicht nur Hermine Seibt, bei der die Fäden des vor gut einem Jahr gegründeten Trauer-Netz-Werks zusammenlaufen.
„Trauernde werden häufig wie Infizierte behandelt.“ Diese Beobachtung bewog Barbara Weis vor gut fünf Jahren, einen offenen Treffpunkt unter dem Titel „Ich habe einen Menschen verloren“ ins Leben zu rufen. Rund zehn Betroffene im Alter zwischen 29 und 86 kommen einmal im Monat zusammen, um zu reden, in Fotoalben zu blättern, miteinander zu weinen - und auch zu lachen. Die in Psychotherapie Ausgebildete ist dabei eine der wenigen Leiter einer Selbsthilfegruppe, die nicht zugleich Betroffene ist. „Ich wollte die Menschen einfach ansprechen.“, beschreibt sie ihre Intention und sieht sich vor allem als Moderatorin. Denn „die Gruppe lebt von sich und den Leuten“. Und längst treffen sich die Mitglieder – fast ausschließlich Frauen - zu ihrer Freude auch privat, sei es zum gemeinsamen Sektfrühstück oder wenn irgendwo Malerarbeiten anstehen.
Dass es keinen Ausweg gibt, sondern nur „Wege durch die Trauer“, vermittelt auch Hermine Seibt seit zehn Jahren in ihrer Gruppe im Wasserburger Caritas Zentrum. Ihrer Erfahrung nach braucht „eine gute gelungene Trauer mindestens drei Jahre.“ Aber „Trauer ist auch Einsamkeit“, gerade für ältere Menschen, weiß Margrit Schmidt, die sich seit drei Jahren im Trauercafé beim Jakobus-Hospizverein engagiert. Bei Kaffee und Kuchen werde dort gelacht und eben auch „viel geweint“, was viele als Befreiung empfänden. Und, betont sie, „wir lassen niemanden bedrückt weggehen“. „Es gibt so viele Arten der Trauer wie es Menschen gibt.“, geben die Gruppenleiter zu Bedenken und treten damit zugleich der weit verbreiteten Auffassung entgegen, Trauer stelle, gleich einem Kapitel in einem Buch, einen eigenen Lebensabschnitt dar: „Trauerarbeit kann man nicht abschließen“; denn der Verlust des Partners oder eines Kindes begleite die Hinterbliebenen ein Leben lang. Unterschiedlich seien nur die Symptome und deren Ausprägung, von der reinen Traurigkeit bis hin zur Krankheit.
Was den Betroffenen jedoch am wenigsten nützt, sind "Gebrauchsanweisungen" oder starre Schemen für den Trauerweg. So arbeitet Regina Mayr, die Pastoralreferentin der Pfarrei St. Nikolaus, nach dem Ansatz "Trauer erschließen", wenn sie jedes Jahr von Januar bis Juli eine geschlossene Gruppe begleitet. Wichtig ist ihr dabei, die Trauernden zu ermutigen, ihren individuellen "Weg durch das Labyrinth der Trauer" zu gehen. Die Begleiterin kann dabei den Weg nicht vorgeben, sondern Hilfestellung leisten beim Deuten dessen, was sich auf diesem Weg erschließt.
„Trauer heißt vor allem sich trauen“, erklärt auch Dirk Scholz, der gemeinsam mit seiner Frau Sigrid die „Verwaisten Eltern“ in Rosenheim leitet. Das Ehepaar hat vor mittlerweile 16 Jahren sein einziges Kind durch einen Unfall verloren und hatte damals selbst Rückhalt bei der Selbsthilfegruppe gefunden, die sich später allerdings auflöste. Seit fünf Jahren nun bietet sich dank der Initiative der Scholz' wieder eine Anlaufstelle für mittlerweile rund 20 Eltern, die eines oder sogar mehrere minderjährige Kinder verloren haben. Scholz selbst hat inzwischen gelernt, „mit seinem toten Kind“ zu leben. Der Trauerschmerz hat sich im Lauf der Jahre gewandelt; jetzt „überwiegt die kostbare Erinnerung an die gemeinsame Zeit mit dem Kind“.
Renate Bachmann kam erst vor zweieinhalb Jahren, nach dem Unfalltod ihres 29jährigen Sohnes, zu den „Verwaisten Eltern“ in Prien. Nun will sie den Beistand, den sie dort empfangen hat, weitergeben. Allein das Gefühl vermittelt zu bekommen, „dass man sich wieder freuen darf“, habe ihr sehr geholfen. Die größte Hemmschwelle aber, glauben alle, sei der erste Kontakt, das erste Treffen mit einer Gruppe. Wenn jene erst überwunden sei, fänden viele gerade durch die Geborgenheit langsam wieder den Weg zurück ins Leben. In ein Leben allerdings, das nie wieder so ein wird, wie vor dem Tod des Kindes, des Mannes oder der Ehefrau.
Eltern, die ihr Kind bereits in der Schwangerschaft oder bei der Geburt verloren haben, finden derweil bei der Beratungsstelle Donum Vitae fachliche Unterstützung. Die vier Treffen unter Anleitung von Sozialpädagoginnen stehen dort jeweils unter der Überschrift „Wie eine Sternschnuppe“.
Besonderen Rückhalt aber gebe in jedem Fall das Gefühl, nicht alleine mit einem derart gravierenden Schicksalsschlag dazustehen. „Es ist wichtig, jemanden zu finden, dem das auch passiert ist.“ bestätigt Elfriede Hecht. Vor knapp sieben Jahren starb ihr Mann, und sie stand von einem Tag auf den anderen alleine mit ihren vier Kindern im Alter von fünf bis 16 Jahren da. Zum Verlust des Partners kommen in Fällen wie diesem nicht selten finanzielle Probleme. Vor allem aber brauchen auch die Kinder viel Beistand.
Gemeinsam mit Pastoralreferent Helmut Schneider hat Hecht deshalb im Januar 2004 einen Kreis für „Verwitwete Mütter und Väter“ ins Leben gerufen. Rund 15 Betroffene, zum Teil auch aus Tirol, kommen mittlerweile zu den Treffen in Kiefersfelden, wo parallel eine Kinderbetreuung angeboten wird. Neben Gesprächskreisen steht dort ganz pragmatische „Lebenshilfe“ auf dem Programm: Referenten informieren über Versicherungsfragen, Kinderpsychologen und Famlienhelferinnen bieten Unterstützung an. Zumal gerade bei Kindern der Trauerprozess meist mit Verzögerung – manchmal von bis zu einem Jahr – anlaufe. Aggressivität, Leistungsabfall oder völliges Abkapseln von der Umwelt sind dabei nur einige der möglichen Symptome. Kommen in der Schule Themen wie Muttertag, Vatertag oder „Meine Familie“ zur Sprache, sind die Halbwaisen nicht selten heillos überfordert, stoßen in vielen Fällen aber auf wenig Verständnis.
Ungleich größer werden die Berührungsängste noch, wenn eine Selbsttötung vorliegt. Mit ihrem Angebot „Trauer nach Suizid“ will deshalb eine Betroffene „Raum für Gefühle geben“, für den Kummer ebenso wie für die Wut. Denn aus eigener schmerzvoller Erfahrung – ihr Mann hatte sich vor sieben Jahren das Leben genommen - weiß sie: “Es ist wichtig, auch die Aggressionen auf den Verstorbenen zuzulassen.“
30. März 2006
Das Trauer-Netz-Werk im Überblick
Nichts erklären, nichts beweisen müssen.“ Neben anderen findet sich auch dieser Satz von Detlev Block auf dem Faltblatt, welches das Trauernetzwerk zusammengestellt hat. Insgesamt neun offene und geschlossene, konfessionell ungebundene Trauergruppen in der Stadt und im Landkreis Rosenheim sind in der Broschüre mit Ansprechpartnern und Terminen aufgeführt. Sie liegt unter anderem in Gemeindeverwaltungen, Kliniken, Kirchen und bei Bestattungsunternehmen auf, kann aber auch direkt bei Hermine Seibt angefordert werden.Erreichbar ist das Trauer-Netz-Werk über den Jakobus-Hospizverein in Rosenheim, Reichenbachstraße 3, Telefon 71964. Es vermittelt darüber hinaus fachliche Beratung und bietet eine Anlaufstelle für neue Gruppenangebote. Geplant sind außerdem regelmäßige Treffen der Gruppenbegleiter zum Erfahrungsaustausch. |
Landkreis (pil) – Der Chor des Priesterseminars in Ternopil (Ukraine) stattet der Region einen zehntägigen Besuch ab. Vom 18. bis zum 26. März stehen daher im Landkreis und in Salzburg einige Gottesdienste im Byzantinischen Ritus auf dem Programm. Den Auftakt macht am Samstag, 18. März, um 19 Uhr der Ukrainisch-Katholische Gottesdienst mit Vater Wolodymyr Firman in der Rohrdorfer Pfarrkirche St. Jakobus.
Bereits vor mehr als zehn Jahren wurden vom Raum Rosenheim und Prien aus Brücken geschlagen zur Diözese Ternopil in der Ukraine und zum dortigen Priesterseminar, wo inzwischen rund hundert junge Menschen einen Platz zum Leben, Lernen und Arbeiten gefunden haben. So entstanden im Marien-Wallfahrtsort Zarvanytsja eine neue Kathedrale sowie ein dem französischen Pilgerort Lourdes nachempfundener Platz in Eigenleistung.
| Zu hören ist der achtköpfige Chor in beziehungsweise nach folgenden Gottesdiensten: Samstag, 18. März, 19 Uhr, Rohrdorf Sonntag, 19. März, 9 Uhr, Söllhuben Sonntag, 19. März, 19 Uhr, Kolbermoor, Rainerstraße Montag, 20. März, 19 Uhr, Salzburg, Franziskanerkirche Dienstag, 21. März, 15.30 Uhr, Prien, Caritas-Altenheim Dienstag, 21. März, 19 Uhr, Oberaudorf, Klinik Bad Trissl Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, Riedering Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Rimsting Freitag, 24. März, 19.15 Uhr, Halfing Samstag, 25. März, 19 Uhr, Törwang Sonntag, 26. März, 9 Uhr, Frasdorf Sonntag, 26. März, 14 Uhr, Höhenmoos (Abschlusskonzert) |
Die Einrichtung in Ternopil kann zwar inzwischen einen großen Teil der benötigten Lebensmittel – etwa Fleisch, Eier, Getreide und Gemüse - aus der hauseigenen Landwirtschaft beziehen. Doch für den Unterhalt des Seminars sowie für den Unterricht, für Fahrzeuge und Heizung benötigen die angehenden Priester Geld; vor allem die drastische Preiserhöhung beim Erdgas reißt ein großes Loch in die Haushaltskasse.
Nach ihrer Weihe sollen die jungen Geistlichen dann in der Ostukraine, wo aus kirchlicher Sicht noch weite Teile brach liegen, Pfarreien gründen. Dabei sind die schlecht bezahlten Priester stark auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Bei ihrem Besuch in der Region wollen die Ukrainer den Rosenheimern ihre Art der Liturgiefeier, bei der der Chorgesang eine tragende Rolle spielt, näherbringen und zugleich Spenden sammeln.
Rosenheim (pil) – Knapp dreieinhalb Minuten dauerte ihr großer Auftritt in der Wiener Staatsoper; doch Julia Aufinger und Markus Friedrich steht die Begeisterung noch immer ins Gesicht geschrieben, wenn sie von den Tagen in der österreichischen Hauptstadt erzählen und von dem langgehegten Traum, der dort vor kurzem für vier junge Leute aus Rosenheim und Kolbermoor in Erfüllung gegangen ist: Denn mit Julia Aufinger und ihrem Freund Christoph Declara (beide 22 Jahre) sowie der 18jährigen Sabine Aicher und ihrem Freund Markus Friedrich debütierten im Mozartjahr gleich zwei Paare aus der Region beim Wiener Opernball. Ihr Fazit: „Es war einfach toll!“
„Das bleibt eine Erinnerung fürs ganze Leben.“, schwärmt der 19jährige. Besonders überrascht war der Auszubildende von der ungezwungenen Atmosphäre in dem prächtigen Opernhaus. In vollen Zügen hat das Quartett nach der Eröffnung dort noch eine beeindruckende Ballnacht genossen, die für die vier zwar erst gegen fünf Uhr endete aber wie im Fluge verging. „Wir durften sogar in die 16.000 Euro teuren Logen schauen.“, freut sich der 19jährige, der von der Hilfsbereitschaft der Wiener ebenso angetan war wie Aufinger.
 |
| Vier Rosenheimer im Dreivierteltakt: Sabine Aicher, Markus Friedrich, Julia Aufinger und Christoph Declara (von links) debütierten beim 50. Wiener Opernball. Foto: nn |
Abgesehen vom regelmäßigen Tanztraining in Rosenheim war der Endspurt in Wien nochmal besonders schweißtreibend: Die Damen klagten nach dem zweiten Probentag der vielen Knickse wegen über Muskelkater in den Oberschenkeln; und selbst dem durchtrainierten Fußballer Markus Friedrich ging öfter mal die Puste aus. „Für Lampenfieber war ich viel zu erschöpft.“, lacht Julia.
Spätestens als am Ballabend die ersten Töne der Polonaise erklangen, war nicht nur für Markus Friedrich alle Anstrengung ebenso vergessen wie die 5000 Gäste und die vielen Fernsehkameras: „Ich habe mich nur noch auf den Takt und die Schritte konzentriert.“
So stolz die beiden Pärchen auf ihr Debüt in der Donaustadt sind, so dankbar sind sie auch für die Unterstützung, die sie unter anderem von der Tanzschule Kesmarki sowie vom Choreographen Klaus Mühlsiegl erfahren haben. Und ohne den Wagen, den ein Rosenheimer Autohaus für den einwöchigen Wien-Aufenthalt zur Verfügung gestellt hat, wäre der Traum vom Eröffnungswalzer beim Opernball möglicherweise ebenso ein Traum geblieben, wie ohne die kräftige Finanzspritze von Seiten des Wirtschaftlichen Verbandes, betonen sie. So blieben für die jungen Leute unterm Strich lediglich die Kosten für Verpflegung und Übernachtung sowie die Leihgebühr für die Fräcke. Und der Wunsch, den Wiener Opernball bald wieder einmal live mitzuerleben – wenn auch „nur“ als Besucher.
7. März 2006
Rohrdorf (pil) – Die Kräfte der Firma sind erlahmt, Veränderungen dringend notwendig. Dieses Bild zeichnete Landtagspräsident Alois Glück als Festredner beim Jahresempfang des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks Rosenheim vom Unternehmen Deutschland. Jetzt sei vor allem ein Umdenken in weiten Teilen der Gesellschaft erforderlich, um das Land aus der Krise und zu neuer Leistungsfähigkeit zu führen. Vor rund 250 Zuhörern zeigte der Katholik eine Reihe von Ansatzpunkten auf, an denen Christen Initiativen entwickeln, Vorstellungen vermitteln und Einfluss auf ein künftiges Leitbild nehmen könnten. Christen sollten, auch als Ausdruck ihres Glaubens, „den Wandel nicht erleiden sondern gestalten“, appellierte er ans Publikum. Die Neugestaltung des Sozialstaats sieht Glück dabei als eine der vordringlichen Aufgaben an. Dabei beschränke sich die derzeitige Misere nicht allein auf die Finanzen. Vielmehr, machte er in der Turner-Hölzl-Halle in Rohrdorf mit Nachdruck deutlich, bedürfe es einer ebenso umfassenden wie grundlegenden Wertedebatte. Religion nehme in der Gesellschaft zwar wieder einen höheren Stellenwert ein als noch vor ein paar Jahren, doch komme dies nicht unbedingt den christlichen Kirchen zugute, bedauert Glück, der unter anderem dem Zentralkomitee der Katholiken angehört. Nicht zuletzt um der sozialen Kälte im Lande entgegenzuwirken, müsse sich das Modell eines zeitgemäßen Sozialgefüges - gleich einem Kompass – am Menschenbild der christlich-europäischen Werteentwicklung ausrichten, das jedem Menschen die gleiche Würde zuerkennt und so eine unverzichtbare Voraussetzung für eine humane Zukunft schafft. Um langfristig in der Weltspitzengruppe bestehen zu können, müsse sich außerdem die Einstellung zur Leistung ändern.
 |
| Dankbar für die Impulse, die Landtagspräsident Alois Glück (rechts) in seinem Festvortrag „Der Auftrag der Christen in der Welt dieser Umbruchzeit“ beim Jahresempfang des Dekanatsbezirks Rosenheim geliefert hatte, zeigte sich Dekan Michael Grabow. Er strich in seiner Eröffnungsansprache unter anderem die Aktivitäten der Evangelischen Kirche sowie die „Tragfähigkeit der ökumenischen Verbundenheit“ heraus. Einen Kontrapunkt zu dem nachdenklichem Vortrag Glücks setzte nach der Pause das Pfarrkabarett „Das weißblaue Beffchen“ mit seinem Satire-Programm „Fraglos glücklich?“ Foto: pil |
19. Februar 2006
Nußdorf (pil) – Wenngleich die Eisenbahn der Schifffahrt bereits zum Ende des vorvorigen Jahrhunderts zunehmend das Wasser abgegraben hat, verzeichnet der Nußdorfer Schiffleut-Verein, der 1635 ursprünglich als eine Art Sozialkasse für die Innschiffer beziehungsweise deren Hinterbliebene aus der Taufe gehoben worden war, nach wie vor Zulauf: Neun vorwiegend weibliche „Neuzugänge“ begrüßte Vorstand Johann Dettendorfer bei der Jahreshauptversammlung im „Schneiderwirt“, zu der sich auch wieder Schiffleut aus dem gesamten Inntal zwischen Wasserburg und Kiefersfelden eingefunden hatten.
Dem Kirchenchor bescherte der 182. Jahrtag darüber hinaus einen unerwarteten Geldsegen: Als Dank für die stimmungsvolle Untermalung der Dankgottesdienste in St. Leonhard befürwortete die Versammlung eine 800-Euro-Spende aus der Vereinkasse.
Einen Überblick über die Aktivitäten des nunmehr 315 Mitglieder zählenden Vereins gab Schriftführer Bernhard Oberauer; er ließ unter anderem den Ausflug zum Schiffleut-Museum im österreichischen Grein Revue passieren, bei dem die Teilnehmer zudem in den Genuss einer historischen Brautfahrt auf den Spuren der Kaiserin „Sissi“ gekommen sind. Den nächsten Termin hat der Vorstand derweil bereits ins Auge gefasst: Im August ist wieder ein Schiffleut-Fest auf dem Dettendorfer-Anwesen geplant.
 |
| Auch beim Schiffsleut-Vorsitzenden, Altbürgermeister Johann Dettendorfer, stießen die Ausführungen von Prälat Dr. Walter Brugger über die Entstehungsgeschichte der Heilig-Kreuz-Kirche in Windshausen auf großes Interesse. Für die klangvolle Untermalung des Jahrtags sorgte die Musikkapelle Nußdorf. Foto: pil |
Nach fünfjähriger Restaurierung erstrahlt Heilig Kreuz seit einiger Zeit wieder in neuem Glanz; und der Kunstgeschichtler hofft, dass nun auch die Renovierung der Eremitage in Angriff genommen werde, von der aus man durch Gucklöcher Sichtkontakt in den Kirchenraum hatte. Weitere Details über die Kirche im Niemandsland zwischen Bayern und Tirol versprechen sich die Nußdorfer nun von dem neuen Kirchenführer, an dem Brugger derzeit arbeitet.
Doch auch die Schiffleut haben noch eine gro?e Aufgabe vor sich: Immerhin gilt es, 1600 Seiten historischer Dokumente in die heutige Sprache zu übertragen. Nicht nur für alteingesessene Nußdorfer Familien könnten die Unterlagen von großem Interesse sein, ist Dettendorfer überzeugt, weshalb er die Gemeindebürger um Unterstützung beim Sichten und Übersetzen der Papiere bittet.
26. Januar 2006
Brannenburg (pil) – Die Filmnacht mit „Goldständer“ und „Findet Nemo“, die die 9 b organisiert hatte, war zur Freude von Michael Hannover ein voller Erfolg. Etwa 50 Jugendliche lockte das klassenübergreifende Schülerprojekt, das der „Neue“ an der Maria-Caspar-Filser-Volksschule angestoßen hatte, in den Zuschauerraum. Über mangelnde Resonanz kann der Sozialpädagoge, der sich seit einem Vierteljahr in Brannenburg in der Schulsozialarbeit engagiert, aber auch in anderen Bereichen nicht klagen.
Kaum hatte er das Sozialkompetenztraining in der 7. und 8. Jahrgangsstufe abgeschlossen, meldeten bereits weitere Klassen Interesse an dem Kurs an. Und fürs Frühjahr hat Hannover, der früher unter anderem in der Jugendgerichtshilfe gearbeitet hat, ein Bewerbungs-Planspiel für die 8. Klassen ins Auge gefasst, wie es der Trägerverein „Pro Arbeit“ an anderen Schulen in Stadt und Landkreis Rosenheim bereits seit längerem organisiert.
 |
| Pinwand, Kicker, Pflanzen – Die Schüler, die den Raum der Schulsozialarbeit abwechselnd während der Pausen als Aufenthaltsraum nutzen dürfen, haben bereits einige Verschönerungsvorschläge gemacht; ein Computer wurde bereits gespendet. Vor allem aber freut sich Michael Hannover (rechts) über den guten Start und das aufgeschlossene Kollegium an der Maria-Caspar-Filser-Volksschule in Brannenburg. Die Bedeutung der Schulsozialarbeit hoben auch Bürgermeister Peter Gold, Claudia Georgii, die Geschäftsführerin des Vereins „Pro Arbeit“, und Schulleiter Anton Matousek hervor (von links). Foto: pil |
Ohnehin, ergänzte Gold mit Verweis auf den Integrationshort und auf das Jugendcafé der Diakonie, werde Jugendarbeit in Brannenburg großgeschrieben.
Die Idee, Sozialarbeit auch an der Maria-Caspar-Filser-Volksschule zu etablieren, wurde im Grunde genommen vor zwei Jahren geboren. Damals, erinnert sich Matousek, vergifteten dort mehrere Jugendliche das Klima: „Wir waren an unserer Grenze.“ Denn auch auf dem Land ist die traditionelle Großfamilie so gut wie passé. Nicht selten sind beide Elternteile voll berufsfähig und die Kinder nach dem Unterrichtsende sich selbst überlassen. Was sich in diesen Fällen mitunter an Erziehungsdefiziten und Verhaltensauffälligkeiten aufbaut, könnten jedoch die Lehrer allein gar nicht bewältigen. Umso mehr begrüßt er die „professionelle Unterstützung“ durch Hannover, der zunächst an zwei Vormittagen in der Woche in seinem „Büro“ im ersten Stock (Telefon 08034/309846) erreichbar ist. Sozialarbeit, betont der Rektor, sei längst nicht mehr nur ein Fall für „Brennpunktschulen“.
15. Dezember 2005
Rosenheim (pil) – Die Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der außerordentlichen Mitgliederversammlung beim Bildungswerk Rosenheim. Darüber hinaus referierte Josefine Lechner, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, über das Qualitätsentwicklungssystem mit Testierung, „QES-T“, das seit Sommer in der Pettenkoferstraße umgesetzt wird.
Weil über die künftigen Rahmenbedingungen für die 14 Bildungswerke in der Erzdiözese München und Freising zum regulären Termin im Sommer noch Unklarheit herrschte, war der Wahlgang damals auf November verschoben worden. Nun, erklärte die alte und neue Vorsitzende Eva-Maria Zehetmair, liege die neue Satzung der KEB (Arbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung) samt überarbeiteter Fassung des Umlageverfahrens vor; sodass auch in Rosenheim "die Weichen für die kommenden Jahre gestellt werden können".
Ohne Gegenstimme wurde die Lektorin und dreifache Mutter aus Au bei Bad Feilnbach von den 63 Stimmberechtigten im Amt bestätigt. Einigen Wechsel gab es dagegen in der Vorstandschaft, die sich nun folgendermaßen zusammensetzt: Johanna Abel (Frasdorf), Johannes Boldt (Stephanskirchen), Dr. Martin Leider (Höhenmoos), Peter R. Müller (Stephanskirchen), Manfred Oehmichen (Bad Feilnbach), Brigitte Thoma (Rosenheim-Fürstätt), Maximilian Sollinger (Schechen-Hochstätt), Pfarrer Andreas Zehentmair (St. Nikolaus); Hans-Peter Czech, der Vorsitzende des Kreiskatholikenrates, und der stellvertretende Landkreisdekan, der Rohrdorfer Pfarrer Gottfried Doll, gehören dem Vorstand kraft Amtes an. Als Kassenprüfer sind weiterhin Michael Kleeberger (Höhenmoos) und Rosa Schwaiger (Pfaffenhofen) tätig.
 |
| Der neue Vorstand im Bildungswerk Rosenheim: Manfred Oehmichen, Dr. Martin Leider, Maximilian Sollinger, Brigitte Thoma, Johanna Abel, Hans-Peter Czech, Eva-Maria Zehetmair, Gottfried Doll, Johannes Boldt, Peter R. Müller und Andreas Zehentmair (von links). Foto: pil |
Sämtliche Leistungsbestandteile aus den Sektoren Einrichtung und Dienstleistung die Verwaltung ebenso wie das Kursangebot werden bis dahin einer Prüfung im sogenannten Qualitäts-Entwicklungskreis unterzogen, bei Bedarf nachgebessert, und müssen dann den Zyklus von Planen, Durchführen, Auswerten und Konsequenzen erneut durchlaufen. Für Lechner birgt dieses Verfahren neben viel Arbeit vor allem die Möglichkeit, nicht nur Verwaltungsabläufe klar zu strukturieren, sondern auch in allen anderen Arbeitsbereichen -die Dinge auf den Punkt zu bringen - und für alle nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Kursteilnehmer werden die Auswirkungen des Qualitäts-Managements vor allem in Form von systematischen Befragungen zu spüren bekommen.
7. Dezember 2005
Von Marisa Pilger
Rosenheim – „Du musst Party machen, solange du jung bist!“ Und dass der Wodka dabei einer der beliebtesten Gäste ist, schickt der Bursche in Jeans und Sweatshirt gleich hinterher. Die Gründe, warum immer mehr Jugendliche immer früher zur Flasche greifen, sind vielfältig. Doch egal ob aus Frust, aus Langeweile oder einfach weil es „cool“ ist – für viele Heranwachsende „gehört Alkohol einfach dazu“, nicht nur im Fasching oder auf der Wiesn. Mit Sorge verfolgen Suchtberatungsstellen, Jugendamt und Polizei die Entwicklung, die offenbar auch mit diversen Programmen zur Suchtprävention nur schwer in Griff zu bekommen ist. Gefordert, so der Tenor, seien in diesen Fällen zu allererst die Eltern.
Ernüchternde Zahlen hatte die "Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen" (ESPAD)zutage gefördert, an der sich Deutschland im Jahr 2003 erstmals beteiligt hat: Jeder zweite Jugendliche unter 14 Jahren war demzufolge schon einmal betrunken gewesen. Damals lagen die Alkopops mit 63 Prozent an der Spitze der Getränke, gefolgt von Bier (56%), Spirituosen (51%) und Wein/Sekt (50%). Insgesamt räumten 38 Prozent der rund 11.000 befragten Neunt- und Zehntklassler Trunkenheitserlebnisse während der letzten 30 Tage vor der Befragung ein. Dagegen waren lediglich sechs Prozent der Jungen und fünf Prozent der Mädchen über einen Zeitraum von zwölf Monaten abstinent gewesen.
Die süßen Alkopops seien zwar nicht zuletzt wegen der Sondersteuer bereits wieder rückläufig; doch habe sich mittlerweile der Wodka als "Nationalgetränk" etabliert, bringt es Wolfgang Moritz, Jugendbeamter bei der Polizei in Rosenheim, etwas bitter auf den Punkt. An vielen Wochenenden, so seine Beobachtungen, werde im Freundeskreis aus Spaß an der Freud' bis zum Umfallen gebechert. Die Zahl derjenigen unter 18 Jahren, die dann mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landet, bildet dabei nur die Spitze des Eisberges. Von insgesamt 131 alkoholbedingten Ausfällen wurden im Jahr 2004 allein 30 Minderjährige - der Jüngste war gerademal zwölf - volltrunken und mitunter bewusstlos ins Klinikum Rosenheim eingeliefert. Bis Ende Oktober dieses Jahres hat Dr. Christian Ockert, Oberarzt an der Kinderklinik, bereits 32 Fälle von insgesamt 136 registiert, bei denen Jugendliche zum Teil intensivmedizinisch betreut werden mussten. „Das geht durch alle Schichten.“, schildert der Mediziner, der im Lauf der letzten 15 Jahre durchaus eine „Verschärfung des Problems“ beobachtet hat.
Zudem sei die Trinkerei unter Heranwachsenden beileibe keine reine Stadt-Erscheinung – und ist es wohl auch nie gewesen, wie Polizeisprecher Dieter Bezold mit Blick auf die oftmals rauschenden Festivitäten von Burschen- und Feuerwehrvereinen im Umland anmerkt.
Als „wahre Brutstätten“ des Alkoholismus bei Jugendlichen bezeichnet gar Peter Schober diese Feste. Der Hauptschullehrer wie auch eine Realschul-Pädagogin erleben die Auswirkungen der Wochenend-Vergnügungen regelmäßig am Montag, wenn reihenweise Schüler im wahrsten Sinne des Wortes „blau“ machen. Dem Kampftrinken, an dem sich auch die Mädchen in zunehmenden Maße beteiligen, stehen die beiden fassungslos gegenüber. Hier müssten vor allem die Eltern die Verantwortung genommen werden, fordert nicht nur Schober, doch viele „erfüllen ihren Erziehungsauftrag gar nicht mehr richtig“ - sei es aus Desinteresse, sei es, weil sie sich mit der Problematik überfordert fühlen. Die Lehrerin etwa hat es schon erlebt, dass Eltern ihren Sprösslingen für die Abschlussfahrten schriftlich grünes Licht fürs Trinken und Rauchen geben wollen.
Teils „erschreckende“ Beobachtungen haben während der letzten Wiesn die Jugendschutzbeauftragte der Stadt Rosenheim, Katharina Köck, und der Jugendbeamte Moritz auf ihren gemeinsamen Streifen durch die Bierzelte gemacht. Wohl weil es gerade „in Mode ist“, hätten vor allem die 16- bis 18jährigen „enorm viel getrunken“, fasst Köck ihre Eindrücke zusammen. Nicht verboten, solange nur Bier im Spiel ist, meint sie, verweist aber auf einen Paragraphen, der den Ausschank von Alkohol an stark Betrunkene untersagt. – „Doch denn kennt keiner.“
Unterdessen warnt Bezold davor, das Thema Trinken auf die fünfte Jahreszeit zu reduzieren. Zwar hätten rund 80 Prozent der Wiesnverbote jungen Leuten zwischen 16 und 30 Jahren gegolten – viel schwerer aber wögen die regelmäßigen Privat-Partys, wo Hochprozentiges nicht fehlen darf.
Die meisten Veranstalter und Wirte seien bestrebt, nicht gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zu verstoßen, welches die Abgabe von Bier und Wein an Kinder unter 16 Jahren, von Branntwein an Jugendliche unter 18 Jahren untersagt. Immerhin drohen bei wiederholten Verstößen bis zu 50.000 Euro Geldstrafe. Umso mehr freut sich Bezold über den Schulterschluss mit dem Wirtschaftlichen Verband als Veranstalter des Christkindlmarkts. Nach den Problemen im vergangenen Jahr gibt's dort heuer keinen Glühwein mit "Schuss" (Schnaps) mehr; und Feuerzangenbowle und Caipirinha dürfen ohnehin nur Volljährige kaufen.
„Alkohol ist die Droge, die unsere Kinder bedroht.“, ist Moritz überzeugt, leicht erhältlich und gesellschaftlich anerkannt. Dabei ist ein dicker Kopf am nächsten Morgen noch das geringste Übel. Mit jedem Glas steige die Gefahr alkoholbedingter Unfälle sowie körperlicher und psychischer Langzeitschäden bis hin zum Abrutschen in die Sucht. Zudem sinke bei steigendem Promillespiegel oftmals die Hemmschwelle, Straftaten zu begehen.
Dem vorzubeugen tourt er regelmäßig durch die Schulen. So wird auch am Finsterwalder-Gymnasium Prävention großgeschrieben; wenngleich Christine Zilker, die dortige Beauftragte für Suchtprävention, an ihrer Schule bislang kaum beunruhigende Beobachtungen in punkto Alkohol gemacht hat. Sie billigt den Jugendlichen vielmehr ein gewisses Maß an Vernunft zu.
Allerdings muss Peter Niederhuber, der Leiter der Fachambulanz für Suchterkrankungen des Diakonischen Werkes, immer wieder feststellen, wie wenig die Jugendlichen über den Wirkstoff Alkohol wissen, der nicht selten nur die Vorstufe zu anderen, illegalen Rauschgiften bilde.
Pauschale Richtlinien, ab welcher Menge das Trinken zur Gefahr wird, gebe es ohnehin nicht, ist Markus Bundil vom Stadtjugendring überzeugt. Alarmierend sei jedoch, wenn der Betroffene beginne, abzuleugnen, dass oder zu verschleiern, wieviel er getrunken habe. Von einem strikten Alkoholverbot hält der Sozialpädagoge, der im erzieherischen Jugenschutz tätig ist, wenig. Vielmehr gelte es, den Jugendlichen Alternativen zum Griff zur Flasche aufzuzeigen und deren Stärken zu fördern.
Für Peter Schober ist es damit allein aber nicht getan. Der Lehrer fordert ein Umdenken in der Öffentlichkeit; Alkohol sollte nicht länger als selbstverständlicher Bestandteil in allen Lebenslagen hingenommen und dargestellt werden. Und dazu, so Schober, könnten insbesondere die Medien mit kritischer Berichterstattung beitragen.
27. November 2005
Infos vom Stadtjugendring zum §9 des Jugenschutzgesetzes Ab 16 Jahren darf Jugendlichen nur Bier, Wein oder Sekt, also keine branntweinhaltigen Getränke ausgeschenkt werden. Von 14 bis 16 Jahren ist dies nur in Begleitung von Personensorgeberechtigten (in der Regel die Eltern) erlaubt, Spirituosenabgabe (auch Lebebnsmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten) ist unter 18 Jahren generell verboten. Auch Alkopops können Branntwein enthalten. Dann gilt das gleiche wie bei den Spirituosen. Grundsätzlich ist unter 16 Jahren auch das Rauchen in der Öffentlichkeit untersagt. |
Prutting (pil) – Das Rätsel, warum die Weißwurst weiß ist, dürfte sich für japanische Besucher der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft spätestens bis zur Landung in Deutschland gelöst haben. Noch an Bord der ANA (All Nippon Airways)-Maschinen werden die Passagiere aus dem Inselreich per Filmvorführung auf die hiesige Bier- und Weinkultur eingestimmt – selbstredend fehlt in dem 25minütigen Beitrag rund um den Gerstensaft auch jenes zwölf bis 15 Zentimeter lange Gebilde nicht, das der Metzgermeister und Gastwirt Georg Maier aus Prutting so gerne als „bayerisches Lebenselixier“ bezeichnet.
 |
| 80 bis 90 Gramm schwer soll sie sein, und prall – doch nicht zu prall – gefüllt. Der Pruttinger Metzgermeister Georg Maier (links) legte für das Kamerateam aus Japan eine Sonderschicht in Sachen Weißwurst ein: Auch Lehrling Bernhard Aicher, selbst bereits gelernter Koch, weiß, worauf es ankommt; nämlich auf die Qualität des Fleisches und auf die möglichst niedrige Temperatur während der Verarbeitung. Die muss rasch über die Bühne gehen. Nur 30 bis 45 Minuten sollte der Weg für die Zutaten vom Kühlhaus in den Kessel dauern. Foto: pil |
Längst werde die „shiro sausage“ (shiro: japanisch für weiß; sausage: englisch für Wurst) auch im Reiche Nippons aufgetischt, erzählt die Japanologin Annette Nehrling, die die Aufnahme-Tour des Kamerateams koordiniert. In einer deutschen Kneipe in Tokyo zum Beispiel; die sei gerademal so groß wie zwei der großen Esstische im „Gasthof zur Post“, den Maier gemeinsam mit seiner Frau Christine Kerer und seiner Schwester Gabriele Maier-Püschel in der fünften Generation bewirtschaftet.
Insgesamt drei Wochen lang waren Kameramann, Toningenieur und Redakteur aus Japan unterwegs, um unter anderem auf dem Oktoberfest, im Hofbräuhaus, auf dem Viktualienmarkt und eben in Prutting (auf Maier war man im Internet gestoßen) Bilder bayerischer Lebensart rund ums Bier einzufangen – und um die Weißwurst, die mit herkömmlichem Kochsalz anstelle von Nitritpökelsalz zubereitet wird und sich deshalb nicht rötet. Und die Film-Leute erfuhren dabei unter anderem, dass die magische Marke des Zwölf-Uhr-Läutens, das die Weißwürste früher nicht hören durften, längst passé sei. Denn diese Empfehlung, klärte der Metzgermeister auf, stamme aus jener Zeit, als die Würste noch roh – also nicht gebrüht – verkauft wurden.
17. Oktober 2005
Rosenheim (pil) – Der Klang der Sirene ging durch Mark und Bein. Die drei Burschen waren gerade noch ganz vertieft in das Geheimnis der „Dunklen Brücke“ gewesen und hatten an der Lösung des diffizilen Rechenrätsels getüftelt. Doch jetzt sind die 20 Minuten abgelaufen, und es geht – nach Kurzfilm und Einstellungstest - weiter zur Schnupperlehre, zur nächsten der insgesamt sechs Stationen, die die Schüler im Rahmen des Projekts „Job in Sicht“ durchlaufen müssen. Mit der in dieser Form bayernweit einzigartigen Veranstaltungsreihe, die im Citydome derzeit zum drittenmal läuft, leisten die Volksbanken und Raiffeisenbanken in der Stadt und im Landkreis Rosenheim wieder ganz unkompliziert Starthilfe in Sachen Berufsleben.
 |
| Vom Einstellungstest bis hin zur Schnupperlehre – mit ihrem Projekt „Job in Sicht“ bieten die Volksbanken und Raiffeisenbanken in der Stadt und im Landkreis Rosenheim in dieser Woche 970 Schülern Starthilfe in Sachen Berufsleben. Foto: pil |
Mehr als 1300 Schüler aus Stadt und Landkreis haben bislang die Veranstaltungen besucht, die Bank-Azubis für die angehenden Lehrstellen-Sucher konzipiert haben, fasst Marketing-Chefin Ludmilla Cink die große Nachfrage seitens der Schulen in Zahlen. Mit 970 Jugendlichen - darunter erstmals eine Gymnasialklasse - sei auch diese Woche bereits ausgebucht; freie Plätze gebe es lediglich noch für den Turnus vom 23. bis 27. Januar 2006. Konzept und Termine, betont zudem Ausbildungsleiter Wolfgang Tschuschner, seien dabei bewusst mit dem Lehrplan abgestimmt, wodurch die Schüler doppelt von „Job in Sicht“ profitieren könnten.
Außerordentlich positiv bewertet Hildegard Klauss, die Geschäftsführerin der IHK-Stelle Rosenheim, das Mitmach-Konzept. Durch das Ausprobieren bleibe bei den Jugendlichen ungleich mehr hängen als beim „Dasitzen und Zuhören“, erläuterte sie beim Rundgang durch die Hammerhalle ihre Überzeugung. Dort fanden sich im Laufe des Vormittags außerdem Rosenheims zweiter Bürgermeister Anton Heindl sowie der Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner (CSU) ein. Und eine Schulsozialarbeiterin nutzte die Gelegenheit und sammelte neue Impulse für das Bewerbungsplanspiel, das demnächst an ihrer Schule ansteht.
13. Oktober 2004
Schechen/Rohrdorf (pil) - Als bislang einziger im Landkreis Rosenheim hat der Schechener Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeister Hans Holzmeier einstimmig beschlossen, in diesem Schuljahr auf die Erhebung des Büchergeldes zu verzichten. Dies, so wird an Rosenheimer Schulen befürchtet, die auch Landkreis-Kinder besuchen, könnte für Unmut bei manchen Eltern sorgen.
Rein rechnerisch verzichte die Kommune als Sachaufwandsträger der Grund- und Teilhauptschule Hochstätt (268 Schüler) damit zwar auf Einnahmen in Höhe von etwa 5740 Euro. Aufgrund des geänderten staatlichen Fördermodus für die Anschaffung neuer Bücher schlage der Grundsatzbeschluss jedoch lediglich mit einer Mehrbelastung von rund 2000 Euro für die Gemeindekasse zu Buche, rückt Franz Pommer, der geschäftsleitende Beamte im Schechener Rathaus, die Zahlen zurecht.
In Rohrdorf will der Bürgerblock mit einem entsprechenden Eilantrag nachziehen. "Unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Bildung und der Unterstützung von Familien mit Kindern sehen wir eine solche Entscheidung als selbstverständlich an.", begründen Martin Fischbacher und Petra Scholz-Gigler den Schritt ihrer Fraktion. Bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat - er tagt das nächstemal am Donnerstag, 20. Oktober - solle die Erhebung des Büchergeldes zurückgestellt werden, heißt es in dem Schreiben weiter.
Raubling (pil) – In den meisten Köpfen ist das Virus nicht mehr präsent; oft rückt die Krankheit nur noch am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, für kurze Zeit wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, hat das Gesundheitsamt Rosenheim jetzt gemeinsam mit vier Münchner Beratungsstellen die „Aids-Aktionswochen Rosenheim“ ins Leben gerufen, ein bayernweit bislang einzigartiges Modellprojekt, an dem sich 25 Einrichtungen in Stadt und Landkreis beteiligen.
 |
| Die Anwendung verschiedener Verhütungsmittel, mögliche Übertragungswege des HIV-Virus, pantomimische Darstellungen rund um die Bereich Liebe, Partnerschaft und Sexualität – insgesamt fünf Stationen umfasst der „Mitmach-Parcours zu Aids, Liebe und Sexualität“, mit dem die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zwei Tage lang in Raubling Station machte. Foto: Pilger |
Mit den Aktionswochen, die die Kollegiaten Stefan Ettinger und Sebastian Gieck mit stimmungsvollen Stücken musikalisch einläuteten, will Dr. Irmgard Wölfl, die Leiterin des Gesundheitsamts, ein Zeichen setzen und die Bevölkerung wieder für die Gefahren sensibilisieren, die etwa von ungeschütztem Geschlechtsverkehr ausgehen können. So informieren Vertreter der Rosenheimer Behörde und von vier Münchner Psychosozialen Aids-Beratungsstellen in insgesamt 25 Einrichtungen in Stadt und Landkreis (darunter zahlreiche Schulen) rund ums Thema HIV. Wölfl, die sich auch während ihrer fünfjährigen Tätigkeit im Gesundheitsministerium schwerpunktmäßig dem Thema Aids gewidmet hat, hofft zudem auf eine „bayernweite Nachahmung“ der Rosenheimer Aktionswochen.
Nicht nur angesichts der weltweit 14.000 Neuinfektionen täglich müsse Aids wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, machte Emilia Müller, Staatssekretärin im bayerischen Gesundheitsministerium, deutlich. Zwar sei das zunächst befürchtete Horrorszenario im Freistaat dank flächendeckender Präventionskampagnen ausgeblieben. Doch gerade dies und die Erfolge in der Aids-Therapie hätten zu einer ebenso fatalen wie gefährlichen Entwicklung geführt: Hatten Ende der 80er Jahre noch 22 Prozent der Deutschen Aids als ernsthafte Bedrohung für ihre Gesundheit eingeschätzt, täten dies heute nurmehr zwei Prozent, fasste Müller das steigende Desinteresse in Zahlen. Dabei drohe mittlerweile ganz massiv Gefahr durch die Grenzöffnung zu Osteuropa.
„HIV ist kein Problem von Randgruppen! Aids kann jeden treffen!“, machte die Staatssekretärin ihren Zuhörern, darunter mehrere Landkreis-Bürgermeister, nachdrücklich klar. Und vor allem: „Aids ist nicht heilbar!“
Im Mittelpunkt der Aktion, die auch Landrat Dr. Max Gimple und Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer mittragen, müsse deshalb die Aufklärung und Prävention stehen, betonte auch Dr. Stefan Zippel, der Leiter der Aids-Beratungsstelle an der Dermatologischen Klinik der LMU.
Vor diesem Hintergrund begrüßte nicht nur Müller den „Mitmach-Parcours Aids, Liebe und Sexualtiät“ der BZgA, der für zwei Tage Station im Raublinger Gymnasium machte. In spielerischer Weise wurden dort insgesamt 300 Jugendliche des Gymnasiums und der Hauptschule über den Umgang mit Kondomen ebenso aufgeklärt wie über die Übertragungswege des HIV-Virus. Ziel der Aktion, die vom Landratsamt Rosenheim, der Gemeinde Raubling, donum vitae, vom Diakonischen Werk sowie vom Gymnasium unterstützt wird, ist, die Jugendlichen zum verantwortungsbewussten Umgang mit der eigenen Gesundheit zu motivieren. Aber auch der Ausgrenzung HIV-positiver oder an Aids erkrankter Menschen will das eineinhalbstündige Programm entgegenwirken.
21. Juli 2005
Frasdorf (pil) – „Spielend leben lernen“ - diesem Thema widmet sich vom 18. bis 22. Juli die 16. Welt-Konferenz der IPA (International Play Association) in Berlin, zu der das Deutsche Kinderhilfswerk als Gastgeber an die 500 Teilnehmer erwartet. Um sich bereits im Vorfeld des Kongresses einen Überblick über bedeutende Projekte und Einrichtungen zum Thema Spielen in Deutschland zu verschaffen, machte jetzt eine international besetzte Gruppe auf ihrer „Vorkonferenz-Reise“ Station beim Frasdorfer Spielgeräte-Hersteller Richter. „Uns ist der internationale Austausch zwischen den einzelnen Spielkulturen sehr wichtig.“, erklärte Karla Zacharias von der IPA Deutschland, die die 25köpfige Delegation aus Japanern, Schweden, Norwegern, Portugiesen, Nigerianern, Kanadiern und US-Amerikanern begleitet.
Offene Türen sind für Geschäftsführer Julian Richter ohnehin selbstverständlich; ganz bewusst verzichtet er auf Zäune und Mauern um das 10.000 Quadratmeter große Gelände an der Simsseestraße in Frasdorf. „Nothing special but friendly“ - „Nichts Besonderes aber freundlich“ -, stimmte er seine Gäste auf den Rundgang durch den Betrieb ein, den er 1967 als „junger Schreiner“ mit Unterstützung seiner Mutter aus der Taufe gehoben hat. Heute sind in Frasdorf rund 70 gleichberechtigte Mitarbeiter beschäftigt, davon allein 40 in den Werkstätten; auch die Zulieferer sitzen in der Region.
 |
| Rund 500 verschiedene Produkte umfasst die Angebotspalette der „Richter Spielgeräte GmbH“ in Frasdorf. Einblick in seine Werkstätten und seine Firmenphilosophie gewährte Firmengründer und Geschäftsführer Julian Richter (Mitte) der international besetzten Gruppe, die sich vor Beginn der IPA-World-Conference über bedeutende Projekte und Einrichtungen zum Thema „Spielen“ informierte. Foto: pil |
Nicht zuletzt dank des Exports ins europäische Ausland setzt das Unternehmen jährlich etwa zwölf Millionen Euro um. Dabei verlassen neben rollstuhlgerechten Spielgeräten und Wasserspielen aus Edelstahl mittlerweile sogar ganze Schiffe den Betrieb zu Füßen der Chiemgauer Berge.
Die Reisegruppe indes hat bis zum Beginn des IPA-Kongresses, der erstmals in Deutschland ausgerichtet wird und unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst Köhler steht, noch ein dichtgedrängtes Programm mit Besichtigungen in Frankfurt, Kassel, Weimar, Leipzig und Einsiedel nahe der polnischen Grenze vor sich.
Der Verband, der 1961 als eine internationale Nicht-Regierungs-Organisation in Dänemark ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt hat, das per UN-Konvention verbriefte Recht des Kindes auf Spiel als fundamentales Menschenrecht zu schützen. Der IPA gehören mittlerweile etwa 800 Mitglieder - eines davon das Deutsche Kinderhilfswerk - in fast 50 Ländern an. Die Konferenzen im Drei-Jahres-Turnus wenden sich mit Vorträgen, Workshops, Gesprächsrunden und Spielaktionen an alle Menschen, die in irgendeiner Weise mit Kindern oder deren Belangen zu tun haben: vom Vorschulbetreuer über den Mieterbund-Vertreter bis hin zum Hochschuldozenten für Landschaftsarchitektur.
13. Juli 2005
 |
| 50 Jahre Erlöserkirche in Marzipan: Das süße Stück fand schnell dankbare Abnehmer. Fotos: pil |
„Mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ hatte Pfarrer Walter Joelsen die Einweihung am 26. Juni 1955 erlebt. Er war von 1951 bis 1955 Vikar in Kiefersfelden gewesen und wurde nur zwei Monate nach der Schlüsselübergabe als frischgebackener Pfarrer nach Lindau versetzt. Umso mehr freute sich der Geistliche, wieder für ein paar Stunden in Kiefersfelden zu sein, wo er von vielen Festgästen herzlich begrüßt wurde. Ein Jubiläum, hatte der Rosenheimer Dekan Michael Grabow in seiner Predigt betont, böte – neben allem Grund zum Feiern – auch immer Anlass zum Innehalten und Zurückschauen.
 |
| Zu seiner besonderen Freude konnte das Pfarrer-Ehepaar Ruth und Günter Nun mit Karl Ermann (Zweiter von links) und Walter Joelsen (rechts) zwei ihrer Vorgänger unter den Festgästen begrüßen. |
Glückwünsche überbrachte auch der „große Bruder“ Franz Leitner von der Katholischen Heilig-Kreuz-Kirche, der zugleich für seinen Oberaudorfer Kollegen Walter Hartmann sprach. Für die politischen Gemeinden ergriff Erich Ellmerer das Wort; der Kiefersfeldener Rathaus-Chef war ohne Geburtstagsgeschenk gekommen, sicherte dem Pfarrer-Ehepaar Nun stattdessen weiterhin ein offenes Ohr in Sachen Zuschüsse zu.
Mit Spezialitäten vom Grill und einem reichhaltigen Kuchenbüffet wurde nach dem Gottesdienst weitergefeiert. Neben einem Spieleparcours mit Stelzengehen, Eierlaufen und Dosenwerfen hatten die Organisatoren ein Gemeindequiz zur Kirchengeschichte zusammengestellt, für welches die Fotoausstellung im Gotteshaus wertvolle Tips lieferte. Darüber hinaus gewährte die Pfarrjugend einen Einblick in die Sitzungen des Kirchenvorstands – heute und vor 50 Jahren; während die Seniorengruppe eine Gymnastik-Vorführung einstudiert hatte. Den Abschluss bildete am späten Nachmittag eine Andacht, die die Musikkapelle Kiefersfelden stimmungsvoll gestaltete.
6. Juli 2005
| Anlass für den Bau einer Kirche war der schlechte Zustand des Oberaudorfer Betsaales. Es war so eng, dass die Konfirmation in zwei Schichten gefeiert werden musste, erinnerte der damalige Vikar Walter Joelsen in seinem Grußwort. Die Entscheidung für Kiefersfelden als Standort lag auf der Hand: Dort saß der Haupt-Sponsor, das Zementwerk. Einen weiteren Grundstock für den Neubau legte die politische Gemeinde Kiefersfelden mit der Schenkung des Grundstücks an der Thierseestraße mit 4362 Quadratmetern Baugrund. Der Traunsteiner Architekt Fritz von Kotzebue wurde mit den Plänen beauftragt, und am 31. Oktober 1954 wurde der Grundstein vom Rosenheimer Dekan Friedrich von Ammon gelegt. Dank zahlreicher großzügiger Spenden seitens der ortsansässigen Industrie und dem unermüdlichen Einsatz vieler Helfer ging der Bau flott voran, sodass die neue Kirche bereits am 26. Juni 1955 ihre Pforten für die Gläubigen öffnen konnte. Heute zählen die evangelischen Gemeinden um die Kiefersfeldener Erlöserkirche und die Auferstehungskirche in Oberaudorf rund 1580 Mitglieder. pil |
Von Marisa Pilger
Flintsbach - Auf den Hund gekommen sind die Flintsbacher Theaterer wahrlich nicht; auch wenn sich ihr aktuelles Stück „Sturm im Wasserglas“ um ein Zamperl dreht, das zwar selbst nicht auf der Bühne erscheint, letztlich aber eine Affaire ungeahnten Ausmaßes auslöst. Vielmehr bringt das Volkstheater in dieser Saison eine Komödie auf die Bühne, die weniger auf Situationskomik denn auf hintergründigen, bisweilen bittersüßen Humor setzt. Mit spürbarer Freude am Spiel und bemerkenswerter Textsicherheit auch in schwierigen Passagen haben die Flintsbacher am Samstag das Lustspiel von Bruno Frank, dessen Todestag sich heuer zum 60. Mal jährt, erstmals im Theaterstadl aufgeführt.
Der Regulator zeigt kurz vor halb sechs, aus dem Orchestergraben erklingt Piano-Musik - „Wochenend und Sonnenschein“; bei Viktoria Thoss im blauen Charleston-Kleid mit der typischen nach unten gerutschten Taille ist Teezeit. Doch schon bald wird die 20er-Jahr-Idylle durch den Besuch der Blumenfrau Kreszenz Vogl gestört: Wortreich in ihrer Verzweiflung und Traurigkeit schildert Michaela Goldes, die für eine Standlfrau erstaunlich gut lesen kann, ihren Kummer: Ihr Hund, der Tonerl, soll umgebracht werden - auf Geheiß von Viktorias Gatten, des Stadtrats Dr. Thoss.
| Eine liebenswerte Promenadenmischung, das Tonerl, soll von Amts wegen umgebracht werden, weil sein Frauchen die drastisch erhöhte Hundesteuer nicht mehr aufbringen kann; zumal der Umsatz an ihrem Blumenstand nach der Verlegung einer Straßenkreuzung stark zurückgegangen ist. Maßgeblich verantwortlich für diese kommunalen Entscheidungen ist Stadtrat Thoss. Der prinzipientreue Politiker arbeitet zielstrebig an seiner Karriere und steht kurz davor, vom Magistrat zum Bürgermeister gewählt zu werden. Doch dann deckt ein couragierter Journalist die Widersprüche zwischen den wohlklingenden Reden von Thoss und seinen Entscheidungen auf. Eine Veranstaltung mit Thoss als Hauptredner gerät zum Eklat. Der "Sturm im Wasserglas" bricht los. Es folgen Demonstrationen, Spendensammlungen, Paare trennen und finden sich. Schließlich kommt es zum Prozess, der für den Journalisten mit einem Tag Haft ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung endet. Zu seiner Hundekomödie "Sturm im Wasserglas" wurde Bruno Frank inspiriert, als der Münchner Stadtrat 1928 gegen den Willen der empörten Bürgerschaft die Erhöhung der Hundesteuer durchsetzen wollte. |
Für erfrischende Szenen sorgt auch immer wieder Lisa, die Frau des „Abendpost“-Herausgebers Ferdinand Quilling (Martin Obermair). Herrlich affektiert, dabei aber nicht überzogen, gibt Katharina Karrer die elegante und quirlige Unternehmersgattin, die bei ihrer bedächtigen Freundin Viktoria (Annthres Reiner) zwar hohe moralische Maßstäbe anlegt (etwa wenn die es wagt, alleine mit einem jungen Mann Tee trinken), dieser trotz allem aber den Mann ausspannt.
Fast schon naiv wirken dagegen die knappen Antworten des Journalisten Franz Burdach. Toni Obermair als idealistischer „Überzeugungstäter“ im besten Sinne hat den entlarvenden Artikel über Stadtrat Thoss nach Redaktionsschluss ins Blatt geschmuggelt und kann die Empörung über sein Handeln so gar nicht verstehen: Doch nur umso deutlicher kommt so die Selbstverständlichkeit zum Ausdruck, mit der der Reporter seiner selbstauferlegten Verpflichtung zur Wahrheit nachgekommen ist - auch um den Preis der eigenen Existenz.
Dass der bornierte Bürokrat und letzlich gescheiterte Bürgermeisterkandidat Dr. Konrad Thoss, dessen charakterliche Abgründe Spielleiter Peter Astner in seinem Part trefflich herausstellt, zum Schluss doch wieder auf die Füße fällt und einen Posten in einem Berliner Industrieunternehmen erhält, ist dabei nicht weiter verwunderlich.
Und so legte sich im Theaterstadl nach gut zwei Stunden der „Sturm im Wasserglas“ wieder, den das Premierenpublikum mit reichlich Applaus bedachte. Die Geschichte um Zivilcourage, Prinzipienreiterei und menschenverachtende Verwaltungsakte indes ist auch heute, gut 70 Jahre nach Entstehen des Luststpiels, noch immer brandaktuell.
17. Juni 2005
Samerberg (pil) – Andrea kam ohne Beine zur Welt. Mit vier Jahren machte sie ihre ersten Schritte auf Prothesen. Heute ist sie fast 17, reitet und schwimmt leidenschaftlich gerne. Allerdings hat die Samerbergerin für ihre Lieblingshobbys in den letzten Monaten nur noch wenig Zeit gehabt. Denn seit September arbeitet die Schwerbehinderte im Rathaus am Törwanger Dorfplatz – als erste Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten in der Gemeindegeschichte Samerbergs.
 |
| Von ihrer schweren Behinderung lässt sich Andrea Schrödl nicht unterkriegen. Auf Vermittlung von „Pro Arbeit“-Lehrstellenentwickler Günter Mauritz (links) arbeitet sie seit Herbst im Rathaus in Törwang – als erste Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten in der Samerberger Gemeindegeschichte. Von ihrem Fleiß und ihrer Motivation ist nicht nur ihr Chef, Bürgermeister Georg Huber, beeindruckt. Foto: pil |
Dass sie die Lehrstelle so nahe vor der eigenen Haustür im Grunde genommen der Initiative von Günter Mauritz zu verdanken hat, ist ihr durchaus bewusst. Der Lehrstellenentwickler vom Verein „Pro Arbeit“ engagiert sich seit mehreren Jahren in der Akquisition neuer Ausbildungsstellen – insbesondere für Jugendliche mit schwieriger Ausgangslage, denen nach der Schule oft genug der Schritt in die Arbeitslosigkeit bevorsteht. In Andreas Fall hatte er mehrmals beim Samerberger Bürgermeister vorgesprochen; und im Herbst 2003 stimmte schließlich der Gemeinderat geschlossen dafür, Andrea Schrödl als erste Auszubildende im Rathaus einzustellen. „Dabei hatten wir eigentlich gar keinen Bedarf.“, gibt Rathaus-Chef Georg Huber im Rückblick unumwunden zu.
An ihrem behindertengerechten Schreibtisch im ersten Stock des Rathauses lernt die Samerbergerin nun drei Jahre lang alle Abteilungen eines kommunalen Verwaltungsbetriebs – vom Einwohnermeldeamt übers Bauamt bis hin zum Sozialamt – kennen. Und dass das Treppensteigen bei ihr etwas länger dauert als bei ihren Kollegen stört niemanden. Im Gegenteil; mit „Hochachtung und Respekt“ erzählt Bürgermeister Huber vom Fleiß und von der Motivation seines Lehrlings.
Einen Teil der Kosten für die Ausbildung und die Einrichtung des Arbeitsplatzes – etwa für die Spezialmöbel – trägt dabei die Agentur für Arbeit. Einige Telefonate habe es auch gekostet, um durchzusetzen, dass Andrea diverse Unterlagen auf dem Laptop gespeichert zum Unterricht in die Berufsschule und die Verwaltungsschule mitbringen darf, anstatt jedesmal die schweren Aktenordner mitschleppen zu müssen, berichtet Mauritz.
Immer wieder schaut er im Rathaus vorbei; der regelmäßige Kontakt sowohl zu seinen „Schützlingen“ als auch zu deren Ausbildungsbetrieben stellt einen wesentlichen Bestandteil seines Betreuungskonzepts dar.
Doch auch die Familie unterstützt die Jugendliche tatkräftig. So hat die Mutter den täglichen Fahrdienst vom Heimatort Friesing - einem der 70 Ortsteile der Flächengemeinde - nach Törwang übernommen. Und zu Mittag essen kann die „Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten im kommunalen Bereich“ bei ihrem Onkel, dem „Entenwirt“.
Derweil hat Andrea bereits den nächsten Schritt ins Auge gefasst: Im August wird sie 17; dann will sie mit einer Sondergenehmigung den Führerschein in Angriff nehmen und möglichst bald selbst Auto fahren.
1. Juni 2005
Rosenheim (pil) – Die stetig wachsende Rate jugendlicher Arbeitsloser in Rosenheim bereitet Politikern wie Vertretern von Verbänden und Vereinen zunehmend Sorge. Dies zeigte sich einmal mehr bei der Kuratoriumssitzung des Vereins „Pro Arbeit“.
In „einem beängstigenden Maße“ sei vor allem die Zahl derjenigen Jugendlichen gestiegen, die ohne professionelle Unterstützung nur geringe Chancen auf eine Integration in den Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsmarkt hätten, betonte Vorsitzender Jürgen Krause in seinem Bericht. Umso mehr bedauerte er, dass mit der Umstrukturierung der Arbeitsämter in Agenturen für Arbeit sowie mit Hartz IV im vergangenen Jahr zwei wichtige Hilfsprojekte weggefallen seien: Neben der AQJ-Maßnahme (Arbeit und Qualifizierung für noch nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche) musste der Verein aus finanziellen Gründen auch den tip-Lehrgang (testen – informieren – probieren) einstellen. Vergleichbare Bildungsmaßnahmen schreibe die Bundesagentur für Arbeit überwiegend zentral und in so großen Losen aus, so dass relativ kleine Träger wie „Pro Arbeit“ von vorneherein durchs Raster fielen. Die auf 6000 Euro begrenzten LOS-Mikroprojekte im Rahmen der „Sozialen Stadt“ - wie etwa Deutschkurse - könnten, so wichtig sie im einzelnen sein mögen, die verlorenen Arbeitsfelder mit den Jugendlichen dabei nicht aufwiegen, gab Krause zu bedenken.
Auch die Zukunft des Ausbildungs- und Arbeitsstellenentwicklers, mit dem der Verein 1998 gestartet ist, sei bislang nicht gesichert. Krause zeigte sich in Anbetracht der kritischen Lage auf dem Lehrstellenmarkt aber zuversichtlich, dass die Arge der Stadt und die Arge des Landkreises hier Hilfestellung leisten werden. Darüber hinaus werde der Verein, auf dessen Arbeit Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer als Kuratoriumsvorsitzende „wahnsinnig stolz“ ist, auch weiterhin einen Teil der Kosten für die Stelle aus Spenden und Rücklagen finanzieren; schließlich habe Günter Mauritz in den vergangenen sieben Jahren bemerkenswerte Erfolge bei der Akquisition neuer Ausbildungsstellen insbesondere für schwache Schüler erzielt.
Nicht zuletzt verwies Krause auf die Aktivitäten an verschiedenen Schulen im Raum Rosenheim. So kann dort, wie bereits berichtet, dank eines Sponsoring-Vertrags mit der Sparkasse die Sozialarbeit ausgeweitet werden. Auf große Resonanz stoße auch die Ganztagsbetreuung an der Hauptschule Mitte, die „Pro Arbeit“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt anbietet. Die derzeitige Raumnot soll der geplante Anbau lindern, für den sich die Stadt Zuschüsse aus dem Bundes-Topf „Investitionen in Zukunft, Bildung und Betreuung“, kurz IZBB, erhofft.
15. Mai 2005
Rosenheim (pil) – Einen gewaltigen Anschub für die Jugendsozialarbeit an Schulen bedeutet der Sponsoring-Vertrag, den der Verein „Pro Arbeit“ mit der Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling eingeht. Der Vertragsabschluss, den das Kuratorium jetzt einstimmig befürwortete, ermögliche dem Verein, drei neue Vollzeitstellen für Sozialpädagogen zu schaffen und für fünf Jahre zu finanzieren, führte Vorsitzender Jürgen Krause bei der Sitzung erfreut aus. Damit, so Krause weiter, könne der bislang gemeldete Bedarf an sozialpädagogischer Betreuung an allen Rosenheimer Grund-, Haupt- und Förderschulen abgedeckt werden.
Die Sozialarbeit an bayerischen Schulen gelte zwar mittlerweile als ein „bildungspolitisches Muss“, betonte er. Allerdings sei die sukzessive Schaffung 360 neuer Stellen für Sozialpädagogen, die das Bayerische Sozialministerium im Jahr 2002 angekündigt hatte, nun größtenteils dem Sparkurs der Staatsregierung zum Opfer gefallen. Als einen umso größeren Glücksfall bewertet es daher Krause ebenso wie die Kuratoriumsvorsitzende, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, dass die Sparkasse künftig die Schulsozialarbeit von "Pro Arbeit" finanziell unterstützen will und bedankte sich insbesondere für den Vertrauensvorschuss.
Im Moment können die Hauptschule Mitte, die Volksschule Fürstätt und die gewerbliche Berufsschule I auf die Sozialpädagogen des Vereins zurückgreifen; im Landkreis laufen Projekte an der Berufsschule Bad Aibling, der Otfried-Preußler-Schule (Gemeinde Stephanskirchen) sowie der Grund- und Hauptschule in Neubeuern. Weitere Bedarfsmeldungen liegen bereits seit längerem vor.
8. Mai 2005
Aschau (pil) – Es sei – strenggenommen – zwar ein Thema für eine Jahreshauptversammlung. Trotzdem wollte Werner Zwingmann bei der Pflichthegeschau der Hegegemeinschaften 3 (Kampenwand), 4 (Chiemsee West), 5 (Simssee) und 6 (Halfing) nicht darauf verzichten, die Pressekampagne um angebliche Unregelmäßigkeiten des Jagdpräsidenten Dr. Jürgen Vocke aufs Schärfste zu verurteilen. Und nicht nur der Vorsitzende der Jägervereinigung Rosenheim brach in Aschau eine Lanze für Vocke, der dort im vergangenen Jahr auf dem Podium gestanden war; auch der stellvertretende Landrat Lorenz Kollmannsberger sowie der CSU-Landtagsabgeordnete Sepp Ranner, langjähriger Kollege Vockes im Agrarausschuss, stellten sich mit deutlichen Worten hinter den Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes und ernteten dafür reichlich Applaus in der Festhalle Hohenaschau.
 |
| Werner Zwingmann, der Vorsitzende der Jägervereinigung Rosenheim, mit Jagdberater Alois Lechner, Wildmeister Konrad Esterl, Jägervereinigungs-Vize Jakob Hündl, Wildmeister und Hegeringleiter Waldemar Ziegler (von links) und dem wohl jüngsten Besucher der Pflichthegeschau in Aschau, Jakob Hündl junior. Foto: Pilger |
Scharf schoss Ranner indes gegen die Vertreter der 68er-Generation, die derzeit in Berlin das Sagen hätten und die nunmehr den geprüften Jägern oder auch ihm, einem Landwirtschaftsmeister, Nachhilfeunterricht in Sachen Umweltschutz geben wollten. Nachdrücklich forderte er die Jäger auf, sich mit Imkern, Landwirten, Waldbauern und Fischern gegen die „Schreibtischtäter“ zu solidarisieren, um „zu verhindern, dass die Ideologen die Oberhand bekommen“. Schließlich sei „die Jägerei ein höhere Zunft“; ein Stück Heimatpflege, wie sich Kollmannsberger zuvor ausgedrückt hatte.
Auf einem „Weg in eine gute Richtung“ bewege man sich mittlerweile beim Rotwild, bilanzierte Gerhard Prentl, der Leiter der Unteren Jagdbehörde. Dies unterstrich auch Forstamtsdirektor Peter Fuhrmann als stellvertretender Leiter des Hegerings Kampenwand. Zwar sei der Bestand noch nicht sonderlich groß aber durchaus existenzfähig. Auf die Hege des Jägers sei das Rotwild jedoch nach wie vor angewiesen. Es sei schließlich der Mensch gewesen, der die Hirsche in einen der Art fremden Lebensraum gedrängt habe, merkte Fuhrmann an, der zugleich eindringlich davor warnte, das Wild als „Schadfaktor“ abzustempeln. Alois Lechner, Jagdberater für Hochwild, wies allerdings darauf hin, dass die Zahl der erlegten Hirsche außerhalb des Rotwildgebietes (neun männliche, zwei weibliche) eine Abwanderung gehörnter Tiere aus dem Rotwildgebiet nach sich ziehen könne. Insgesamt lagen im vergangenen Jahr die Abschussquoten in den Hegeringen 3, 4, 5 und 6 beim Rot-, Reh- und Gamswild zwischen 80 und 91 Prozent.
Sorge bereitet dagegen die Ausbreitung des Schwarzwilds. So wurde im vergangenen Jagdjahr bei Vogtareuth ein Frischling erlegt. Prentl: „Da müssen wir verdammt aufpassen“. Eine Auffassung, die Konrad Esterl als bekennender „Anhänger des Schwarzwilds“ durchaus teilt. 14 Jahre hatte der Berufsjäger mit den Schwarzkitteln im Ebersberger Forst verbracht. In Aschau berichtete er ausführlich von seinen Erfahrungen mit den Wildschweinen als ebenso intelligenten wie fruchtbaren Tieren mit einem ausgeprägten Sozialleben. Fazit des Wildmeisters, der seine Erinnerungen auch in Buchform herausgebracht hat: Zwar gebe es keine Norm für die Größe einer Population, aber „es dürfen nicht zu viele sein!“.
Politiker wie Behördenvertreter hoben darüber hinaus die beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Jägern, Waldbauern und Ämtern hervor, welche auch Sepp Spann, der Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Rosenheim, bescheinigte. Keine Frage, dass alle Verantwortlichen auch nach dem 1. Juli, dem Stichtag für die Reform der Forstverwaltung, auf Erfolge durch ein gutes Miteinander bauen.
Die Auswirkungen der Reform umriss Dr. Georg Kasberger, der Chef des Forstamts Wasserburg, der dann in der Rosenheimer Bahnhofstraße die Leitung des Bereichs Forsten im neuen Amt für Landwirtschaft und Forsten (ALF) übernimmt. Seine neue Behörde ist für 45.000 Hektar Wald im Landkreis Rosenheim (davon 10.000 Hektar Staatswald) zuständig; ihr fallen Aufgaben zu, die sich bislang die Forstämter in Wasserburg und Rosenheim geteilt haben, wie etwa die Vegetationsgutachten, die als Grundlage für die Abschusspläne dienen. Ebenso übernähmen die ALF einen großen Teil der Arbeit der Forstdirektionen, die ersatzlos aufgelöst werden; Rosenheim sei demnach künftig bayernweite Anlaufstelle für die Ausbildung zum Berufsjäger. Weil aber noch nicht alle Details des Behördenumbaus bekannt seien, bat Kasberger um Verständnis, falls der Betrieb zum 1. Juli noch nicht reibungslos laufe.
Neben der Wildfütterung in Notzeiten, dem Winterverbiss und der wachsenden Gefahr durch den Fuchsbandwurm sprach Zwingmann aus aktuellem Anlass einmal mehr die sichere Aufbewahrung der Jagdwaffen an. Und der Aschauer Bürgermeister Kaspar Öttl brachte einmal mehr seinen Wunsch im Hinblick auf den Wildbestand in den heimischen Wäldern zum Ausdruck: „Es darf gern ein bissl mehr sein.“
7. Mai 2005
Von Marisa Pilger
Rosenheim – Nicht einmal die Hälfte Weges hat hinter sich gebracht, wer den Zeitpunkt von Christi Geburt passiert; denn der Weg zurück ins Reich der Alten Ägypter ist lang – 45 Meter lang. Buchstäblich Schritt für Schritt - pro Meter 100 Jahre – kommen die Zeit-Reisenden ihrem Ziel näher, bevor sie schließlich in der Zeit der Pharaonen ankommen: Bis zum 25. September stehen der Totenkult und die Techniken des Pyramidenbaus im Mittelpunkt der Ausstellung „Die Pyramide – Haus für die Ewigkeit“, die ab Samstag, 30. April, im Rosenheimer Lokschuppen zu sehen ist.
Innerhalb weniger Wochen hatte dort das bisweilen vierköpfige Bau-Team Wände gezogen und Säulen gesetzt. In den letzten Tagen vor der Eröffnung dominiert die Feinarbeit: Da wird ein Sockel korrigiert, dort werden Statuetten anders in den Vitrinen verteilt. Die Beleuchtung muss eingerichtet und die Täfelchen mit den Begleittexten zu den rund 300 Exponaten angebracht werden. Und in allen Ecken warten Kisten und Kartons mit orangefarbenen „empty“-Aufklebern darauf, weggeräumt zu werden.
Das Meisterwerk des Teams ist ohne Zweifel die 4,40 Meter hohe Nachbildung der Cheops-Pyramide im Maßstab 1:33; das „möglicherweise weltweit größte Modell“, wie Ausstellungsgestalter Michael Quest mutmaßt, ermöglicht zudem einen Einblick ins innere Gang- und Kammersystem. Jeder einzelne Steinquader des Jahrtausende alten Monuments mit einer Original-Grundfläche von 230 Meter mal 230 Meter ist dabei optisch dargestellt. Zu diesem Zweck haben die Arbeiter Linien mit einer Gesamtlänge von 5,3 Kilometer in den Kunststein graviert. Styroporne „Fels“-quader in Originalgröße sollen den Betrachtern darüber hinaus eine Vorstellung von den ungeheuren Ausmaßen der Himmelstürme vermitteln - und eine Ahnung vom Gewicht der Bausteine. Transportwege, Geräte und handwerkliche Techniken sowie die Entwicklungsstufen der Grabmäler im Reich der Pharaonen bilden den Schwerpunkt der Ausstellung.
 |
| Auch Bohrer, zum Teil mit Bohrköpfen aus Kupfer, gehörten zum Handwerkszeug der alten Ägypter. Mit der Montage der Ausstellungsstücke – von wertvollen Alabastergefäßen bis hin zu Steinreliefs - ist Restaurator Oliver Schacht betraut. Foto: Pilger |
Auch Restaurator Oliver Schacht, zuständig für die Objektmontage, hat bis zur Eröffnung noch alle Hände voll zu tun. In sein Ressort fällt die Sicherung der bis zu 130 Kilogramm schweren Steinreliefs ebenso wie die Präsentation der verschiedenen Werkzeuge aus dem Alten Ägypten. Großen Wert legt Schacht dabei auf die didaktische Präsentation der Exponate sowie auf deren nicht sichtbare Sicherung.
Die kann man sich bei dem schlichten Steinsarkophag aus Aswan-Granit wohl sparen. 5,2 Tonnen bringt das Schwergewicht der Ausstellung aus der Zeit des Mykerinos (zirka 2540 bis 2511 vor Christus) auf die Waage; den Sinn des Griffes an der Stirnseite des Sarkophags, der im Frühjahr 1929 auf dem Friedhof von Gizeh in 20 Meter Tiefe freigelegt worden war, kann sich Restauratorin Susanne Frowein allerdings nicht erklären. Immerhin musste für den Transport vom Römer&Pelizaeus-Museum in Hildesheim nach Rosenheim eine Spezialpalette angefertigt werden. Und im Lokschuppen entwickelte ein Statiker eigens eine Unterkonstruktion, damit der Terrakotta-Boden in der Ausstellungshalle, der nur mit 500 Kilogramm pro Quadratmeter belastet werden darf, bis 25. September nicht in die Knie geht.
Dass die Häuser für die Ewigkeit ebenso wie die Stein- und Holzsarkophage, Statuetten und Reliefs die letzten 4500 Jahre mehr oder weniger gut überstanden haben, mag noch nachvollziehbar sein. Das Leinenkleid aus der Zeit um 2100 vor Christus stellt für Frowein indes eine ganz besondere Kostbarkeit dar; sehr schmal, glaubt sie, muss die Frau gewesen sein, für die das Kleid bestimmt war.
Hautnahe Erfahrung mit dem Totenkult in der ägyptischen Hochkultur vermittelt nicht zuletzt die originalgetreue Rekonstruktion einer Grabkammer sowie ein verkleinertes Holz-Modell der 42 Meter langen Totenbarke des Pharao Cheops.
Doch auch der Faszination rund um die Pyramiden, die sich Ende des 18. Jahrhundert vor allem durch den Ägyptenfeldzug Napoleons zu einer richtiggehenden Ägyptomanie steigerte – trägt die Ausstellung Rechnung. Unter diesem Gesichtspunkt haben die Gestalter – mit etwas Augenzwinkern – ihre Phantasie im letzten Raum spielen lassen: Ein Blickfang, den genauer zu betrachten lohnt, bevor sich dem Besucher die Tür zurück ins Jahr 2005 öffnet.
28. April 2005
Öffnungszeiten
Die Ausstellung "Die Pyramide - Haus für die Ewigkeit" im Rosenheimer Lokschuppen läuft bis Sonntag, 25. September. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, an den Sams-, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Sonderöffnungen sind auf Anfrage möglich.Darüber hinaus wird wieder ein umfangreiches museumspädagogisches Programm angeboten. Weitere Auskünfte unter Telefon 08031/3659036. |
Rosenheim (pil) – Auf ein arbeitsreiches Jahr blickt der Kinderschutzbund Rosenheim zurück. 2004 war den Ausführungen von Geschäftsführerin Maria Klausner zufolge vor allem geprägt von den Vorarbeiten für die Trägerschaft des Jugendhilfe-Pilotprojekts Sozialraum Nord. Breiten Raum nahmen bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag zudem die Aktivitäten im Familienzentrum Burgau in Wasserburg sowie das Elterntelefon ein, das seit Februar 2004 geschaltet ist und wo während der ersten elf Monate bereits 186 intensive Beratungsgespräche registriert wurden. Allerdings, räumte Klausner ein, seien die umfangreichen Investitionen nicht spurlos an der Kasse des Kinderschutzbundes vorübergegangen, zumal auch das Spendenaufkommen rückläufig sei.
„Visionen“ und Hilfe zur Selbsthilfe will der Kinderschutzbund künftig vorort den Jugendlichen im Sozialraum Rosenheim-Nord geben. Diplom-Sozialpädagogin Renate Plesch veranschaulichte in ihrer Präsentation erste Überlegungen, wo die Hebel für eine dauerhafte Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche im Gebiet zwischen Kaiserstraße, Egarten und Wehrfleck angesetzt werden könnten. Die Kooperation mit dem Jugendamt übernimmt der Kinderschutzbund dabei gemeinsam mit zwei weiteren Trägern, der Katholischen Jugendfürsorge und der Stiftung St. Zeno, unter dem Dach einer gemeinnützigen GmbH.
Die Regionalisierung der Jugendhilfe („Raus aus den Ämtern, rein in die Viertel.“) begrüßt auch Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, die dem Kinderschutzbund insgesamt eine „großartige Arbeit“ bescheinigte. Vertreter des Landkreises hatten sich zu Klausners Enttäuschung allerdings nicht im Schüler- und Studentenzentrum an der Pettenkoferstraße eingefunden. Dabei seien gerade die Entscheidungen hinsichtlich der Regionalisierung im Landkreis – der Kinderschutzbund hat sich dort um eine Trägerschaft für Rosenheim/Umgebung, Chiemgau und Wasserburg beworben – für die Einrichtung zukunftweisend.
Von den spürbaren Erfolgen im vor eineinhalb Jahren eröffneten Familienzentrum im Wasserburger Stadtteil Burgau berichtete Leiterin Gaby Waitz: 25 bis 35 Kinder und Jugendliche verschiedenster Nationen nutzten mittlerweile das nachmittägliche offene Angebot; etwa ein Dutzend Familien komme regelmäßig ins Café. Besonderen Wert legt die Diplom-Sozialpädagogin dabei auf gewaltfreien Umgang unter den Jugendlichen.
 |
| Franz-Josef Würfl (Dritter von links) will auch nach seiner Pensionierung noch „etwas Sinnvolles tun“. Ohne Gegenstimmen wurde der 65jährige am Dienstag als Beisitzer in den Vorstand des Kinderschutzbundes Rosenheim gewählt. Über die Verstärkung freuen sich Beisitzerin Ingrid Graue, Vorsitzende Hella Rabbethge-Schiller, Beisitzer Karlheinz Rieger, Geschäftsführerin Maria Klausner und Beisitzerin Evelin Zettl (von links). Foto: pil |
Als „kleines Bürgerhaus“, bezeichnete Maria Klausner die Anlaufstelle des 450 Mitglieder zählenden Vereins in der Färberstraße in Rosenheim. Allein 8354 Anrufe seien letztes Jahr am Kinder- und Jugendtelefon angenommen worden; knapp ein Viertel mündete in Beratungsgesprächen.
Große Nachfrage bestehe auch bei der Elternschule „Fit für Kids“, die in den letzten sechs Jahren mehr als 1000 Teilnehmer aus Stadt und Landkreis aufgesucht hätten, und in der, wie Klausner betont, 79 ausgebildete Kursleiter wichtige Präventionsarbeit im Bereich der Jugendhilfe leisten. Besondere Beachtung schenkte sie darüber hinaus dem Engagement von Inge Wolf, durch das im Oktober eine Selbsthilfegruppe für Eltern von ADHS-Kindern ins Leben gerufen worden ist.
Auch den Part der erkrankten Lea Merl übernahm Klausner: Rund 569.000 Euro an Umsatzerlösen verzeichnet der Bericht der Schatzmeisterin; die Geschäftsführerin wies dabei unter anderem auf die „enorme Steigerung“ von 12.000 auf 33.000 Euro bei der Beratungsstelle hin. Allein 18 Fälle sexuellen Missbrauchs hätten die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes im Auftrag der Jugendämter im vergangenen Jahr abgeklärt. Bitter sei jedoch der Rückgang der Spenden von 47.000 Euro in 2003 auf rund 29.000 Euro. Doch Dank des Engagements von Annette Werndl seien aus verschiedenen Benefizveranstaltungen letztes Jahr zusätzlich 10.000 Euro in die Kasse geflossen. Alles in allem bleibe unterm Strich jedoch ein Fehlbetrag von gut 16.000 Euro, der aus den Rücklagen abgedeckt werden muss.
Eine der tragenden Säulen des Kinderschutzbundes stellen nach wie vor die Ehrenamtlichen dar. Als Dankeschön für den Einsatz der rund 90 Helfer, kündigte Vorsitzende Hella Rabbethge-Schiller an, sei bereits ein Fest Planung.
21. April 2005
Stephanskirchen (pil) – „Happy times“ lässt Marc O' Polo mit seiner neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion anbrechen: Leichte, frische Farben, duftige Blumenmuster und helle Brauntöne von caramel bis crème herrschen bei den Damen vor, bei der Herrenmode setzen die Stephanskirchener in dieser Saison auf einen Mix aus kräftigen Farben und Pastelltönen.
 |
Dabei verzeichnet das Unternehmen unter dem Vorstandsvorsitz von Werner Böck in den vergangenen Jahren eine stetige Umsatzsteigerung: Wurden im Geschäftsjahr 2000/2001 im Großhandel (inklusive Lizenzen) insgesamt 142 Millionen Euro umgesetzt, waren es drei Jahre später bereits 154 Millionen Euro. Foto: pil
28. März 2005
Von Marisa Pilger
Rosenheim/Raubling – Die Stimmung im Schulungsraum der BTG in der Oberaustraße ist recht entspannt. „Am Anfang wusste ich nicht mal, wo man die Kiste einschaltet.“, erzählt einer der ehemaligen Mitarbeiter der SDB Holzhandels GmbH in Raubling (vormals Aicher), die zum Jahreswechsel in Konkurs gegangen ist. Jetzt sitzt der 45jährige am Computer und durchforstet mit seinen „Kollegen“ die Jobbörsen im Internet. Insgesamt sind 41 ehemalige SDB-Mitarbeiter von der gemeinnützigen Betreuungs- und Trainingsgesellschaft BTG in Rosenheim vor dem direkten Absturz in die Arbeitslosigkeit aufgefangen worden; die Hälfte davon hat bereits nach sechs Wochen eine neue Beschäftigung gefunden, beziehungsweise steht kurz vor dem Abschluss eines Arbeitsvertrages.
 |
| Nach anfänglichen Berührungsängsten versammeln sich die Teilnehmer des BTG-Projekts nun regelmäßig vor dem Computer, um die Jobbörsen im Internet zu durchforsten. Eine Entwicklung, die BTG-Geschäftsführer Hannes Haubner (links) und die beiden Coaches Klaus-Joachim Kuchenbecker (2. von links) und Herbert Maurer (5. von links) mit Zufriedenheit verfolgen. Oberstes Ziel der Fördermaßnahme sei schließlich, den Betroffenen wieder zu einer Arbeitsstelle zu verhelfen. Foto: Pilger |
Zwischen 60 und 67 Prozent des früheren Netto-Einkommens zahlt die Agentur für Arbeit in dieser Zeit als Transfer-Kurzarbeitergeld, das die BTG auf 80 Prozent aufstockt. Der Betroffene muss sich derweil zwar als arbeitssuchend melden, geht aber nicht als Arbeitsloser in die Statistiken ein.
Wie lange ein Auffang-Projekt läuft - im Fall der SDB fünf Monate - hängt von der Summe ab, die dafür im Sozialplan des jeweiligen Unternehmens eingestellt wurde, beziehungsweise vom Insolvenzverwalter freigegeben wird. Aus diesem Topf werden auch die Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) gezahlt. Wechselt ein Arbeitnehmer vorzeitig zu einem neuen Arbeitgeber, erhält er seinen Anteil der nicht verbrauchten Zahlungen.
“Wir wollen die Leute vor dem Sturz in das tiefe schwarze Loch der Arbeitslosigkeit bewahren.“, erklärt Haubner und weiß, wovon er redet: 30 Jahre lang war der kaufmännische Bereichsleiter bei Kettner beschäftigt gewesen, als sein Unternehmen 1997 Insolvenz anmelden musste. Der Konkurs des Verpackungsmaschinen-Fabrikanten war damals zugleich der Startschuss für die BTG: Die Kettner-Leute sollten sozialverträglich aufgefangen werden, so auch Haubner. Dort ist er schließlich hängengeblieben; zunächst als Projektleiter, und seit zwei Jahren führt er die Geschäfte der gemeinnnützigen GmbH. Begleitet wird die Gesellschaft von einem Beirat aus Vertretern von Stadt, Landratsamt, IG Metall, der Kreishandwerkerschaft und der IHK sowie dem Kettner-Insolvenzverwalter.
| In der Vergangenheit hat die BTG unter anderem ehemalige Mitarbeiter von Hain Natur-Holz-Böden in Rott, SZ Testsysteme Amerang und Stahlbau Wolf Rosenheim betreut, die Projekte Wacker Siltronic, Wasserburg, und Sport Scheck, Otterfing, laufen noch. Insgesamt, zieht Haubner zufrieden Zwischenbilanz, haben seit 1997 etwa drei Viertel aller Teilnehmer die BTG mit einem neuen Arbeitsvertrag in der Tasche verlassen. Ähnlich erfolgreich sei mit einer 60-Prozent-Quote die „Zeitbrücke“ verlaufen, ein dreijähriges Projekt für die Wiedereingliederung von 189 Arbeitslosen über 50 Jahre. |
Von den 41 ehemaligen SDB'lern hat sich mittlerweile die Hälfte von ihren beiden Trainern Herbert Maurer und Klaus-Joachim Kuchenbecker so gut wie verabschiedet: Einige haben bereits neue Arbeitsverträge. Acht weitere durchlaufen derzeit eine „praktische Qualifizierung“ bei der neugegründeten Aicher-Holz HwF GmbH in Raubling, die einen Teil der Geschäfte der ehemaligen SDB (vormals Aicher) abdeckt; dort sollen in den kommenden Wochen die Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Ein anderer will sich selbständig machen - in seiner vertrauten Branche, dem Holzhandel.
Doch auch der Rest ist zuversichtlich, dass es bis Projektende am 31. Mai mit einer neuen Stelle klappt und zeigt sich angetan von der Betreuung durch ihre Trainer. Das, so bringt es der 45jährige aus der Verpackungsabteilung auf den Punkt, sei auf jeden Fall besser, als gleich zum Arbeitsamt zu gehen.
8. März 2005
Rosenheim (pil) – „Wie geht es wieder aufwärts mit Deutschland?“ Diese Frage entwickelte sich zum zentralen Thema beim jüngsten Treffen der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU), Regionalkreis Südostbayern, in Rosenheim. Die „Auswirkungen der Landespolitik auf unsere Region“ als ursprünglich angepeilter Schwerpunkt rückten nach dem Einführungsreferat des CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Stöttner zwar in den Hintergrund. Umso mehr Diskussionsstoff lieferten dafür die deutsche Reglementierungswut sowie die Folgen der hohen Lohnzusatzkosten und vor allem des eisernen Sparkurses der Bayerischen Staatsregierung.
Für eine dauerhafte Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland aber, so der Tenor des gut zweistündigen Gedankenaustauschs, müsse vor allem das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Bedeutung heimischer Betriebe gestärkt werden. Bereits für die Schulkinder sollten Betriebsbesichtigungen und Praktikumswochen in ortsansässigen Unternehmen auf dem Stundenplan stehen. Doch auch bei den Geschäftsleuten müsste in dieser Hinsicht der „Patriotismus geschürt“ werden. Schließlich stünde deutsches Unternehmertum nach wie vor für hochqualifizierte Arbeitskräfte und international anerkannte Qualität. Allein, der Faktor Arbeit ist in Deutschland zu teuer.
Dass es um die wirtschaftliche Situation in der Region Rosenheim unterdessen recht gut bestellt ist, belegte Stöttner, Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr, anhand einiger Zahlen: 2002 wurde hier ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als 7,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. In der gewerblichen Wirtschaft wurden zwischen 1994 und 2003 mit Zuwendungen in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro Investitionen von über 111 Millionen Euro angestoßen. Auf diese Weise wurden 515 Stellen neu geschaffen, 1100 Arbeitsplätze gesichert. Zudem seien im Rahmen des Bayerischen Mittelstandskreditprogramms in den letzten zehn Jahren rund 1300 neue Arbeitsplätze entstanden. Und mit 7,2 Prozent (Stand Januar 2005) liege die Arbeitlosenquote in der Region noch unter dem ohnehin niedrigen Landesdurchschnitt (8, 9%).
Für Unmut sorgt indes die Flut an Reglementierungen und EU-Verordnungen, der nach Ansicht der Anwesenden gerade im Freistaat nicht mit der vielbeschworenen bairischen Gemütlichkeit begegnet, sondern rasch mit deutscher Gründlichkeit umgesetzt werde. Dagegen wünschen sich die Geschäftsleute - neben größerer Freiheit bei der Arbeitszeitregelung in ihren Betrieben - die konsequente Überwachung einiger sinnvoller Gesetze, um für alle Unternehmer die gleichen Voraussetzungen zu schaffen und die nötige Flexibilität zu gewährenleisten.
Unverhohlen wurde auch Kritik geübt an den Auswüchsen des Vereins- und Verbandswesens; die Zwangsmitgliedschaft bei IHK beziehungsweise Handwerkskammer stößt einigen der Selbstständigen besonders sauer auf. Sogar von einer „Diktatur der Verbände“ war die Rede, die nicht selten längst überfällige Reformen bereits im Keim ersticke. Ein Vorwurf an die Adresse der Politik, den der Abgeordnete Stöttner nicht ganz entkräften konnte.
Mehr Sorgen aber bereitet den Geschäftsleuten der Sparkurs, den die Staatsregierung zur Sanierung des Haushalts eingeschlagen hat. Unstrittig ist, dass ein Umbau des Sozialstaates überfällig ist. Doch selbst Ersatz-Investitionen wie die Sanierung maroder Straßen lägen derzeit auf Eis, weil der Freistaat keine weiteren Schulden machen wolle. Die Folge: Der Staat zehrt von seiner Substanz und wird, so die Befürchtung, „totgespart“. Übereinstimmend forderten die ASU-Mitglieder die Politiker auf, die Konjunktur gerade in Tiefphasen anzukurbeln und so vor allem auch für die freie Wirtschaft ein Signal zu setzen.
Der Staat, verteidigte Stöttner den Kurs im Maximilianeum, könne nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen rechnen, und hoffe seinerseits auf Impulse aus der Wirtschaft. Ein wahrhafter Aufbruch allerdings müsse seiner Ansicht nach von drei Säulen getragen werden: „Mehr Leistung, mehr Eigenverantwortung und vor allem weniger Staat“.
28. Februar 2005
| Als Verband für Unternehmer wurde die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer (ASU) im Jahr 1949 gegründet. Heute gehören der Interessensvertretung (mit ihrer Teilorganisation für bis 40jährige, dem Bundesverband Junger Unternehmer, BJU) rund 6500 Eigentümer- und Familienunternehmer an. Diese sind in 50 Regionalkreisen organisiert; einer davon ist der „Regionalkreis Südostbayern“ unter dem Vorsitz des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers Dr. Josef Deindl. Regelmäßige Treffen fördern den Erfahrungsaustausch innerhalb der ASU, die sich als „Speerspitze des selbständigen Unternehmertums“ versteht. Die Mitglieder der ASU beschäftigen 1,7 Millionen Mitarbeiter und erzielen einen Jahresumsatz von mehr als 100 Milliarden Euro. Sie kommen aus allen Branchen und Betriebsgrößen und repräsentieren den unternehmerischen Mittelstand. 28. Februar 2005 |
Von Marisa Pilger
Rosenheim/Rohrdorf – Es ist absolutes Neuland, das sechs oder sieben Vorschulkinder aus dem Petö-Kindergarten „Sonnenschein“ im September betreten werden. Umso mehr Hoffnungen knüpfen die Eltern vom Konduktiven Förderzentrum an den bayernweit einmaligen Pilotversuch in Rohrdorf, der es behinderten Kindern ermöglicht, den Besuch einer Regelschule mit der Behandlung nach dem Therapie-Konzept des ungarischen Professors Andras Petö zu verbinden.
Die erwartungsvolle Spannung, die mit diesem Vorhaben einhergeht, war auch am Wochenende bei der Einweihung der neuen „Sonnenschein“-Räume in Oberwöhr deutlich spürbar. Welch immense Bedeutung vor allem die betroffenen Eltern dem Schulprojekt beimessen, brachte Siegfried Weisbach, Initiator des Rosenheimer Spezialkindergartens, auf den Punkt: „So haben unsere Kinder auch nach dem Kindergarten eine Perspektive.“
Hemmschwellen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten sollen abgebaut werden und die Petö-Kinder schrittweise und und soweit wie möglich in den normalen Schulbetrieb integriert werden. „Davon werden alle Beteiligten profitieren.“, ist der Rohrdorfer Rektor Wolfgang Zeller überzeugt. Die gesunden Kinder sollen dabei aber auf keinen Fall im Lernen beeinträchtigt werden, betont Stephan Schlatzer, einer der Mitstreiter der betroffenen Eltern.
Zwei Räume stehen den überwiegend spastisch gelähmten Erstklässlern ab September in der behindertengerecht gebauten Rohrdorfer Schule zur Verfügung. Doch Treppenstufen stellen ohnehin kein unüberwindbares Hindernis dar: keines der „Sonnenschein“-Kinder sitzt im Haus im Rollstuhl. Erste Kontakte zu anderen Schülern sollen die Behinderten während der Pausen knüpfen, im nächsten Schritt in einer Art „begegnender Unterricht“ zum Beispiel an den regulären Musikstunden teilnehmen und später - je nach Fähigkeit – auch in anderen Fächern wie Mathe mitlernen. Auch bei der Fortbildung der Rohrdorfer Lehrkräfte werde die Petö-Therapeutik künftig eine nicht unerhebliche Rolle spielen, kündigte Rektor Zeller an.
Nach einer Info-Veranstaltung des Konduktiven Förderzentrums hatten gleich mehrere Schulleiter aus dem Landkreis Interesse an dem Modell-Projekt bekundet, erzählt Siegfried Weisbach. Die Wahl fiel dann schließlich auf Rohrdorf; wo auch Bürgermeister Fritz Tischner sofort für das Vorhaben zu gewinnen war.
Organisatorisch gehört die Integrationsklasse zum Privaten Förderzentrum Aschau, das die sonderpädagogische Lehrkraft (15 Stunden pro Woche) und den Konduktor (10 Wochenstunden) stellt. Zudem habe sich das Kultusministerium mittlerweile dazu bereit erklärt, die Finanzierung des Petö-Konduktors, zu übernehmen, teilte die Kolbermoorer CSU-Bundestagsabgeordnete Daniela Raab, Schirmherrin des Kindergartens, am Rande des Einweihungsfestes mit.
Nach Auskunft des Aschauer Sonderschulrektors Josef Eberl wird der auf zunächst vier Jahre befristete Modellversuch von der Uni Würzburg wissenschaftlich begleitet, und zwar vom dortigen Lehrstuhl für Körperbehindertenpädagogik.
15. Februar 2005
Grundlagen der Konduktiven Bewegungstherapie
Der lateinische Begriff "conducere" steht für "zusammenführend". Bei der Petö - Methode handelt es sich um eine Gruppentherapie, bei der die Kinder in möglichst homogenen Einheiten zusammengefasst werden. Gemeinsam mit den Eltern und dem Arzt erarbeitet der Konduktor für die Kinder Ziele und Inhalte. Der ungarische Arzt und Pädagoge Prof. András Petö baute seine Arbeit auf dem Prinzip der ganzheitlichen Betreuung des Kindes auf. Leitgedanke war, dass es sich bei Cerebralschädigungen nicht um eine Krankheit, sondern eine Lernstörung handelt, die neben der Motorik die gesamte Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt.
Zusammenführend sind auch die Methoden: Erkenntnisse aus der Neurophysiologie, Neuropsychologie, Physio- und Ergotherapie, Logo- und Monotherapie, Heil-, Sonder-, Vorschul-, Grundschul- und Sozialpädagogik fließen in den Therapieplan ein. Der Tagesablauf ist in einen festen Stundenplan eingeteilt und wird täglich zu gleichen Zeiten durchgeführt. Mit verschiedenen Programmen werden immer wieder Bereiche aus der Grob- und Feinmotorik, Hand- und Fußgeschicklichkeit, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Lebenspraxis und sozialem Lernen geübt.
Nach dem Motto, das bereits Maria Montessori postulierte "zeige mir, es selbst zu tun" werden die Kinder zum möglichst selbständigen Tun angeregt. Sie erhalten nur soviel Hilfestellung wie nötig. |
 |
| „Handwerk – Stellenwert in der Gesellschaft“ war der Vortrag von Abt Odilo Lechner überschrieben. Für den musikalischen Rahmen beim Handwerker-Frühschoppen sorgte die „Moosbach-Musi“. Foto: pil |
Es waren keine neuen Erkenntnisse, die der Benediktiner vortrug. Vielmehr kam der frühere Abt der Klöster Andechs und St. Bonifaz (München) in seinem gut 45minütigen Vortrag immer wieder auf die weit mehr als 1000 Jahre alten Benediktus-Regeln zu sprechen: Für jeden einzelnen müsse in allen Bereichen – beim Trinken ebenso wie beim Arbeiten – das rechte Maß gefunden werden; je nach Bedürfnis für den einen mehr, für den anderen weniger. Über die Arbeit – gleich welcher Art - etwa könne der Mensch die Welt mitgestalten; jedoch sollte niemand unter der Last seiner Arbeit zusammenbrechen müssen.
Einen maßvollen Ausgleich im Widerstreit zwischen Kollektivismus und Individualismus zu schaffen, führte der 73jährige als die eigentliche Aufgabe der Menschheit im 21. Jahrhundert an. Zwar sei der Mensch als Individuum wichtig; doch lebe der nicht für sich allein, sondern in einem Ganzen, für das jeder einzelne Mitverantwortung trage. Gerade die Flutkatastrophe in Südostasien habe aufs Deutlichste gezeigt: „Wir sind eine Welt.“
Seinem Vorredner Max Gimple hielt der Altabt - und seit 2003 Ehrendoktor der theologischen Fakultät der LMU München - augenzwinkernd entgegen, auch der Heilige Benedikt sei in gewisser Weise ein 68er gewesen; denn jener habe nicht zuletzt drei Jahre lang in einer Höhle gehaust, um nach „großen Alternativen“ für die Einheit des Lebens zu suchen. Der Landrat hatte zuvor in seinem Grußwort die Vertreter der 68er-Bewegung aufs Korn genommen, die nunmehr das politische Sagen in Berlin hätten und eine geistige Auseinandersetzung mit den Grundanforderungen gesellschaftlichen Beisammenseins vermissen ließen. Ungeschoren ließ CSU-Mann Gimple auch das bürgerliche Lager der Opposition nicht, das offenkundig nicht in der Lage sei, diese Auseinandersetzung mit der Regierung zu führen. Umso mehr erhoffte sich der Landrat die „Geburtsstunde eines neuen Denkens“. Er zollte darüber hinaus dem Kreishandwerksmeister Georg Lindauer Respekt für dessen „mutige“ Entscheidung, anstelle verbandsspezifischer Fragen ein gesellschaftspolitisches Thema in den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen.
Der Einladung zum wiederbelebten Frühschoppen indes war kaum ein Zehntel der Angeschriebenen gefolgt. Als Ehrengäste hatten sich unter anderem Alois Schuster aus Rosenheim, Ehrenobermeister der Schreiner-Innung, MdB Daniela Raab, ihr Kollege Wolfgang Zeitlmann, die Landtagsabgeordneten Klaus Stöttner, Adolf Dinglreiter und Sepp Ranner, der Stephanskirchner Bürgermeister Rudolf Zehentner und der Rosenheimer Vize Anton Heindl eingefunden sowie Vertreter von Berufsschulen, FH und Handwerkskammer.
Gut ein Viertel der 60.000 Beschäftigten im Landkreis Rosenheim sei im Handwerk tätig, fasste Gimple die Situation des oftmals „unterschätzten Riesen“ (Lindauer), in Zahlen. Und allen Widrigkeiten wie der unerfreulichen Debatte um die Meisterberufe oder die Ausbildungsplatzabgabe zum Trotz sieht der Kreishandwerksmeister den Mittelstand „noch ganz gut am Leben“.
15. Januar 2004
 |
| Wer in den Stall kommt, wird neugierig umringt. Rund 25 Wochen alt sind diese Exemplare für die Direktvermarktung, die in einem eigenen Stall untergebracht sind und demnächst mit dem sogenannten „Ohrenscheibenschnitt“ geschlachtet werden. Insgesamt verkaufen die Aschauers einige hundert der 27.000 Truthähne, die sie jährlich mästen, ab Hof – zerlegt oder im Ganzen. Charakteristisch für ausgewachsene Truthähne: Der blaue Kopf, der rote Kehlsack und die Nase, die bei Aufregung zu einem langen schmalen Rüssel anschwillt. |
Von Marisa Pilger
Tuntenhausen – Schon das Türschild der Familie Aschauer gibt Auskunft über die Stallbewohner in Schwaig. Stellvertretend für die 9000 Truthähne auf dem Anwesen bei Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) prangt ein Keramik-Exemplar im Kleinformat auf dem Oval neben dem Eingang.
Bereits 1987, als Franz Aschauer den Hof übernahm, setzte der heute 42jährige parallel zur Milchvieh-Wirtschaft auf Putenmast. Mittlerweile gibt es hier keine Kühe mehr. Dafür bekommen die Aschauers dreimal im Jahr 9000 Eintagsküken geliefert, die zunächst im Aufzuchtstall auf Hobelspänen herumwuseln; das ehemalige Heulager wurde dafür eigens mit einer Gasheizung ausgestattet. Nach vier bis fünf Wochen ziehen die kleinen Puten um, zu je 4500 in die beiden 1800 Quadratmeter großen Hallen mit Tageslicht.
Die wenigen weiblichen Küken, die sich in beinahe jede Lieferung verirren, werden aussortiert und später direkt ab Hof verkauft. Und von den Eiern, die die Hennen bis dahin legen, „gibt's einen Kuchen“, lacht Franz Aschauer.
Nicht ohne Stolz lässt er seinen Blick durch den Stall wandern und schließt noch schnell die Lüftungsklappen, damit es dem acht Wochen alten Federvieh nicht zu kalt wird. Schließlich versorgt der Bauer seine Tiere nicht nur mit Wasser und Futter (ein Teil des Weizens und des Mais stammt von den eigenen Feldern; der Rest wird ebenso wie das Kraftfutter zugekauft) sondern auch richtiggehend mit Spielzeug. - Nur landen kurioserweise die grünen Kunststoffplättchen nach einiger Zeit alle in derselben Ecke der 1800 Quadratmeter großen Halle, in der jeden Abend pünktlich um 22 Uhr das Licht ausgeschaltet wird.
Selbst wenn die Truthähne ausgewachsen sind und 20 Kilo oder mehr wiegen, bleibe genügend Platz, um zum Einstreuen mit dem Bulldogg durch den Stall zu fahren, erläutert der Landwirt – auch so könne Massentierhaltung aussehen, merkt er an. Ausgemistet wird allerdings erst, wenn der Stall wieder leer ist.
 |
| Vier bis fünf Prozent der Tiere sterben vor dem Schlachten, meist noch als Küken, schätzt Franz Aschauer, der täglich mehrere Kontrollgänge durch seine Ställe unternimmt. Fotos: pil |
Trotzdem wird der Truthahn im Ganzen hierzulande die Gans als traditionelles Weihnachtsessen wohl nicht ablösen. Wenngleich der Verzehr von Putenfleisch in der Bundesrepublik stetig steigt, sind Großfamilien doch eher ein Auslaufmodell. Ab sieben Kilo, schätzt Christine Lechner von den „Höhenrainer Delikatessen“, wird das herkömmliche Backrohr sowieso zu klein. Doch fällt der Vogel größer aus, greifen die Köche schon mal zu eigenwilligen Notbehelfen, wie etwa der Kunde, der die Ofenklappe mit einem Stuhl abstützen musste, weil sie sich nicht mehr ganz schließen ließ.
Abgesehen vom Dezember, wenn an die 700 Truthähne abgesetzt werden, haben im Laden neben dem Werk in Großhöhenrain zu Thanksgiving (letzter Donnerstag im Monat) natürlich viele Amerikaner einen „Turkey“ gekauft. Um möglichst alle Kundenwünsche hinsichtlich Größe und Gewicht der Puten erfüllen zu können, die zum Jahresende vor allem für große Familienfeste und Betriebsfeiern im Rohr brutzeln sollen, wurde hier bereits im Frühling mit den beiden Zulieferern aus der Erzeugergemeinschaft die Angebots-Palette abgesteckt – gestützt auf die Erfahrungen aus den Vorjahren.
Und wer zum erstenmal einen frischgeschlachteten Truthahn eigenhändig zubereiten und auftischen will, bekommt die Anleitung mit dem Titel „Keine Angst vorm großen Braten“ gleich mitgeliefert.
17. Dezember 2004
Von Marisa Pilger
 |
| Staraufgebot in der Innleiten, wo derzeit der neue Dörrie-Film „Der Fischer und seine Frau“ gedreht wird: Young-Shin Kim, Simon Verhoeven, Regisseurin Doris Doerrie, Alexandra Maria Lara, Christian Ulmen und Carola Regnier, sie spielt die Frau Wagenbach, die Gattin von Elmar Wepper (von links). Foto: pil |
Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt sind die Dreharbeiten in den Innauen bislang über die Bühne gegangen. Lediglich die 20 Milchkühe der Familie Thanner muhen im Hintergrund, wenn Elmar Wepper als Koi-Sammler Wagenbach miterleben muss, wie seine „Prinzessin“ ihren farbigen Punkt auf der Stirn verliert und zusehends braun wird.
Mit Witz, Phantasie und Einfühlungsvermögen erzählt Dörrie (auch Drehbuch) in Anlehnung an die Grimm'sche Märchenvorlage die Geschichte zweiter Paare (Alexandra Maria Lara und Christian Ulmen sowie Young-Shin Kim und Simon Verhoeven), von deren Sehnsüchten und Hoffnungen; und, verriet sie beim Pressetermin, „es gibt ein Happy End, obwohl sie alles verlieren“.
Das „Turmhäusl“ in dem Ende des 19. Jahrhundert von Thomas Gillitzer errichteten Gebäude-Ensemble und vor allem die Weiher liefern dabei die ideale Kulisse für das „Fisch-Center“ der „Flying Fish Doctors“ samt Tierarztpraxis.
Mit tierischen Beiträgen muss in dieser Umgebung demzufolge gerechnet werden. Doch Doris Dörrie lässt sich beim Fernseh-Interview nur ganz kurz vom Geschnatter einer Gans aus dem Konzept bringen. Im Handumdrehen ist die 49jährige Filmemacherin wieder beim Thema, bei der vermeintlichen Unersättlichkeit der Frauen nämlich – insbesondere der Ilsebill aus dem Märchen -, die vielleicht gar keine Gier ist sondern eine ganz natürliche Reaktion auf die Lethargie der Männer; und dass die Frauen ohne die männliche Passivität möglicherweise gar nicht so aggressiv wären in ihren Forderungen.
Die Bäuerin vom benachbarten Hof, wo Schauspieler und Techniker ihre Autos parken, ist auch nach einer Woche voll und ganz zufrieden mit den Filmleuten. „Ordentlich und unkompliziert“, freut sie sich; ihren Stadel haben die Thanners derweil als Unterkunft für die Komparsen zur Verfügung gestellt.
Für die kommende Woche stehen noch zwei Arbeitstage in der Innleiten auf dem Drehplan, bevor das Team den Set für die letzten der insgesamt 40 Drehtage in die Umgebung von München verlegt. Die letzte Klappe für den „Fischer und seine Frau“ soll am 3. Dezember fallen. Dabei steht der Film unter einem besonderen Vorzeichen: Nur kurz bevor der verheerende Taifun die japanische Provinz Niigata heimsuchte und das Inselreich wenig später von schweren Erdstößen erschüttert wurde, waren die Dreharbeiten in Japan beendet worden und die Darsteller abgereist. Die Turnhalle, die wenige Tage zuvor noch als Garderobe für die deutschen Schaupieler gedient hatte, wurde zur Notunterkunft für obdachlose Japaner. Mit der Gründung eines kleinen Fonds wollen die Filmleute nun finanzielle Hilfe leisten.
31. Oktober 2004
 |
 |
| In Thansau wurde der Lotsendienst der Verkehrswacht nach dem Bau des Fußgängerstegs über die Staatsstraße 2359 (Foto links) im Jahr 1987 eingestellt. Zu den aktuellen Brennpunkten im Landkreis in Sachen Schulwegsicherheit zählt Walter Klingseisen Bad Aibling, Feldkirchen und Riedering. Eigens gewürdigt wurde das ehrenamtliche Engagement der 444 Schulweghelfer und 102 Schülerlotsen - Verstärkung jederzeit gesucht! Gratis-Westen von der Verkehrswacht Rosenheim gab's in diesem Jahr für die Rohrdorfer und Thansauer Abc-Schützen. Beim Verteilen hatten MdL Klaus Stöttner (l.) und Adolf Dinglreiter alle Hände voll zu tun; sie wurden später von Landrat Max Gimple abgelöst. Fotos: pil |
Rohrdorf/Landkreis (pil) – „Kinder haben ein Ziel: zu leben, ist das zuviel?!“ Das musikalisch vorgebrachte Anliegen der 6a zog sich in der Rohrdorfer Aula wie ein roter Faden durch die Auftaktveranstaltung der landkreisweiten Aktion „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“. Denn wenn Schultüten das Straßenbild prägen und die Ranzen oft noch größer sind als der stolze Träger, ist auch die Verkehrswacht wieder voll im Einsatz: Mit Transparenten rund um alle Grundschulen führt sie insbesondere den Autofahrern vor Augen, dass etwa 3500 Abc-Schützen in diesen Wochen nicht nur in der Schule Neuland betreten, sondern auch als Verkehrsteilnehmer blutige Anfänger sind.
„Kinder sind anders!“ warnt Walter Klingseisen, Vorsitzender der Verkehrswacht Rosenheim, eindringlich. Gerade Sechs- und Siebenjährige könnten Tempo und Entfernung herannahender Fahrzeuge noch nicht richtig einschätzen. Umso mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht müssten jetzt die Autofahrer walten lassen; zumal die Schulzwergerl wegen ihrer geringen Körpergröße auch nicht weithin sichtbar seien.
Zwar sei die Zahl der Schulwegunfälle im Landkreis in den vergangenen Jahren stetig gesunken und lag im vorigen Schuljahr bei 18 (mit 18 Verletzten); Grund zum Jubeln sahen die Redner trotzdem nicht. „Es sind immer noch viel zu viele“, betonte Franz Mayer, Leitender Polizeidirektor der Direktion Rosenheim.
Adolf Dinglreiter, Vizepräsident der Landesverkehrswacht Bayern, erinnerte in diesem Zusammenhang an das Leid der Betroffenen und der Familien. Gleichzeitig ermahnte er die 60 Abc-Schützen aus Rohrdorf und Thansau, die Reflektorwesten, die die Verkehrswacht spendiert hat, auch wirklich anzuziehen.
An die Eltern, die aus Platzgründen allerdings nicht in der Rohrdorfer Aula mit dabei sein konnten, appellierte Dinglreiter, den Kindern insbesondere in der dunklen Jahreszeit helle Kleidung anzuziehen. Auch müsse genügend Zeit für den Schulweg eingeplant werden. Und nicht nur Rohrdorfs Bürgermeister Fritz Tischner ermunterte die Kleinen, ruhig die eigenen Eltern zu ermahnen, wenn sie beispielsweise mit dem Auto zu schnell an Schulbushaltestellen vorbeiführen.
Für die frischgebackenen Erstklassler steht in den kommenden Jahren ohnehin nicht nur Lesen und Rechnen auf dem Stundenplan. Auch in Sachen Verkehrserziehung fällt der Schule eine „ganz wesentliche Rolle“ zu. Für die Lehrer „eine Riesen-Verantwortung“, strich Polizeidirektor Franz Mayer heraus und sicherte tatkräftige Unterstützung durch die Polizei zu.
20. September 2004
Von Marisa Pilger
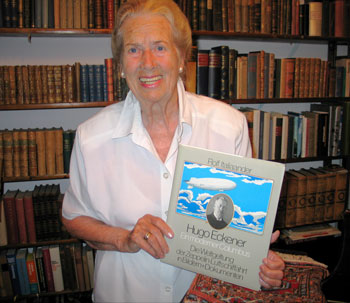 |
| Das Doppel-Gedenken rund um Hugo Eckener hat sich auch im Terminkalender von Inge Gollbeck-Eckener niedergeschlagen: Im Oktober nimmt sie an den Hugo-Eckener-Gedächtniswochen in Flensburg teil, zu denen ebenfalls Nachkommen von Graf Zeppelin erwartet werden. Mit dem Umzug nach Nußdorf erfüllten sich die gebürtige Stuttgarterin – sie ist mittlerweile verwitwet - und ihr Mann 1975 einen lange gehegten Wunsch: die beiden hatten sich einst in Brannenburg kennengelernt und schon bald beschlossen, im Inntal alt zu werden. Foto: Pilger |
Seine Nichte Inge Gollbeck-Eckener aus Nußdorf hat es sich seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, den Namen ihres Onkels wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Eine „Seelenverwandtschaft“ ist es, die die heute 87jährige von jeher mit ihrem Patenonkel verband. Die Liebe zur Musik, zur Malerei, zur Literatur – „sein Lebenselixier“ - , überhaupt zu den schöngeistigen Dingen des Lebens, ist der rüstigen weißhaarigen Dame freilich von den Eltern in die Wiege gelegt worden: die Mutter Musikerin und Malerin, der Vater Professor an der renommierten Kunstakademie in Stuttgart; auch die Großeltern überaus musisch orientiert.
Mit am nachhaltigsten geprägt haben die gebürtige Stuttgarterin aber die Ferien beim Bruder ihres Vaters Alexander, die der Backfisch regelmäßig in der kleinen, efeuumrankten Villa in Friedrichshafen verbrachte. Unvergesslich sind für sie die Stunden, während derer sie und ihr geliebter Onkel Hugo, der auch auf der Höhe seines Ruhmes stets „ein ganz bescheidener Mensch“ geblieben war, schweigend in der Halle saßen und lasen; er im Ledersessel mit der Pfeife im Mund und seinem Hund Ares zu Füßen, die Nichte auf dem Sofa gegenüber, Goethes Wahlverwandtschaften am Wickel oder Werke über fernöstliche Philosophie. Schon als Schulbub hatte es Eckener vorgezogen, alles, was ihm in die Hände kam zu lesen – egal ob Aristoteles oder russische Schriftsteller -, anstatt stur Lernstoff zu pauken. Und fürs Abitur bedurfte es mehrerer Anläufe, erzählt die Pianistin, die zehn Jahre lang bei den Übungsstunden der Ballett-Tänzer am Stuttgarter Staatstheater den Ton angegeben hat.
Tante Johanna indes, gemeinhin "Tante Go" genannt – die bessere Hälfte von Hu-Go -, war bei diesen Lese- oder auch den Konzertstunden nie dabei; sie saß im Nebenzimmer in einem Lehnstuhl, meist über eine Handarbeit gebeugt. Auch bei den Ausflügen fehlte Tante Go, der ruhende Pol in Eckeners Leben – beispielsweise bei der Reise nach St. Anton/Arlberg; die Erinnerung an die Autofahrt mit Onkel und Kusine lässt die Augen der 87jährigen noch nach über 70 Jahren glänzen. „Wir fuhren im offenen Maybach, und ich war einfach glücklich.“
Es ist vor allem der Mut, den Gollbeck-Eckener so an ihrem Onkel bewundert. Nur dadurch, ist sie überzeugt, kam die Atlantiküberquerung im Jahr 1924 überhaupt zustande: Eckener hatte darauf bestanden, höchstpersönlich ein Luftschiff sozusagen als „Natural-Reparation“ beim vormaligen Kriegsfeind Amerika abzuliefern und hatte für das Vorhaben mit dem gesamten Vermögen der Luftschiffbau Zeppelin GmbH gebürgt.
Und ebenso liberal der Luftfahrt-Pionier war, so unbestechlich war er auch. Protektion und Vetternwirtschaft verabscheute er von Grund auf, erinnert sich Inge Gollbeck-Eckener. Die einzige Zeppelin-Fahrt ihre Lebens hat sich die fast 88jährige, die mütterlicherseits weitläufig mit der Familie von Siemens verwandt ist, deshalb richtiggehend erschleichen müssen. Kurz nach der sensationellen Weltumrundung im Jahr 1929 haben sie und ihre vier Jahre ältere Schwester Heidi den Kapitän Hans von Schiller bekniet, sie an Bord des Luftschiffes zu schmuggeln. Man passierte gerade die Schwäbische Alb, als die beiden Mädchen im Zeppelin vor einer Tür mit dem Schild „Besetzt“ warteten; die Tür öffnete sich, heraus kam – der Onkel. Doch der sonst so Strenge nahm die beiden blinden Passagiere mit Humor.
Diese und andere Erinnerungen hat seine Nichte auch in ihrem Büchlein „Onkel Hugo“ festgehalten, das sie selbst vertreibt (Informationen unter Telefon 08034/3220). Ganz besonders gern erinnert sie sich an ein Erlebnis bei der Einweihung des wiederhergestellten Zeppelin-Brunnens in Friedrichshafen im Jahr 2000. Den Zuschauermassen genügte allein die Erwähnung des Namens Hugo Eckener und seines Taufgeschenks – einer Bernsteinkette –, um seiner Nichte den Weg in die vorderste Reihe freizugeben. - Am Bodensee kennt den Namen Hugo Eckener noch heute beinahe jeder.
20. August 2004
| Am 14. August 1954, starb mit Hugo Eckener der Mann, der die lenkbaren Starrluftschiffe einst in die Welt getragen hat, dessen Name im Gegensatz zu dem Zeppelins aber nur noch wenigen Menschen geläufig ist. Den Flugexperimenten des Grafen Zeppelin, über die Eckener als Korrespondent der Frankfurter Zeitung berichtete, hatte der gebürtige Flensburger zunächst sehr skeptisch gegenüber gestanden. Im Laufe der Zeit aber faszinierten den leidenschaftlichen Segler und Bergsteiger die Riesenzigarren in Friedrichshafen zunehmend; aus dem Philosophen und Nationalökonomen wurde ein Luftschiffer mit Leib und Seele. 1911 erhielten er und Graf Zeppelin das Luftschiffführer-Patent von der „Fédération Aéronautique“ in Paris; im selben Jahr wurde Eckener die Leitung der neugegründeten Deutschen Luftschifffahrt Aktiengesellschaft (Delag) übertragen. Frankfurt am Main, Baden-Baden und Düsseldorf waren die ersten der später 25 Luftschiffhallen im Deutschen Reich, und schon 1912 stiegen Zeppeline regelmäßig zu Passagierfahrten über Deutschland auf. 1924 ging Eckener mit dem „LZ 126“ (später ZR III) in die Luft, um das 200 Meter lange Luftschiff - angetrieben von fünf 350-PS-Maybach-Motoren - in die USA zu überführen. Die Amerikaner hatten nach dem Ersten Weltkrieg Reparationsforderungen an das Deutsche Reich gestellt, die Eckener als Naturalie auszahlen wollte; bot ihm dies doch die Gelegenheit, der Weltöffentlichkeit die Transatlantik-Tauglichkeit der Zeppeline zu demonstrieren, von der er felsenfest überzeugt war. Mit der erfolgreichen 7000-Kilometer-Passage nach Lakehurst begann endgültig der Höhenflug der Riesenzigarren, der 1929 in der Weltfahrt der „LZ 127 Graf Zeppelin“ gipfelte und 1937 in Lakehurst jäh zu Ende ging. 21 Tage und fünfeinhalb Stunden reine Flugzeit dauerte die Reise, die im August vor 75 Jahren weltweit für Aufsehen und Begeisterung gesorgt hat. Eckener legte mit dem 236 Meter langen Luftschiff (Höchstgeschwindigkeit 130 km/h) knapp 50.000 Kilometer zurück und machte unter anderem in Tokio und Los Angeles Zwischenstation. 1931 wurde zusätzlich zur Nordamerika-Strecke ein fester Passagier-, Post-, und Frachtdienst nach Rio de Janeiro (Brasilien) eingerichtet. Und zu metereologischen und geographischen Forschungszwecken stand eine Polarfahrt auf dem Programm. Mit der Explosion der „Hindenburg“ bei der Landung in Lakehurst ging am 6. Mai 1937 schließlich die Ära der großen Luftschiffe mit einem Schlag zu Ende. Dies und die Abwrackung der letzten Zeppeline durch die Nazis bedeutete für Eckener einen schweren Schlag, erinnert sich seine Nichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt der Schriftsteller, Techniker, Ökonom und Weltbürger mit der ausgeprägten musischen Ader zum Journalismus zurück: Mittlerweile 77jährig wird er Mitherausgeber einer neuen Tageszeitung, des „Südkurier“ in Konstanz. Vier Tage nach seinem 86. Geburtstag stirbt Hugo Eckener in Friedrichshafen, der Geburtsstadt seiner Zeppeline. pil 20. August 2004 |
 |
 |
| Nagelbrett statt Sitzkissen. Seit elf Jahren macht Ede Ball mit den Mini-Ro-Kindern Zirkus und ermutigt sie auch zu solch „bestechenden“ Leistungen. | Hochkonjunktur im Arbeitsamt. Jeder Jobwechsel der Mini-Ro'ler muss gewissenhaft dokumentiert werden. Fotos: pil |
Rosenheim/Kohlstatt (pil) – „Kündigung im Postamt!“ – „Einmal Kündigung im Café!“. Im Arbeitsamt herrscht Hochkonjunktur; zumal sich vor der Absperrung auch schon eine kleine Schlange Job-Suchender gebildet hat. In der Kunstwerkstatt stehen die Chancen für Arbeitslose momentan am besten; das zeigt ein Blick auf die Pinwand, auf der freie und besetzte Stellen mit farbigen Nadeln gekennzeichnet sind; hellblau für Stadtverwaltung, schwarz für Bank, weiß für Küche, dunkelblau für Kunstwerkstatt. Bei letzterer ist vor kurzem ohnehin per Post ein Auftrag eingegangen: Das Theater benötigt für seine nächste Vorstellung Puppenköpfe.
Fast wie im richtigen Leben geht es zu in der Spielstadt Mini-Ro, die zum nunmehr 18. Mal ihre Tore für Kinder aus der Stadt und dem Landkreis geöffnet hat. Neuankömmlinge müssen sich zunächst bei der Stadtverwaltung einen grünen Bürgerausweis besorgen, der gleichzeitig als Kennkarte für Arbeitsamt und Bank gilt. Nur wer arbeitet, bekommt Geld – acht Mini-Euro pro Stunde -, wobei es keine Rolle spielt, ob in der Schreinerwerkstatt, im Klinikum oder in der Küche; nur Sekretärinnen und Facharbeiter mit Zusatzprüfung bekommen mehr.
Esther (13) und Magdalena (14) haben sich wieder für die Arbeit in der Zeitungsredaktion entschieden. Sie heben das Tages-Horoskop und den Wetterbericht ins Blatt, das je nach Entscheidung der „Redakteure“ mal „Mini-Ro Post“ und dann wieder „Mini-Tagblatt“ heißt, und in dem es neben Veranstaltungshinweisen, Wetterbericht und Interviews auch Kontaktanzeigen und natürlich viel Werbung zu lesen gibt.
 |
| In der Papierwerkstatt wird letzte Hand angelegt an die Pappmaschée-Helme. Sie sollen verkauft werden und zum Schutz gegen die Hitze dienen. |
Doch nicht alle Mini-Ro'ler sind von den Tarifverhandlungen abhängig. Ganz Findige besorgen sich bei der Stadtverwaltung einen Gewerbeschein, stellen selbst Mitarbeiter ein, legen sich unter einen Baum in den Schatten und lassen andere für sich arbeiten – wie jüngst der pfiffige Taxiunternehmer, der je nach Lust und Laune Fahrten zum Nulltarif anbot. Wie so manches andere fällt auch die Amtszeit des Stadtoberhaupts in Mini-Ro gezwungenermaßen etwas kleiner aus als bei den Großen: Alle zwei Tage wird ein Bürgermeister gewählt, der sich vor allem um die Umsetzung seiner Wahlversprechen (wie etwa kostenlose Getränke ab 25 Grad im Schatten oder Senkung der Arbeitslosenzahlen) zu kümmern hat. Sein Gehalt kann er selbst festsetzen.
Trotzdem haben auch die Bürger durchaus ein Wörtchen mitzureden. „Richtige Demonstrationen haben wir schon gehabt!“, erinnert sich Isabelle Schweier vom Stadtjugendring. Die Erzieherin ist seit der ersten Mini-Ro-Stunde dabei. Die Grundidee, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich in einem Gemeinwesen selbständig zu organisieren und zu artikulieren und – wenn's sein muss – auch mal knallharte Kreditverhandlungen mit der Bank zu führen, ist auch nach 17 Jahren noch aktuell; große Veränderungen im Konzept habe es nicht gegeben. Selbst die Computer, die vor wenigen Jahren bei der Post und in der Bank Einzug gehalten hatten, wurden nach einem kurzen Gastspiel wieder abgeschafft. „Back to the roots!“, lacht Schweier, die gemeinsam mit Christine Kerer von der Kreisjugendarbeit und einem rund 40köpfigen Betreuer-Stab dafür sorgt, dass der zehntägige Spielstadt-Betrieb möglichst reibungslos über die Bühne geht.
Immerhin bevölkern derzeit täglich um die 230 Mädchen und Buben den Zeltplatz Kohlstatt bei Söllhuben. Wie viele es tatsächlich von Tag zu Tag werden, lässt sich allerdings oft nicht genau vorhersagen. 80 Plätze stehen für Stadt-Kinder zur Verfügung, die wochenweise buchen können. Der Rest des Kontingents wird an die Landkreis-Gemeinden verteilt, die die Teilnahme an Mini-Ro (jeweils zwei Tage) meist über ihre Ferienprogramme ausschreiben. Eine Rückmeldung über nicht vergebene Plätze erhalte der Stadtjugendring jedoch in der Regel nicht, bedauert Schweier; dabei sei die Warteliste ellenlang.
Für viele der Acht- bis 14 jährigen bietet die Spielstadt, die ihre Zelte im Zwei-Jahres-Wechsel in Kohlstatt beziehungsweise am Happingerausee aufschlägt, aber noch mehr als „nur“ Bürger-Spielen: Katrin (12), die in der Klangwerkstatt gerade einen Regenmacher – eine mit Kieselsteinen gefüllte Papprolle - bastelt, freut sich, dass sie hier alte Bekannte aus allen möglichen Ecken des Landkreises wiedertrifft. Sie will im nächsten Jahr „auf jeden Fall“ wiederkommen.
8. August 2004
Landkreis (pil) – Mit der Neuauflage des Rohrdorfer Wiesn-Express schlägt die Bayerische Oberlandbahn (BOB) in Holzkirchen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Damit der „Integral“ nicht leer vom Depot nach Rosenheim fahren muss, macht der Sonderzug zwischen dem 28. August und dem 12. September auch auf dieser Strecke Station.
Zu- und aussteigen können die Passagiere mittwochs, freitags, samstags und sonntags in Kreuzstraße, Westerham, Bruckmühl und Bad Aibling.
Die Rückfahrt auf dieser Strecke kostet – unabhängig vom Zusteigeort - zehn Euro (Kinder unter zwölf Jahren fahren umsonst mit). Im Fahrpreis ist eine Auerbräu-Biermarke enthalten, wobei sich Jugendliche das Biermarkerl auf alkoholfreie Getränke anrechnen lassen können.
17. Juli 2004
Von Marisa Pilger
Rosenheim - Die Elemente Wasser und Luft haben auf Gundram Hoffmann von jeher eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. Und als der gebürtige Saarländer vor 25 Jahren am Samerberg fasziniert den Drachenfliegern zuschaute, die hoch droben ihre Runden drehten, wusste der Student sofort: „Da gehöre ich hin!“ Jetzt hat der 47jährige Innenarchitekt aus Rosenheim mit einem spektakulären 205-Kilometer-Flug, der ihn und seinen Spezl, den Raublinger Jürgen Weichselgartner, von der Hochries bis kurz vor Graz trug, nicht nur in Fliegerkreisen für Aufsehen gesorgt.
 |
| Drachenflieger Gundram Hoffmann: Es werden leider immer weniger; der Nachwuchs bleibt aus. Foto: pil |
Angst? – Nein, Angst hat Hoffmann „nie“, wenn ihn die Thermik seinen Hochleistungsdrachen Meter um Meter in die Höhe schrauben lässt. Er empfindet das Drachenfliegen als einen „Tanz mit dem Element“; für ihn fast eine Art Philosophie. Und immer wieder reizt den 47jährigen die Herausforderung von Neuem, mit der Naturgewalt „spielerisch fertig zu werden.“ Denn "die Luft ist jedesmal anders." Es kommt höchstens vor, dass ihn über unbekanntem Gebiet in vier-, fünftausend Metern Höhe ganz kurz das mulmige Gefühl beschleicht, er könnte vielleicht runterfallen. Doch das, meint Hoffmann, liegt an der dünnen Luft. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass neben Kreislauf und Kondition – die Flieger hängen nicht selten mehrere Stunden zwischen Himmel und Erde im Gurtzeug – die Psyche mitspielt. Ganz extrem hat er das 1998 auf einem atemberaubenden Höhenflug in der Schweiz erlebt, als ihn Aufwinde mit bis zu 15 Metern pro Sekunde in 5000 Meter über Normalnull getragen haben - in eine Region, in der die Erdkrümmung für den Betrachter wahrnehmbar wird.
Egal ob über Venezuela, Australien oder Lanzarote – bei all seinen Flügen hat der Rosenheimer, der „die komplette Alpenkette zwischen der Schweiz und Slowenien als 3-D-Modell im Kopf gespeichert“ hat, neben Handy und GPS einen weiteren ständigen Begleiter: die „Ehrfurcht vor dem Element“. Sie sorgt dafür, dass der zweifache Vater keine Kapriolen macht.
Freilich, in seiner Sturm- und Drangzeit hat auch Gundram Hoffmann – der nur wegen eines Schreibfehlers beim Standesamt nicht Guntram heißt - so manches ausgereizt: In Marquartstein etwa bekam er einmal in einem Salatbeet zwischen zwei Gewächshäusern etwas unsanft Bodenkontakt; sehr zum Schrecken einer alten Frau, die sich gleich besorgt erkundigte, ob dem „Buam“ etwas fehle. Und einmal hat ihm über der Hochries, 400 Meter über dem Boden, der Fallschirm das Leben gerettet. Wirklich verletzt hat sich der Innenarchitekt in seiner 25jährigen Fliegerkarriere erst einmal - bei einer „ganz banalen Landung“ brach er sich die linke Hand.
An die 1300 Flugstunden hat der (Bundes-)Liga-Pilot vom Samerberger Drachenfliegerclub mittlerweile auf dem Buckel – allerdings nicht immer zur Freude seiner Lebensgefährtin. Doch Hoffmann weiß, dass „diese Leidenschaft für Außenstehende sehr schwer zu verstehen“ ist. Dabei pflegt der begeisterte Squash-Spieler auch durchaus bodenständige Hobbys: er kocht mindestens so gerne wie er isst, bäckt Brot und geht mit der ganzen Familie in die Schwammerl.
5. Juli 2004
Rohrdorf/Landkreis (pil) – Ganz im Zeichen grenzüberschreitender Hilfestellung steht die Partnerschaft, die der Wasserverbund des rumänischen Landkreises Timis (APCAN) jetzt mit der ARGE Wasserversorgung Oberbayern und dem Abwasserzweckverband Prien-Achental geschlossen hat. Die Gemeinden des Landkreises Rosenheim haben bislang 20 Trinkwasserbrunnen im westrumänischen Partnerkreis finanziert. „Jetzt wollen wir uns auch fürs Abwasser stark machen“, erläutert Rohrdorfs Bürgermeister Fritz Tischner als Vorsitzender des Zweckverbandes Prien-Achental die Hintergründe der deutsch-rumänischen Wasserpartnerschaft. Denn bislang würden die Abwässer aus den Häusern dort einfach in offene Gräben geleitet; nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung seien an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.
Der Aufbau eines Kanalnetzes in Timis soll nun im Rahmen eines technischen Entwicklungsprojekt vorangetrieben werden, mit dem die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) die Stadtentwässerungswerke München zusammen mit der Firma aquaKomm beauftragt hat. Die aquaKomm ist eine Tochtergesellschaft der Münchner Stadtentwässerung sowie der Stadtwerke München und mehrerer anderer südbayerischer Versorgungsunternehmen. Bei einer Tour durch verschiedene Ver- und Entsorgungseinrichtungen in Oberbayern erhielt eine Gruppe rumänischer Bürgermeister kürzlich einen ersten Einblick in die Wasser-Abwasser-Thematik. Neben der Besichtigung des Klärwerks Bockau (Gemeinde Rohrdorf) standen dabei auch Besuche bei den Wasserversorgern der Zornedinger und der Sur-Gruppe auf dem Programm.
Peter Köstner, Projektverantwortlicher bei den Stadtentwässerungswerken München, räumt diesen Studienreisen in einer Presseerklärung einen großen Stellenwert ein, da die Bürgermeister „in ihrer Heimat die Weichen für den Aufbau von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungssystemen stellen müssen“. Darüber hinaus, heißt es in der Mitteilung weiter, will Dr. Oliver Weis, Projektleiter bei aquaKomm, dem neugegründeten Wasserverbund APCAN Timis unter dem Vorsitz von Vize-Landrat Marius Popovici „durch Beratung und technische Unterstützung vor Ort“ zur Seite stehen.
Einen weiteren Schritt hat der Zweckverbandsvorsitzende Tischner ins Auge gefasst: Noch in diesem Jahr sollen sich rumänische Wasser- und Klärmeister in Rohrdorf ausführlich über die Grundzüge der modernen Abwasseraufbereitung informieren.
26. Mai 2004
 |
| Die Bläsergruppe Frasdorf blies in der Aschauer Festhalle nicht nur MdL Jürgen Vocke den Jägermarsch Nummer 3. Einmal jährlich, so sieht es das Bayerische Jagdgesetz vor, müssen die Jägervereinigungen eine Hege- und Naturschutzschau veranstalten, bei der sich auch die Öffentlichkeit ein Bild machen kann über Aufgaben und Arbeit der Jäger in den einzelnen Hegeringen. Die Ausstellung der Trophäen gibt gleichzeitig einen Überblick über den Wildbestand in den Wäldern. Fotos: Pilger |
Ähnlich positiv äußerte sich sein Wasserburger Kollege Georg Kasberger. Lediglich für den Hegering 6 habe er – wegen der enorm hohen Verbissrate in einzelnen Revieren – empfohlen, die Abschusszahlen wo nötig zu erhöhen.
„Himmeltraurig“ ist es unterdessen ums Rotwild bestellt, mahnte Baron Rasso von Cramer-Klett, Leiter des Hegerings Kampenwand, eindringlich. Mit 65 Stück Rotwild – davon lediglich 14 Hirsche – lag die Gesamtabschussquote im vergangenen Jagdjahr bei 67 Prozent, fasste Jagdberater Alois Lechner die „traurige Bilanz“ in Zahlen.
Dass der Bestand in den letzten 15 bis 20 Jahren stark zurückgegangen ist, spiegelte sich auch in der Trophäenausstellung wieder. Im Vergleich zum Allgäu „jämmerlich“, stellte der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes (BJV), MdL Jürgen Vocke, betroffen fest. Während sich Aschaus Bürgermeister Kaspar Öttl in seinem Grußwort nicht verkneifen konnte, ganz allgemein anzumerken: „Mir ist immer noch zu wenig Wild in unseren Wäldern und auf unseren Bergen.“
Eine Arbeitsgruppe der Euregio Inntal nimmt nun die artgrechte nachhaltige Bejagung des Rotwildes ins Visier. Diese, betonte Gerhard Prentl, Leiter der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt, sei aber nur in Zusammenarbeit mit den Tiroler Nachbarn möglich. Schließlich kennt das Rotwild keine Landesgrenzen.
Für eine Beibehaltung der Unteren Jagdbehörden bei den Landratsämtern anstelle der Eingliederung in die Forstverwaltung sprach sich Werner Zwingmann, der Vorsitzende der Jägervereinigung Rosenheim, im Hinblick auf die Forstreform im Freistaat aus. Ein System, das sich auch nach Ansicht von BJV-Präsident Vocke „hervorragend bewährt hat“. Andernfalls lägen künftig forstliche Gutachten und Abschussplanung in einer Hand.
Zwingmann verwies in seinem Referat außerdem auf die Bemühungen der Jäger im Bereich des Artenschutzes: So wurde die Trafostation am Sonnenholz in Brannenburg zum Sommerquartier für die vom Aussterben bedrohten Fledermäuse ausgebaut – die Tiere wurden in der Region bereits 1963 unter gesetzlichen Schutz gestellt, trotzdem nimmt ihre Zahl rapide ab. Spenden für dieses Projekt werden gerne noch entgegengenommen. Denn, sind sich Zwingmann und Vocke einig, was helfe eine Rote Liste, solange der Stier nicht bei den Hörnern gepackt werde - sprich für die bedrohten Tierarten wieder artgerechte Lebenräume geschaffen würden.
Die „dogmatischen“ Forderungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast hinsichtlich der Novellierung des Bundesjagdgesetzes jedoch würden solche Bestrebungen bereits im Keim ersticken. Wie, verdeutlichte Vocke an einem Beispiel, hätte etwa das Rotwild diesen langen Winter überleben sollen, wenn die Jäger nicht – mit hohem Kostenaufwand – artgerecht zugefüttert hätten. Und das geforderte generelle Verbot der Fallenjagd hätte zur Folge, dass Bisam per Genickschuss exekutiert würden. Auf der anderen Seite sollen auf Wunsch Künasts Frischlingsfallen zulässig sein, an denen sich teils erschütternde Szenen abspielten, wenn die Bache Aug in Aug mit ihrem Nachwuchs steht, ihn aber nicht befreien kann. Für den CSUler, der für seine deutlichen Worte wiederholt kräftigen Beifall erntete, „fängt hier die Blasphemie an“. Künast habe keine Ahnung, was die Jagd wirklich leiste.
Eine Absage erteilte der BJV-Chef – in dieses Amt wurde er vor genau zehn Jahren in Rosenheim gewählt – auch dem anvisierten generellen Jagdverbot in Schutzgebieten; insgesamt 1,2 Millionen Hektar Revierfläche wären davon betroffen. Vocke: “Wer kommt für die Schäden auf?!“
Dem Appell des Landespolitikers an die Jäger, Geschlossenheit zu demonstrieren , griff auch Baron von Cramer-Klett auf. Der sieht schon den Moment kommen, an dem „wir wirklich nach Berlin gehen müssen.“ Sein Aufruf an die Jäger: „Seid nicht die schweigende Mehrheit!“
 |
Für 15 Jahre verständnisvolle Zusammenarbeit mit den Jägern wurde der Rosenheimer Forstamtsdirektor Peter Fuhrmann (2.v.r.) mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Bayerischen Landesjagdverbandes ausgezeichnet. BJV-Präsident Jürgen Vocke (2.v.l.) hob dabei vor allem Fuhrmanns Bemühungen um ein sachliches Miteinander von Jägern und Forstamt hervor. Der wiederum freute sich sichtlich über die Auszeichnung, ließ aber keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er trotz der Ehrung noch nicht am Ende seiner Dienstzeit stehe: „Ich bleibe noch ein paar Jahre.“ Zur Auszeichnung gratulierten unter anderem Werner Zwingmann (r.), der Vorsitzende der Jägervereinigung Rosenheim, und sein Vize Jakob Hündl (l.). |
 |
 |
| Dank des Pedometers weiß der Bauer nicht nur, wann die Kuh das letzte Mal zum Melken gekommen ist. Der Tagesdurchschnitt liegt bei 2,5-mal. Ein Schrittzähler gibt Aufschluss darüber, ob das Tier stiert, also ob es brünstig ist, oder ob es sich – etwa verletzungsbedingt – zu wenig bewegt. Computergesteuert kann das Tier bei Bedarf direkt vom Melkstand in die Selektionsbox umgeleitet werden, z.B. wenn Klauenschneiden angesagt ist. Fotos: pil |
Von Marisa Pilger
Landkreis – Das Melken ist Margot Manhart als „sehr schwere Arbeit“ in Erinnerung geblieben. Fünf Viertelstunden standen sie früher zu zweit im Stall, mussten den Melkapparat von Kuh zu Kuh schleppen, sich zu jeder einzelnen Zitze herunterbücken, saubermachen, anstecken, abstecken – bei 45 Tieren, zweimal täglich, sieben Tage die Woche. Heute setzt sich die 32jährige morgens und abends an den Computer, überprüft, welche Kuh überfällig ist und treibt sie gegebenenfalls in den Melkstand. Denn seit Juli 1999 erledigt in Schlimmerstätt bei Großkarolinenfeld ein Melkroboter die Knochenarbeit.
Nur zwei der 2356 Milchbauern im Landkreis Rosenheim (Stand Juli 2003) sind bislang auf diese Technik umgestiegen: Auch bei den Biechls in Hofberg (Feldkirchen) können die Gefleckten seit vier Jahren je nach Wunsch fressen, schlafen oder zum Melkautomaten gehen. Abgesehen vom ruhigen, stressfreien Ablauf für die Tiere steht bei den Landwirten natürlich die immense Arbeitserleichterung im Vordergrund, die die grundlegende Neuerung mit sich brachte.
Dank des Pedometers – einer Art elektronischer Kennkarte - am rechten Vorderfuß weiß das System sofort, welche der 60 Biechl-Kühe gerade im Melkstand steht; in einer Datenbank sind Ohrmarkennummer, Geburtsdatum, durchschnittliche Tagesleistung, Höhe und Form des Euters, das Datum des Kalbens und vieles mehr erfasst.
Mittels Laser-Messtechnik fährt der Schlitten mit dem Melkapparat an die richtige Stelle; kleine Bürsten reinigen und stimulieren die vier Zitzen, bevor die Zitzenbecher angesetzt werden. Bei jedem leergesaugten Viertel schließt sich das Ventil der Vakuumpumpe und der Becher wird abgezogen. Kraftfutter – je nach Milchleistung – versüßt derweil der Kuh die Prozedur beim Roboter. Der pumpt die auf 24 Grad vorgekühlte Milch durch einen Feinfilter gleich weiter in den 2000-Liter-Eiswassertank, nachdem sie auf ihre Leitfähigkeit untersucht worden ist. Diese wiederum gibt Aufschluss über mögliche gesundheitliche Probleme beim Tier. Kommt eine der Gefleckten allerdings zu früh wieder an den Melkstand, entscheidet der Automat: „Entlasse Kuh“ und wird nicht aktiv.
 |
| „Kuhkomfort“ als Maßstab: Eine Massagebürste erhöht die Lebensqualität im Kaltstall zusätzlich. Die Bedienung hatten die Tiere im Handumdrehen heraus - von wegen „blöde Kuh“. |
Seit der Roboter ihnen das Melken abnimmt, haben die Manharts 70 Stück Vieh und liefern 520.000 Kilo Milch im Jahr ab. Trotzdem bleibt mehr Zeit fürs einzelne Tier, schildert die 32jährige, die 1998 mit ihrem Vater Georg eine GbR gegründet hat und seither den Betrieb leitet. Wie auch in Hofberg wird auf ihrem Hof der „Kuhkomfort“ großgeschrieben. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es den Kühen besser geht, wenn sie sich im Stall frei bewegen und ihren Tagesablauf selbst bestimmen können. Ihr schwebt langfristig noch ein Auslauf fürs Milchvieh vor, das nun ganzjährig im Klimastall untergebracht sind.
Manhart war beim Blättern in Fachzeitschriften auf die Melkautomaten aufmerksam geworden; ein neuer Stall war ohnehin fällig. Die Kühe hatten sich innerhalb von drei bis vier Wochen nahezu problemlos an das neue System gewöhnt. Und nach einer Flaute - bedingt durch BSE und Maul-und Klauenseuche – steigt auch bei ihren Kollegen wieder das Interesse für die Anlage.
Balthasar Biechl hat die neue Technik bei seiner ersten Besichtigung in Holland „fasziniert“. Weil der 24jährige Sohn Martin den Hof einmal übernehmen wird, fiel die endgültige Entscheidung für die Investition im sechsstelligen Bereich auch nicht all zu schwer. Im Dezember 1999 sind die 60 Milchkühe in den neuen Kaltstall, in den die Biechls viel Eigenarbeit gesteckt haben, eingezogen.
Eine Putz- und Massagebürste, die die Kühe selbst in Gang bringen können, sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Tiere wohl fühlen bei ihrer Arbeit, beim Milchproduzieren. Denn wenn man „aus einer Kuh viel herausholen“ wolle, müsse man auf deren Bedürfnisse eingehen. Eine kleine Steigerung der Milchrate hat Biechl bereits verzeichnet. Und seine Spitzenkräfte geben bei vier Melkungen immerhin bis zu 50 Liter täglich.
Den Biechls ermöglicht das automatische System aber mehr als einen flexibleren Tagesablauf oder am Sonntag auszuschlafen: Annemarie Biechl wurde vorletztes Jahr zur Landesbäuerin gewählt; seit Oktober sitzt die 55jährige außerdem für die CSU im Landtag. Ihr Mann leitet unter anderem den großen Fleckvieh-Zuchtverband Miesbach. Solch zeitaufwendige Ämter wären ohne den Roboter kaum denkbar.
Aber dass er sich noch so ausführlich mit EDV befassen würde, daran hat Balthasar Biechl noch vor einigen Jahren nicht einmal im Traum gedacht. Alles, was er zur Bedienung des Melksystems wissen muss, hat der 54jährige in Eigenregie erlernt. Nur mit der Nummernverwaltung kann er sich nicht so recht anfreunden: Biechl kennt alle seine Tiere nur beim Namen, die zugehörigen Kennzahlen muss er immer erst im Computer nachschauen.
7. April 2004
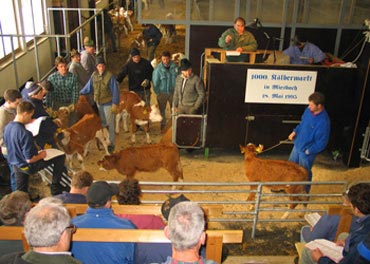 |
 |
| Martin Sappel in Aktion: Jeden Donnerstag werden in Miesbach zwischen 500 und 1000 Kälber versteigert. Bei den Zuchtkälbern bestimmt vor allem der Stammbaum den Preis, nicht unbedingt das Gewicht. Fotos: pil | Schauen, Ratschen, Fachsimpeln – der Miesbacher Zuchtviehmarkt ist nicht nur eine Verkaufsveranstaltung sondern auch Kontaktbörse. Manche kommen nur, um sich über Preise und die Qualität des Angebots zu informieren. |
Von Marisa Pilger
Miesbach - Nummer 115 ist schon gestylt, das Hinterteil frisch rasiert; das Stimmengewirr um sie herum scheint die Zweieinhalbjährige aus Bruckmühl kalt zu lassen. Gemächlich tritt sie von einem Bein aufs andere, scharrt von Zeit zu Zeit im Sägemehl. Derweil fachsimpeln weiter hinten Männer mit Gummistiefeln und grauen Hüten über Euterform, Tagesgemelk und Fleischansatz. Nummer 115 wartet mit zig anderen gelassen auf ihren Auftritt. Als es dann soweit ist, zeigt einzig Stier P. Allüren, der heimliche Star lässt auf sich warten. Unruhe macht sich in den Zuschauerrängen breit. Ein weiterer Aufruf folgt: „Nummer Eins, bitte in den Ring!“. Schließlich läuft P. doch noch ein und lässt so manches Herz höherschlagen: Ein Neubeurer als prächtiger Auftakt für den Zuchtviehmarkt in der Miesbacher Oberlandhalle.
 |
| Kritisch und konzentriert verfolgt das Publikum die Zuchtviehversteigerung in der Oberlandhalle. |
Beim Auftrieb hatte das Tier bewundernde Kommentare wie „Jetzt geht's auf!“ geerntet: Von vorn bis hinten glatt geschert und mit 31 Litern Milch täglich war die Jungkuh aus Riedering als einzige in die oberste Wertklasse I eingereiht worden.
„Das hätte mehr sein können!“ Auch Josef Graf, Vize des Fleckvieh-Zuchtverbands Miesbach und Vorsitzender der Viehzuchtgenossenschaft (VZG) Rosenheim, einer der acht regionalen Verbands-„Zweigstellen“, ist sichtlich enttäuscht. Überhaupt läuft das Geschäft an diesem Tag eher schleppend; rund 100 Euro bleiben die Preise für die Jungkühe unter dem üblichen Niveau, schätzt Graf. Ein ums andere Mal muss Walser an seinem Overhead-Projektor hinter Katalognummer und gesteigertem Betrag ein „n.a.“ schreiben – „n.a.“ für „nicht abgegeben“. Die Preise sind den Züchtern einfach zu niedrig, erklärt Graf. Die Aufzucht einer Jungkuh mit einer Tagesleistung von 20 bis 25 Litern Milch koste rund 1200 Euro; und eine Abgabeverpflichtung gibt es hier nicht. „Des ko wos wern!“ brummelt ein Älterer im grauen Arbeitsmantel unzufrieden.
Für das schwache Geschäft und die überraschend dürftig besetzten Bankreihen in der Oberlandhalle an diesem Tag hat Graf nur eine Erklärung: Die Milchkontingente sind zum Ende des Wirtschaftsjahres allenthalben so gut wie ausgeschöpft. Warum also jetzt eine Milchkuh kaufen?
 |
| Alle drei beziehungsweise vier Wochen wird in Miesbach das Großvieh im Ring aufgetrieben. |
Noch bis vor acht Jahren mussten die Tiere bereits am Vortag angeliefert werden, um an Ort und Stelle Abend- und Morgengemelk abzuliefern. Jetzt trudeln diese Daten via Internet ein. Eine dreiköpfige Kommission samt Tierarzt nimmt in der Früh jedes Tier unter die Lupe. Diejenigen, die bei der Einreihung unter den zehn oder 15 Besten landen, werden zuerst präsentiert, was sich in der Regel positiv auf den Preis auswirkt.
Schon vor 200 Jahren wurde das heute 11.000 Einwohner zählende Kreisstädtchen Miesbach von einem Chronisten wegen seiner "großen Roß- und Vichmärckt" gerühmt. Die Zeit der Viehmärkte unter freiem Himmel indes ging nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Bau der Oberlandhalle langsam zu Ende. Der große Anbau, den der Zuchtverband regelmäßig vermietet, entstand Ende der 70er Jahre. Dort steigen dann Jugendkulturtage oder Goaßlschnalzer lassen ihre Peitschen knallen.
Beim Kälbermarkt aber knallt die Stimme von Martin Sappel durch die Luft. Monoton und doch zackig stellt er Tier für Tier vor, verkündet den Anfangspreis - der richtet sich nach dem Gewicht - und schon sprudeln Zahlen über Zahlen über Sappels Lippen. Ein Neuling muss höllisch aufpassen, um möglichst wenig zu verpassen; und die Feinheiten des Bietens sind ohnehin eine Wissenschaft für sich.
 |
| Der Einser-Stier, ein Poldi-Sohn, musste vorübergehend in seinen Heimatstall in Fröschenthal (Neubeuern) auf dem Hof von Josef und Amalie (Foto) Scherer zurückkehren: Die Quarantäne-Station in Wasserburg ist derzeit ausgebucht. Mittlerweile werden fast alle Auktions-Stiere an Besamungsstationen verkauft. |
Ermüdungserscheinungen sind bei Martin Sappel, der seit 30 Jahren Vieh versteigert, nicht auszumachen. „Alles Übungssache“, lacht er, und er lacht auch noch als er erzählt, dass für den kommenden Tag über 600 Mastkälber erwartet werden. Dieses Pensum wird er sich aber mit einem Kollegen teilen.
P..., der bis dato namenlose Star aus Fröschenthal (Gemeinde Neubeuern), ist währenddessen zu seinem Züchter Josef Scherer zurückgekehrt. Der Poldi-Sohn – also wird auch sein Name mit P beginnen - ging zwar für hervorragende "neunundvierzigeinhalb", für 4950 Euro also, an die Besamungsstation einer Molkerei in Wasserburg. Doch dort ist die Quarantäne-Station, in der das Prachtexemplar drei Monate verbringen muss, im Moment ausgebucht.
| Geschichte des Fleckviehs Seinen Anfang nahm die Geschichte des Fleckviehs bereits im Jahr 1837, als Max Obermaier aus Gmund am Tegernsee in die Schweiz aufbrach. Mit einer 30köpfigen Herde der vielgelobten Simmenthaler Rasse kehrte er zu Fuß zurück ins Oberland. Aus Kreuzungen mit dem dortigen Vieh entwickelte sich eine neue Rasse: das Fleckvieh; daneben entwickelten sich auch andere typisch bayerische Rassen, wie das Allgäuer Braunvieh, das Fränkische Gelbvieh, Pinzgauer und die Murnau-Werdenfelser. |
Landkreis (pil) – Gottesdienste im byzantinischen anstatt im lateinischen Ritus stehen demnächst in einigen Landkreis-Gemeinden auf dem Programm. Den Auftakt macht am Samstag, 20. März, um 19 Uhr der ukrainisch-katholische Gottesdienst mit Vater Wolodymyr Firman in der Rohrdorfer Pfarrkirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor des Priesterseminars in Ternopil, der der Region für einige Tage einen Besuch abstattet. Anschließend tragen die Ukrainer einige Volkslieder aus ihrer Heimat vor.
Seit etwa zehn Jahren bestehen Verbindungen aus dem Rosenheimer und dem Priener Raum zur Diözese Ternopil und speziell zum dortigen Priesterseminar, das mittlerweile etwa 100 jungen Menschen einen Platz zum Leben, Lernen und Arbeiten bietet, schildert Katharina Schmid aus Höhenmoos; sie engagiert sich seit Jahren in einem landkreisweiten Helferkreis für Ternopil.
Die jungen Männer dort gehören der ukrainisch-katholischen Kirche an, die – anders als die orthodoxe Kirche – den Papst in Rom als ihr Oberhaupt anerkennt. Weil sie den Ritus nach ostkirchlicher Tradition feiert, wird sie auch unierte Kirche genannt. Unter Stalin wurde diese zwangsweise der orthodoxen Kirche zugeordnet, ist seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion aber wieder offiziell zugelassen. Die unierte Kirche hat dieselbe Anzahl an Sakramenten wie die römisch-katholische Kirche, allerdings unterschiedliche Ausformungen: So wird beispielsweise bei der Hochzeit dem Brautpaar eine Krone aufgesetzt, um den Bund fürs Leben zu verdeutlichen.
Die Jungpriester haben nun die Aufgabe, Pfarreien in der Diözese Ternopil zu gründen. Für die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste, in denen der Gesang eine große Rolle spielt, ist der Seminaristen-Chor zuständig. Die Fahrten in die oftmals entlegenen Ortschaften hat bislang die Diözese bezahlt wurden; künftig muss jedoch das Seminar diese Kosten – jeweils etwa zwölf Euro – selbst tragen.
Bei ihrem Besuch, erklärt Katharina Schmid weiter, wollen die Ukrainer den Rosenheimern nicht nur ihre Art der Liturgiefeier näherbringen; sie hoffen zudem auf Spenden, um den Seminarbetrieb in Ternopil aufrecht erhalten zu können.
Zu hören ist der Chor in folgenden Gottesdiensten:
20. März: Rohrdorf, 19 Uhr;
21. März: Eiselfing, 9.30; Weihenlinden, 19.30 Uhr;
22. März: Schloßberg, 19 Uhr
23. März: Aschau (Altenheim/Singen), 14.30 Uhr; Wildenwart, 19 Uhr;
24. März: Höhenmoos, 14 Uhr (Singen); Bad Aibling (St. Georg) 19 Uhr;
25. März: Höhenmoos, 19.15 Uhr;
26. März: Halfing, 19.15 Uhr;
27. März: Höslwang, 16 Uhr; Törwang 19 Uhr;
28. März: Altenbeuern, 8.30 Uhr
11. März 2004
Niedermoosen (pil) – Als Krankenkasse für die Torfstecher war er vor 101 Jahren gegründet worden. Jetzt strebt der Arbeiter-Krankenunterstützungsverein (AKUV) Niedermoosen den Status als eingetragener Verein an. Einstimmig befürworteten diesen Schritt die 49 Anwesenden bei der Generalversammlung, zu der satzungsgemäß lediglich mittels Aushang im Vereinslokal geladen wird.
Das Krankengeld – es ist mit 75 Mark (umgerechnet in Euro) jährlich, ebenso wie der Beitrag von sieben Euro, noch genauso hoch wie 1903 – nimmt seit Jahren keiner mehr in Anspruch, erklärt Vorsitzender Sepp Pilger. Er hatte den Verein 1990 mit 58 Mitgliedern übernommen; mittlerweile sind es 152. Aus dem Rücklagen-Topf müssen aber unter anderem Geschenkkörbe für Jubilare und Kränze für verstorbene Mitglieder finanziert werden – alles entsprechend der über hundert Jahre alten Satzung.
An die Öffentlichkeit tritt der AKUV zweimal im Jahr: bei der traditionellen Christbaumversteigerung beim Alten Wirt in Riedering und beim Dorffest im Juni; zum 100-jährigen hatte es Petrus allerdings nicht allzugut gemeint mit den Niedermoosenern.
 |
| Auch Ehrungen standen bei der jüngsten Versammlung auf der Tagesordnung: Georg Kaiser (2. von links) erhielt für 25jährige Mitgliedschaft eine Urkunde. Konrad Fischbacher (2. von rechts) bekam zusätzlich eine Votivtafel überreicht; er ist seit 40 Jahren beim AKUV Niedermoosen. Den beiden Geehrten gratulierten Vize Gerti Loidl und Vorstand Sepp Pilger. Foto: pil |
Rohrdorf (pil) – Bodenkunde, Jugendarbeit, Steuerrecht – die Themenpalette beim Seminar für Vereinsvorsitzende und Nachwuchskräfte, zu dem der Bayerische Landesverband für Gartenbau und Landespflege – mit 525.000 Mitgliedern in 3300 Vereinen der größte Verbund für Hobbygärtner im Freistaat - nach Rohrdorf eingeladen hatte, war breitgefächert und gezielt nach den Wünschen der Gartenbauer aus dem Landkreis Rosenheim zusammengestellt worden. Die knapp 90 Teilnehmer aus den 62 Vereinen des Kreisverbands zeugten von der Bedeutung des Seminars unter Leitung von Lutz Popp, das im Drei-Jahres-Turnus in der Region abgehalten wird.
Spätestens beim Referat von Harald Lorenz vom Landratsamt herrschte gespannte Aufmerksamkeit im Saal. Lorenz will „Lust machen auf Jugendarbeit“ und vermittelte dies seinen Zuhörern ebenso eindringlich wie unmissverständlich. Erde und Wasser – mehr braucht es meist nicht, um Kinder im Spiel versinken und die Zeit vergessen zu lassen. Doch wo ist das heute noch möglich? Die Gartenparzellen werden immer kleiner, Pausenhöfe werden zu betoniert.
Lorenz zeichnete ein düsteres Bild: Erhebungen in der Landeshauptstadt hätten ergeben, dass jedes dritte Kind bei der Einschulung nicht rückwärts gehen könne, geschweige denn auf einem Bein hüpfen:„Erschütternd!“ Selbst in seiner Heimatgemeinde Griesstätt habe er beobachtet, dass die meisten Kinder hilflos seien im Umgang mit Samenkörnern. Dafür, kritisierte er mehrfach, sei der "Gameboy-Daumenmuskel" um so stärker ausgeprägt.
Jetzt seien die Gartenbauvereine gefragt. Aktionen unter dem Motto „Wie stellst du dir deinen Schulhof vor?“ könnten den Weg zu den Kindern und Jugendlichen ebnen – wenn, schickte der Gartenamtsrat gleich hinterher, die Vorstellungen der Jungen dann auch im Rahmen des Möglichen und vor allem gemeinsam umgesetzt werden. Recht beliebt seien bei den Kindern beispielsweise Weidentipis, die an einem Vormittag gebaut werden können; das wohl älteste steht in der Franziska-Hager-Schule in Prien und ist groß genug für den Freiluftunterricht einer ganzen Klasse. Lorenz' Aufruf an die Gartenbauvereine lautet denn auch: „Gehen sie an die Schulen und Kindergärten! Die Kinder wollen arbeiten!“
Wie Jugendarbeit in der Praxis aussehen kann, schilderte Franz Kleinmaier, seit 1981 Vorsitzender in Ostermünchen. Dort durften die Grundschüler ihre eigenen Buntnesseln ziehen, die später prämiert wurden. Zwei achte Klassen bastelten zwei Schulstunden lang Meisenkästen und hängten sie im benachbarten Wald auf. Allerdings, so Kleinmaiers Erfahrung, müssen die Vereine selbst die Initiative ergreifen, wobei die Ostermünchner einen klaren Heimvorteil haben: Ihr Schriftführer geht täglich in die Schule – als Konrektor.
In vielen Gemeinden beteiligen sich mittlerweile die Gartenbauvereine am Ferienprogramm. „Ein Muss“, meint Werner Feuerer aus Soyen, um den Kontakt zu den Kindern herzustellen. Viel Vorbereitung hat sein Verein z.B. in einen indianischen Nachmittag mit Pfeiferl Schnitzen, Bogen Basteln und einem Gartenmemory gesteckt.
Auch die Familenarbeit wird großgeschrieben. Marie Antonie Haas freut sich, dass sie beim Kräuterbüschl-Binden in Schechen immer wieder neue Gesichter begrüßen kann. Auf große Resonanz sei auch der Verkostungsabend im September gestoßen, bei dem Gartenfrüchte, von süß-sauer bis herzhaft zubereitet, samt Rezepten reißenden Absatz fanden.
In Soyen entstanden 1999 nach dem Aufruf zur „Gartengestaltung im Winter“ unter anderem ein Drei-Meter-Mann sowie eine ganze Pinguin-Kolonie aus Schnee. Und dass von den 2700 Einwohnern 216 im Gartenbauverein organisiert sind, führt Vorsitzender Werner Feuerer nicht zuletzt auf die Obstpresse zurück, die vor sechs Jahren angeschafft wurde und an die Mitglieder für den symbolischen Betrag von fünf Cent pro Liter gepresstem Saft verliehen wird.
14. November 2003
Frasdorf (pil) – „Mir gefällt alles am besten!“, strahlt Benjamin und widmet sich schon wieder eingehend seinem Kartoffelsalat. Jetzt heißt es erst mal, im Schatten der Apfelbäume von Sandgrub bei Gegrilltem, Saft, Kaffee und Kuchen neue Kräfte zu schöpfen. Denn für Hunger, Durst und Riesen-Begeisterung hatte nicht zuletzt eine Kutschfahrt über die Felder am Ortsrand von Frasdorf gesorgt.
Mit ihrer Ferienprogramm-Einladung zu einem zwanglosen Gartenfest für gesunde Kinder sowie für behinderte Mädchen und Buben aus der Orthopädischen Klinik in Aschau wollte die Frasdorfer Frauenunion (FU) auf ihre Weise zum laufenden „Jahr der Behinderten“ beitragen, erklärt Vorsitzende Dr. Ursula Hofacker. Der Kontakt zu Aschau ist quasi hausgemacht: FU-Beisitzerin Monika Kink arbeitet dort als Pflegerin in der Schule und Tagesstätte.
Die 25 Gäste fühlten sich sichtlich wohl auf dem Anwesen der Familie Stuffer. Über einem kleinen Lagerfeuer durften sie Würstl grillen, eine Schaukel stand bereit, und wer wollte, legte sich einfach ins Gras und genoss das herrliche Wetter. Den größten Anziehungspunkt aber bildete zweifelsohne der „Tierpark“ von Sandgrub. An die 35 Gänse, Enten, Hasen, Katzen, Ziegen, Nymphensittiche und natürlich die speziell ausgebildeten Mischlingshunde Franzi und Maxi sorgten von vorneherein dafür, dass weder Berührungsängste noch Langeweile eine Chance hatten.
Erklärter Liebling war ohne jeden Zweifel die siebenjährige "Probe" von Josef Staber, der zuvor Kinder, Eltern und Pfleger über die Felder kutschiert hatte - ein Erlebnis, das vor allem bei den Gästen aus Aschau selige Freudenschreie hervorrief. Elif konnte sich schließlich gar nicht mehr von der Fuchsstute trennen und wurde nicht müde, ihr Grasbüschel ins Maul zu schieben.
Ohne den tatkräftigen Einsatz des gesamten zehnköpfigen Vorstands sowie ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren, betont die FU-Chefin, wäre dieser Nachmittag gar nicht zustande gekommen, zu dem sich unter anderem ihre Vorgängerin, die stellvertretende Landrätin Marianne Steindlmüller, eingefunden hatte. So hatte etwa das Seniorenheim Aschau der Klinik ganz unbürokratisch aus der Patsche geholfen und kurzfristig Kleinbus samt Fahrer für den Ausflug nach Frasdorf zur Verfügung gestellt.
Dass sich die Frauenunion auch im kommenden Jahr wieder mit einer ähnlichen Aktion am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligen wird, steht nicht nur für Ursula Hofacker bereits jetzt fest. Vize Elfriede Stettner hatte ihrer Parteifreundin, der Gastgeberin Susanne Stuffer, schon beim Kaffeetrinken lachend angedroht: „Ich glaube, das bleibt dir!“.
4. August 2003
nach oben